Die neue Weltliteratur
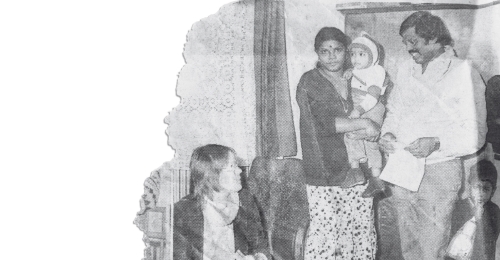
Bereits die zuvor genannten Autor*innen wie Kloeble entsprechen (zum gewissen Grad) der Idee der neuen Weltliteratur. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler (*1942) erläutert sie wie folgt:
Indem sie Kulturgrenzen überschritten und damit auch erweiterten, wurden die Zugereisten zu Urhebern einer neuen Literatur des Dazwischen, des Oszillierens zwischen den Kulturen, der mehrfachen Identitäten. Sie erzählten vom Glück und Unglück hybrider Mischungen. Sie erzählten von einer Welt „in Transit“, in einem beunruhigenden und widersprüchlich kodierten Zwischenraum unklarer Zugehörigkeiten. Sie brachten Kunde vom provisorischen Leben in diesem „Dritten Raum“ – in einem auf Dauer gestellten Transitorium zwischen Aufbruch und Ankunft. Möglicherweise ist dieser „Dritten Raum“ ohnehin der stimmigste Ort der migrantischen Moderne.
(Sigrid Löffler: Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler. München 2014, S. 8.)
Diese „Literatur des Dazwischen“ (ebd., S. 10) oder auch „Literatur mit Akzent“ (ebd., S. 15) wird vorrangig durch die deutschsprachigen Autor*innen indischer Herkunft repräsentiert. Allerdings werden die Stimmen der hiesigen indischen Diaspora erst allmählich in der deutschen Literatur ruchbar. Im Vergleich zu den englischsprachigen Ländern erst spät, was am deutschen Literaturbetrieb liegen mag und/oder an der Diaspora selbst, die hier nicht nur kleiner ist, sondern auch aufgrund der deutschen Sprache ein Bindeglied nach Indien fehlen lässt. Während Literat*innen wie Rushdie und Jhumpa Lahiri (*1967) unlängst die literarische Weltbühne erklommen, sind die Autor*innen der indischen „Migrations-“, „Brücken-“ oder besser der neuen Weltliteratur noch an der Hand abzählbar. Autor*innen wie Kloeble und Trojanow läuten durch ihren postkolonialen Ansatz und den Einsatz von europäischen, gar gemischten Erzähler*innen eine neue Ära der Indienrezeption im deutschsprachigen Literaturraum ein. Durch Autor*innen wie Mithu Sanyal (1971*), Ralph Tharayil (1986*), Krisha Kops (1986*) und Senthuran Varatharajah (1984*) begegnen wir jedoch insofern einer weiteren Facette der Interkulturalität, als die Biografien der Schriftsteller*innen noch enger mit der Thematik verwoben sind. Das macht sich alleine dadurch bemerkbar, dass die Held*innen ihrer Texte keine historischen Persönlichkeiten sind, sondern nahe an der eigenen Biografie.
Varatharaja wurde als Sohn tamilischer Eltern in Jaffna auf Sri Lanka geboren, bevor die Familie aufgrund des Bürgerkrieges in Oberfranken Asyl suchte. Bisher definierte ich „Indien“ nicht näher. Da ich nicht von der heutigen Nation ausgehe, sondern vom kulturellen Raum – der vor allem sprachlich, religiös und historisch mit dem tamilischen Sri Lanka überlappt –, erlaube ich mir, Varatharajah an dieser Stelle ebenso heranzuziehen. Obzwar auch sein zweiter Roman Rot (Hunger) (2022) Sri-Lanka-Bilder verhandelt, konzentriere ich mich auf seinen preisgekrönten ersten Von der Zunahme der Zeichen (2016).
Das Werk ist eine Art moderner Briefroman, in dem sich der Doktorand Senthil Vasuthevan und die Studentin Valmira Surroi, ohne sich je zu begegnen, auf Facebook sieben Tage lang schreiben. Sie berichten von Flucht und Bürgerkrieg. Er von Sri Lanka, sie vom Kosova. Von ihren Erfahrungen im Asylantenheim, in der Schule, dem Studium. Anstatt dass uns das idealisierte Bild eines Ortes vorgehalten wird, haben wir es mit Zwischenräumen und einer gleichzeitigen Relativierung von Örtlichkeiten zu tun. (Vgl. a. Jonas Teupert: Sharing Fugitive Lives. Digital Encounters in Senthuran Varatharajah's Vor der Zunahme der Zeichen. In: TRANSIT 11/2, 2018, S. 3-20.) Es ist ein Zwischen, das sich inmitten der unterschiedlichen Kasten seiner Eltern, ihnen und Senthil sowie Hinduismus und den Zeugen Jehovas legt. Dass sich nicht nur – wie bei den meisten hybriden Literaturen – zwischen Flucht, Ankunft und allen Stationen dazwischen wiederfindet, sondern inmitten von Virtuellem und Analogem. Für die kosmopolitischen Protagonisten, welche unter anderem für ihre Konferenzen auf der ganzen Welt unterwegs sind, verflüchtigt sich Raum und damit die Romantisierung dessen.
Mithin wird Sri Lanka nicht exotisiert. Im Gegenteil: Es ist das Land des Bürgerkrieges, das man hinter sich lassen musste. Diese nahezu Anti-Idealisierung offenbart sich ebenso in einer Sprache, die sich durch ihre Nüchternheit verwehrt, dem Gebieterischen anheimzufallen. Hinzu kommt das Stilmittel der Wiederholung, als über die Sri Lankische Armee berichtet wird: „sie kamen ohne ankündigung. sie kamen durch wände. sie kamen tag und nacht.“ (Senthuran Varatharajah: Vor der Zunahme der Zeichen. Frankfurt a.M. 2021, S. 81.) Das Bild Sri Lankas ist ein unsichtbares, das an Senthil selbst haftet. Ein Bild, das man oft nur sieht, wenn es andere sehen, wenn es heißt, dass seine Haut keine Hautfarbe sei. Das Bild ist also da und entzieht sich zugleich. Ahila, eine Tamilin, der Senthil in New York begegnet, sagt zu ihm: „wherever i am, i am what is missing.“ (Ebd., S. 147.) Das gilt auch für Senthil. Er verkörpert das Bild, das zugleich absent ist. Diese Präsenz der Absenz zeigt sich einerseits in den Protagonist*innen selbst, die im virtuellen Raum zugleich da sind und nicht. Andererseits wird sie in der Sprache erkennbar. So spricht Senthil kein Wort Tamil mit Ahila, spuckt ihr stattdessen in den Mund. An einer anderen Stelle äußert Senthils Großonkel gegenüber seinem Neffen: „deine Kinder sind das ende unserer sprache.“ (Ebd., S. 154.)
Die Sprache selbst wird zu einer Grenzerfahrung, die es niemals schafft, das Absente auszusprechen und es dennoch, dem Roman gleich, unaufhörlich versucht: „... und trotzdem rennen wir gegen die grenzen der sprache an.“ (Ebd., S. 30.) Diese Grenze ist jedoch auch der Nicht-raum, die U-topie, in dem sich die Schönheit des Über-setzens zeigt. Senthil beschreibt an einer Stelle, dass sich Vokalzeichen, uyir eluttu zu Tamil, ins Deutsche als Seelenbuchstaben übersetzen lassen. Und doch gibt es da eine Unübersetzbarkeit, die versinnbildlicht wird, wenn Senthil davon berichtet, dass es noch kein Wörterbuch für Deutsch-Tamil gebe. Sprache verliert in der Grenzerfahrung die Selbst-verständlichkeit, Doppeldeutigkeit wird ins Bewusstsein geholt. Eine Doppeldeutigkeit, aus dem der Boden ist, auf dem sich die Migrant*innen immerzu bewegen, zwischen ausweisen als Akt des Bleibens und ausweisen als Akt des Abschiebens.
Der im Frühjahr des Jahres 2023 erscheinende Debütroman Nimm die Alpen weg des Schweizer Autors mit südindischen Wurzeln Tharayil zeigt eine weitere Art, mit dem Indienbild umzugehen. Denn das, was Varatharja in Teilen vormacht, treibt Tharayil ins Extreme: Er lässt das Indienbild weg. Beziehungsweise macht die sich bei der Lektüre immer wieder aufdrängende, auch sprachlich vermittelte Absenz Indiens das Land gegenwärtiger als in manch anderem Text, der es imaginiert. Dies geschieht vor allem mithilfe der Elternfiguren, die durch ihr Verhalten, ihre Sprache, Vergangenheit und Ansichten ein Indien mit sich tragen, das gleichzeitig immerzu entzogen bleibt. Gerade das macht sie zu Charakteren des Da-zwischen, des Transits, deren Position oftmals im Konflikt zum erzählenden Wir steht, den Kindern. Diese verkörpern ebenso eine Form des „dritten Raums“, jedoch eine andere als ihre Eltern. Beide begegnen sie der Frage nach dem Woher auf unterschiedliche Weise.
Sens Kategorien werden der Literatur Varatharajahs, Tharayils wie auch der anderen Brückenautor*innen nicht gerecht. Im höchsten Falle ist bei den Autor*innen hier und da ein kuratorisches Element zu finden. Man müsste für diese Romanciers eine neue Rubrik einführen, könnte sie die „ortlose Orthaftigkeit“, die des Zwischen oder einfach nur die interkulturelle nennen. (Ram Adhar Mall: Philosophie im Vergleich der Kulturen. Interkulturelle Philosophie – eine neue Orientierung. Darmstadt 1995, S. 10.)
Weitere Kapitel:
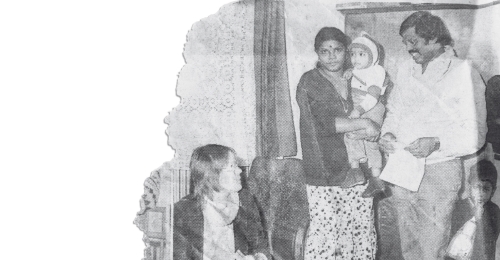
Bereits die zuvor genannten Autor*innen wie Kloeble entsprechen (zum gewissen Grad) der Idee der neuen Weltliteratur. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler (*1942) erläutert sie wie folgt:
Indem sie Kulturgrenzen überschritten und damit auch erweiterten, wurden die Zugereisten zu Urhebern einer neuen Literatur des Dazwischen, des Oszillierens zwischen den Kulturen, der mehrfachen Identitäten. Sie erzählten vom Glück und Unglück hybrider Mischungen. Sie erzählten von einer Welt „in Transit“, in einem beunruhigenden und widersprüchlich kodierten Zwischenraum unklarer Zugehörigkeiten. Sie brachten Kunde vom provisorischen Leben in diesem „Dritten Raum“ – in einem auf Dauer gestellten Transitorium zwischen Aufbruch und Ankunft. Möglicherweise ist dieser „Dritten Raum“ ohnehin der stimmigste Ort der migrantischen Moderne.
(Sigrid Löffler: Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler. München 2014, S. 8.)
Diese „Literatur des Dazwischen“ (ebd., S. 10) oder auch „Literatur mit Akzent“ (ebd., S. 15) wird vorrangig durch die deutschsprachigen Autor*innen indischer Herkunft repräsentiert. Allerdings werden die Stimmen der hiesigen indischen Diaspora erst allmählich in der deutschen Literatur ruchbar. Im Vergleich zu den englischsprachigen Ländern erst spät, was am deutschen Literaturbetrieb liegen mag und/oder an der Diaspora selbst, die hier nicht nur kleiner ist, sondern auch aufgrund der deutschen Sprache ein Bindeglied nach Indien fehlen lässt. Während Literat*innen wie Rushdie und Jhumpa Lahiri (*1967) unlängst die literarische Weltbühne erklommen, sind die Autor*innen der indischen „Migrations-“, „Brücken-“ oder besser der neuen Weltliteratur noch an der Hand abzählbar. Autor*innen wie Kloeble und Trojanow läuten durch ihren postkolonialen Ansatz und den Einsatz von europäischen, gar gemischten Erzähler*innen eine neue Ära der Indienrezeption im deutschsprachigen Literaturraum ein. Durch Autor*innen wie Mithu Sanyal (1971*), Ralph Tharayil (1986*), Krisha Kops (1986*) und Senthuran Varatharajah (1984*) begegnen wir jedoch insofern einer weiteren Facette der Interkulturalität, als die Biografien der Schriftsteller*innen noch enger mit der Thematik verwoben sind. Das macht sich alleine dadurch bemerkbar, dass die Held*innen ihrer Texte keine historischen Persönlichkeiten sind, sondern nahe an der eigenen Biografie.
Varatharaja wurde als Sohn tamilischer Eltern in Jaffna auf Sri Lanka geboren, bevor die Familie aufgrund des Bürgerkrieges in Oberfranken Asyl suchte. Bisher definierte ich „Indien“ nicht näher. Da ich nicht von der heutigen Nation ausgehe, sondern vom kulturellen Raum – der vor allem sprachlich, religiös und historisch mit dem tamilischen Sri Lanka überlappt –, erlaube ich mir, Varatharajah an dieser Stelle ebenso heranzuziehen. Obzwar auch sein zweiter Roman Rot (Hunger) (2022) Sri-Lanka-Bilder verhandelt, konzentriere ich mich auf seinen preisgekrönten ersten Von der Zunahme der Zeichen (2016).
Das Werk ist eine Art moderner Briefroman, in dem sich der Doktorand Senthil Vasuthevan und die Studentin Valmira Surroi, ohne sich je zu begegnen, auf Facebook sieben Tage lang schreiben. Sie berichten von Flucht und Bürgerkrieg. Er von Sri Lanka, sie vom Kosova. Von ihren Erfahrungen im Asylantenheim, in der Schule, dem Studium. Anstatt dass uns das idealisierte Bild eines Ortes vorgehalten wird, haben wir es mit Zwischenräumen und einer gleichzeitigen Relativierung von Örtlichkeiten zu tun. (Vgl. a. Jonas Teupert: Sharing Fugitive Lives. Digital Encounters in Senthuran Varatharajah's Vor der Zunahme der Zeichen. In: TRANSIT 11/2, 2018, S. 3-20.) Es ist ein Zwischen, das sich inmitten der unterschiedlichen Kasten seiner Eltern, ihnen und Senthil sowie Hinduismus und den Zeugen Jehovas legt. Dass sich nicht nur – wie bei den meisten hybriden Literaturen – zwischen Flucht, Ankunft und allen Stationen dazwischen wiederfindet, sondern inmitten von Virtuellem und Analogem. Für die kosmopolitischen Protagonisten, welche unter anderem für ihre Konferenzen auf der ganzen Welt unterwegs sind, verflüchtigt sich Raum und damit die Romantisierung dessen.
Mithin wird Sri Lanka nicht exotisiert. Im Gegenteil: Es ist das Land des Bürgerkrieges, das man hinter sich lassen musste. Diese nahezu Anti-Idealisierung offenbart sich ebenso in einer Sprache, die sich durch ihre Nüchternheit verwehrt, dem Gebieterischen anheimzufallen. Hinzu kommt das Stilmittel der Wiederholung, als über die Sri Lankische Armee berichtet wird: „sie kamen ohne ankündigung. sie kamen durch wände. sie kamen tag und nacht.“ (Senthuran Varatharajah: Vor der Zunahme der Zeichen. Frankfurt a.M. 2021, S. 81.) Das Bild Sri Lankas ist ein unsichtbares, das an Senthil selbst haftet. Ein Bild, das man oft nur sieht, wenn es andere sehen, wenn es heißt, dass seine Haut keine Hautfarbe sei. Das Bild ist also da und entzieht sich zugleich. Ahila, eine Tamilin, der Senthil in New York begegnet, sagt zu ihm: „wherever i am, i am what is missing.“ (Ebd., S. 147.) Das gilt auch für Senthil. Er verkörpert das Bild, das zugleich absent ist. Diese Präsenz der Absenz zeigt sich einerseits in den Protagonist*innen selbst, die im virtuellen Raum zugleich da sind und nicht. Andererseits wird sie in der Sprache erkennbar. So spricht Senthil kein Wort Tamil mit Ahila, spuckt ihr stattdessen in den Mund. An einer anderen Stelle äußert Senthils Großonkel gegenüber seinem Neffen: „deine Kinder sind das ende unserer sprache.“ (Ebd., S. 154.)
Die Sprache selbst wird zu einer Grenzerfahrung, die es niemals schafft, das Absente auszusprechen und es dennoch, dem Roman gleich, unaufhörlich versucht: „... und trotzdem rennen wir gegen die grenzen der sprache an.“ (Ebd., S. 30.) Diese Grenze ist jedoch auch der Nicht-raum, die U-topie, in dem sich die Schönheit des Über-setzens zeigt. Senthil beschreibt an einer Stelle, dass sich Vokalzeichen, uyir eluttu zu Tamil, ins Deutsche als Seelenbuchstaben übersetzen lassen. Und doch gibt es da eine Unübersetzbarkeit, die versinnbildlicht wird, wenn Senthil davon berichtet, dass es noch kein Wörterbuch für Deutsch-Tamil gebe. Sprache verliert in der Grenzerfahrung die Selbst-verständlichkeit, Doppeldeutigkeit wird ins Bewusstsein geholt. Eine Doppeldeutigkeit, aus dem der Boden ist, auf dem sich die Migrant*innen immerzu bewegen, zwischen ausweisen als Akt des Bleibens und ausweisen als Akt des Abschiebens.
Der im Frühjahr des Jahres 2023 erscheinende Debütroman Nimm die Alpen weg des Schweizer Autors mit südindischen Wurzeln Tharayil zeigt eine weitere Art, mit dem Indienbild umzugehen. Denn das, was Varatharja in Teilen vormacht, treibt Tharayil ins Extreme: Er lässt das Indienbild weg. Beziehungsweise macht die sich bei der Lektüre immer wieder aufdrängende, auch sprachlich vermittelte Absenz Indiens das Land gegenwärtiger als in manch anderem Text, der es imaginiert. Dies geschieht vor allem mithilfe der Elternfiguren, die durch ihr Verhalten, ihre Sprache, Vergangenheit und Ansichten ein Indien mit sich tragen, das gleichzeitig immerzu entzogen bleibt. Gerade das macht sie zu Charakteren des Da-zwischen, des Transits, deren Position oftmals im Konflikt zum erzählenden Wir steht, den Kindern. Diese verkörpern ebenso eine Form des „dritten Raums“, jedoch eine andere als ihre Eltern. Beide begegnen sie der Frage nach dem Woher auf unterschiedliche Weise.
Sens Kategorien werden der Literatur Varatharajahs, Tharayils wie auch der anderen Brückenautor*innen nicht gerecht. Im höchsten Falle ist bei den Autor*innen hier und da ein kuratorisches Element zu finden. Man müsste für diese Romanciers eine neue Rubrik einführen, könnte sie die „ortlose Orthaftigkeit“, die des Zwischen oder einfach nur die interkulturelle nennen. (Ram Adhar Mall: Philosophie im Vergleich der Kulturen. Interkulturelle Philosophie – eine neue Orientierung. Darmstadt 1995, S. 10.)

