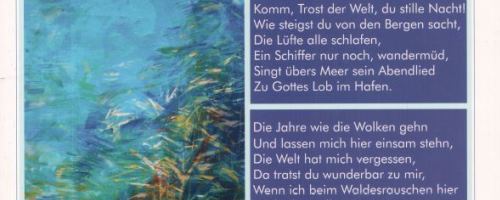Erinnerungen zum 30-jährigen Jubiläum und zur Entstehungsgeschichte der „Literatur in Bayern“
Universitäten sind – auch in Bayern – autonom und regeln die Berufung ihrer Professoren selbst.
Einer nicht ausrottbaren Legende zufolge soll jedoch die Gründung eines Instituts für Bayerische Literaturgeschichte unter dem Dach der Ludwig-Maximilians-Universität München eine Idee von Marianne Strauß sein, Frau des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß.
Jedenfalls wurde das Institut 1984 gegründet, das einzige im deutschen Sprachraum und innerhalb der Germanistik in Deutschland, das regionale Literaturgeschichte zum Forschungsgegenstand hatte.
Vermutlich noch Übelwollendere streuten das Gerücht aus, der erste Lehrstuhlinhaber sollte dem damaligen Kultusminister Maier möglichst ähnlich schauen, um den Ruf zu bekommen.
Tatsächlich konnte man im ersten Lehrstuhlinhaber, wenn man wollte, eine gewisse Ähnlichkeit mit Hans Maier feststellen, aber das war natürlich ein Witz.
Dass der Mann in Wahrheit Sozialdemokrat war, interessierte schon gar niemanden mehr von denen, die bayernweit aufbrüllten.
Aus Berlin kommt der, „a Breiss“, zum Wahnsinnigwerden: auf den Lehrstuhl für Bayerische Literaturgeschichte, das darf nicht wahr sein. „Dietz“ heißt er und „Rüdiger“ auch noch: oh je oh je, so heißt doch keiner in Bayern, mit Bindestrich dazu; „Dietz-Rüdiger“, ja, wo samma denn?! Und „Moser“ mit Nachnamen, vermutlich also einer, der rummosert, womöglich über bayerische Befindlichkeiten (was er dann auch tatsächlich genüsslich tat).
Kann kein Bairisch, natürlich nicht, und hat auch keine Ahnung von bayerischer Literatur, ja, er ist nicht einmal Literaturwissenschaftler. Das ist natürlich wirklich ein Hammer! Seine Doktorarbeit schrieb er in Musikwissenschaft (übrigens ein Nachkomme der Clara Schumann), und seinen Professorentitel erwarb er als Volkskundler. Da passt aber schon gar nix!
Ein Aufschrei erhob sich im Bayernland – mit am lautesten ein Mann mit dem auch nicht uninteressanten Namen „Rattelmüller“, seines Zeichens Bezirksheimatpfleger in Oberbayern, unter anderem auch für den Entwurf der Fahne des bayerischen Ministerpräsidenten verantwortlich. Ein Shakespeare-Drama auf bairischem Boden musste seinen Lauf nehmen: Rattelmüller versus Moser. Rattelmüller fand es lächerlich, dass „ein bayrischer Literaturgeschichtsprofessor für bayrische Literatur mit Vornamen Dietz-Rüdiger heißt und in Berlin geboren ist“ – eine „Demütigung Bayerns“. Außerdem natürlich eine glatte Fehlbesetzung des Literatur-Lehrstuhls mit einem Volkskundler; Rattelmüller: „Wenn ich mir den Fuß breche, möchte ich nicht von einem Zahnarzt behandelt werden“.
Über Mosers Einwand, dass „Dietrich“ wie „Rüdiger“ Figuren aus dem Nibelungenlied sind, das doch zur bayerischen Literatur gehört, konnte man kaum lachen in diesen Kreisen, weil man so weit noch gar nicht gedacht hatte. Allerdings veranstaltete Dietz-Rüdiger Moser schon sehr bald ein Symposion über das Nibelungenlied – für das Institut für Bayerische Literaturgeschichte. Und rief eine Zeitschrift ins Leben: Die Literatur in Bayern. Lauter Sachen, die eben noch niemand in Bayern gemacht hatte. Und auch noch am Leben blieben. Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Publikationen, die „Bayern“ zum Thema hatte – und eine nach der anderen eingingen.
Dietz-Rüdiger Moser erwies sich als zäh, als außerordentlich zäh.
Auch als zehn Kollegen einer Meinung waren, welcher von elf Lehrstühlen in der Germanistik nach staatlicher Maßgabe (Marianne Strauß und auch ihr Mann waren nicht mehr am Leben) eingespart werden sollte: der für Bayerische Literaturgeschichte. Das war 1999. Bei allem Respekt: Moser hatte ein gewisses Geschick, sich keine Freunde zu machen. Bis 2004 rettete man sich noch durch als Lehrstuhl für Bayerische Kulturgeschichte, Mitglied des Instituts für Bayerische Geschichte, dann war auch damit Schluss.
Untergebracht war man in dieser Zeit in der Theresienstraße in einem Gebäude der Fakultät für Mathematik der Ludwig-Maximilians-Universität, in dem sich auch die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns befinden, unter anderem das Museum Reich der Kristalle der Mineralogischen Staatssammlung mit Diamanten, Smaragden, einer Meteoritensammlung, dem König-Ludwig-Diamant und eben dem Institut für Bayerische Literaturgeschichte, eher ein Meteorit von einem anderen Stern als ein König-Ludwig-Diamant.
Schon rein räumlich gehörte dieses Institut nicht zur Germanistik, auch nicht zu den Geisteswissenschaften, im Grunde nicht einmal zur Universität. Aber das war immer so: Der Standort zuvor war auch recht passend für ein solches Institut das Amerikahaus am Karolinenplatz gewesen. Mir war das Amerikahaus voher nur aus den Zeiten der Studentenbewegung in den Jahren 1968 und folgende bekannt, in denen wir unbedingt der Meinung waren, die Amerikaner müssten den Krieg in Vietnam beenden, und zwar sofort. Zu unserer großen Überraschung hörten die Amerikaner nicht auf uns, aber weil die Moral eindeutig auf unserer Seite lag, folgten Farbbeutel als Argumente, welche gegen das Gebäude flogen und dort eine Art abstraktes Fresko in verschiedenen Farbtönen hinterließen; ich erinnerte mich noch lange an ihre Flugbahnen und das Geräusch ihres Aufplatzens am Gemäuer, aber die Amerikaner ließen sich auch davon nicht beeindrucken. Ich stand jetzt auf der Innenseite der Wand mit den Farbflecken und trank mit dem Direktor des Hauses so manches Bier, meist im Anschluss einer Veranstaltung von Literatur in Bayern. Ich erzählte ihm auch von den Farbbeuteln und ihren Flugbahnen und dem Geräusch ihres Aufplatzens am Gemäuer, und wir lachten. Es waren sehr entspannte Gespräche. Wir einigten uns darauf, dass auch Farbbeutel ein Beitrag zur Fassadengestaltung sein können.
Für die damalige Zeit recht als exotische Erscheinung für ein Institut für Bayerische Literaturgeschichte erschien auch die Sekretärin des Hauses. Nachdem sie zum Islam konvertiert war, trug sie natürlich ein Kopftuch, das war neu im Hause: Die bayerische Literaturgeschichte im Amerikahaus mit einer muslimischen Sekretärin. Inzwischen steht das Amerikahaus am Karolinenplatz leer, Amerika hat kein Geld mehr für ein Haus, das sich auf seinen Namen beruft; auch verbleichen an dem vor sich hin verfallenden Gebäude die Flecken von den Farbbeuteln. Die Geschichte bringt es mit sich, dass Dinge auch wieder verschwinden.
Nach der definitiv endgültigen Schließung des Instituts landete mit einem Male sein gesamtes Inventar auf dem Gehsteig der Theresienstraße, die Bibliothek, das Archiv – und plötzlich steht auch eine rote Bulldogge, 3-D-gewordenes Logo der Zeitschrift Simplicissimus, einst Paradestück der Ausstellung über den Simplicissimus, seinerzeit noch im Amerikahaus, kalbsgroß auf der Theresienstraße. Gott sei Dank habe ich einen VW-Bus, mit dem ich wenigstens einen kleinen Stapel Kulturgutes retten kann, inklusive der roten Bulldogge, und fahre damit nach Hause. Zufällig steht gerade auf dem Königsplatz die Nachbildung des trojanischen Pferdes vor der Antikensammlung. Irgendein Teufel, der mich reitet, gibt mir die Eingebung, anzuhalten und die rote Bulldogge des Simplicissimus dem trojanischen Pferd unterzustellen. Es sieht aus, als bießelte der Hund dem Pferd ans Bein, Simplicissimus und die Literatur in Bayern dem Trojanischen Pferd. „Die Mauern von Troja sind längst verfallen, doch sie stehen in Homers Gedicht“, notiert sich Ernst Jünger in sein Tagebuch Siebzig verweht am 10.2.1974. Bald drei Jahrtausende überdauert diese Geschichte das Vergessen der Menschheit, das ist tröstlich, das macht Mut.
Den Hund habe ich immer noch. Zeitweise habe ich ihn dem Gulbransson-Museum am Tegernsee überlassen, damit ich auch einmal in meinem Leben in einem Museum so ein Schildchen lesen kann: „Das Exponat ist Leihgabe von Gerd Holzheimer“. Etwas in der Richtung hatte ich mir schon als Bub gewünscht. Es ist schon toll, wenn man Herausgeber einer Zeitschrift ist! Dass ich aber Mitglied der Gulbransson-Gesellschaft bin, ist, glaube ich, eher dem Umstand zu verdanken, dass sich mein Äußeres immer rasanter dem des Olaf Gulbransson nähert. Vermutlich möchte mich das Olaf-Gulbransson-Musweum dermaleinst als Mumie aufstellen, mit der Aufschrift „Olaf Gulbransson“, aber das ist nur meine Hypothese, von der die Museumsleitung keine Ahnung hat.
Die drei Jahrzehnte des Bestehens der Zeitschrift kann ich einigermaßen überschauen, weil ich von Dietz-Rüdiger Moser am Anfang als Autor für die Literatur in Bayern eingeladen war. Als seinerzeit noch relativ junger Autor saß ich unter anderem mit Autoren wie Michael Ende oder August Kühn auf der Bühne, zwei Autoren, welche die Spannweite von Mosers Spektrum nicht besser illustrieren könnten. Michael Ende, der eine, damals schon längst ein Autor von Weltformat, seit den Geschichten um Jim Knopf und später mit Momo und der Unendlichen Geschichte regelrecht mit Kultstatus versehen: ein freundlicher bescheidener Mann voller Zuwendung – der andere, August Kühn, Autor einer seinerzeit vielbeachteten Familienchronik mit dem Titel Zeit zum Aufstehn; sie erreichte die stolze Auflage von weltweit zwei Millionen Exemplaren, wurde verfilmt und als „Buddenbrooks der Arbeiter“ bezeichnet. Lüftete Kühn, bekennender Kommunist, sein Trachtenhütl, kam darunter die jüdische Kippa zum Vorschein – alles Literatur in Bayern: ein führender Vertreter der phantastischen Literatur, ein engagierter Vertreter eines sozialkritischen Schreibansatzes im Stil des sozialistischen Realismus – und eine Reihe junger Autoren.
Nach einigen Jahren wollte Dietz-Rüdiger Moser mich auch als Lehrperson in das Institut einbinden, was mich für eine Zeitlang wieder in einen Studenten verwandelte. Ich hatte als akademischen Ausweis nur eine abgebrochene Doktorarbeit in alter Geschichte, also wollten die entsprechenden Scheine nachgeholt werden, parallel zum Verfassen der Promotion. In der mündlichen Prüfung, dem Rigorosum, hat mich Professor Moser derart in die Mangel genommen, wie kein anderer meiner Prüfer, wohl um nicht den leisesten Zweifel aufkommen zu lassen, dass ich vielleicht etwas geschenkt bekäme. Freilich hatte man sich schon im Promotionsbüro bei meiner Anmeldung gewundert: „Aber Sie sa doch a Mo!“ Moser hatte nämlich ausschließlich Doktorandinnen bis dahin gehabt. Ich äußerte den Verdacht, dass er vielleicht einen „native speaker“ an seinem Institut bräuchte, den ich dann ja auch abgab – bis ich wieder hinausflog, weil ihm fast zeitgleich zwei Äußerungen von mir ans Ohr gekommen waren, die zwar entweder nicht von mir oder aber aus der Rubrik „dumm dahergredt“ waren, jedenfalls die sich ein Häuptling nicht so gerne gefallen lassen mag.
Viele Jahre später kam es zu einer ungewollten Wiederbegegnung, eigentlich ein Alptraum, denn wenn man in einem Gebäude einen Lift betritt, ohne vorher zu schauen, wer drin ist, wird man natürlich zum Gefangenen der Situation, da gibt's kein Entrinnen. Spontan tat ich etwas ganz Menschliches. Ich grüßte und fragte: „Wie geht's?“ „Ich habe Krebs!“ sagt er. Und noch spontaner rutscht mir heraus: „Oh, Scheiße!“ Und umarme ihn.
Seitdem gehöre ich wieder dazu, ohne dass wir je über ein Davor oder Danach gesprochen hätten. Allerdings auch nicht über sein Vermächtnis, das er seiner letzten Assistentin und Mitherausgeberin hinterlassen hatte. Ob sie sich vorstellen könne, mit dem Holzheimer zusammen die Zeitschrift weiter herauszugeben. Zu Lebzeiten hätte ich dankend abgewunken: „Lieber Moser, sehr ehrenvoll, aber das ist nicht mein Ding!“ Er hat es mir aber nicht gesagt. Was aber sagt man einem Toten?
Und was macht man, wenn die Mitherausgeberin über ein halbes Jahr lang vom Erdboden verschluckt ist, keine Ausgabe mehr erscheint – und Abonnenten und Inserenten auf die tolle Idee kommen: Da gibt's doch noch einen zweiten! Und rücken diesem Zweiten auf die Pelle.
So wird man Herausgeber. Und springt erst einmal im Quadrat. Fährt in den Gäuboden nach Straubing, um mit dem Chef des Verlagshauses zu sprechen, in dem die Zeitschrift gedruckt wird. Und Spargel zu essen, mitten auf dem Marktplatz in Straubing. Keiner geht grußlos an uns vorüber, der Verleger ist eine absolute Größe. „Ich hab mir grad einen Eishockeyclub gekauft“ erzählt er zwischen zwei Spargelstangerl. Später kommt noch die Münchner Abendzeitung dazu. Gesetzt wurde die Literatur in Bayern allerdings nicht dort, sondern bei mir ums Eck in Gauting, bei einer Firma, die sich den Ideen der Zukunftsstadt Auroville verpflichtet fühlt.
Ich fand das sehr passend: die Literatur in Bayern zwischen Gäuboden und Auroville. Im Jubiläumsjahr kommt nun aber alles unter ein Dach, das des allitera-Verlags in München.
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
Erinnerungen zum 30-jährigen Jubiläum und zur Entstehungsgeschichte der „Literatur in Bayern“
Universitäten sind – auch in Bayern – autonom und regeln die Berufung ihrer Professoren selbst.
Einer nicht ausrottbaren Legende zufolge soll jedoch die Gründung eines Instituts für Bayerische Literaturgeschichte unter dem Dach der Ludwig-Maximilians-Universität München eine Idee von Marianne Strauß sein, Frau des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß.
Jedenfalls wurde das Institut 1984 gegründet, das einzige im deutschen Sprachraum und innerhalb der Germanistik in Deutschland, das regionale Literaturgeschichte zum Forschungsgegenstand hatte.
Vermutlich noch Übelwollendere streuten das Gerücht aus, der erste Lehrstuhlinhaber sollte dem damaligen Kultusminister Maier möglichst ähnlich schauen, um den Ruf zu bekommen.
Tatsächlich konnte man im ersten Lehrstuhlinhaber, wenn man wollte, eine gewisse Ähnlichkeit mit Hans Maier feststellen, aber das war natürlich ein Witz.
Dass der Mann in Wahrheit Sozialdemokrat war, interessierte schon gar niemanden mehr von denen, die bayernweit aufbrüllten.
Aus Berlin kommt der, „a Breiss“, zum Wahnsinnigwerden: auf den Lehrstuhl für Bayerische Literaturgeschichte, das darf nicht wahr sein. „Dietz“ heißt er und „Rüdiger“ auch noch: oh je oh je, so heißt doch keiner in Bayern, mit Bindestrich dazu; „Dietz-Rüdiger“, ja, wo samma denn?! Und „Moser“ mit Nachnamen, vermutlich also einer, der rummosert, womöglich über bayerische Befindlichkeiten (was er dann auch tatsächlich genüsslich tat).
Kann kein Bairisch, natürlich nicht, und hat auch keine Ahnung von bayerischer Literatur, ja, er ist nicht einmal Literaturwissenschaftler. Das ist natürlich wirklich ein Hammer! Seine Doktorarbeit schrieb er in Musikwissenschaft (übrigens ein Nachkomme der Clara Schumann), und seinen Professorentitel erwarb er als Volkskundler. Da passt aber schon gar nix!
Ein Aufschrei erhob sich im Bayernland – mit am lautesten ein Mann mit dem auch nicht uninteressanten Namen „Rattelmüller“, seines Zeichens Bezirksheimatpfleger in Oberbayern, unter anderem auch für den Entwurf der Fahne des bayerischen Ministerpräsidenten verantwortlich. Ein Shakespeare-Drama auf bairischem Boden musste seinen Lauf nehmen: Rattelmüller versus Moser. Rattelmüller fand es lächerlich, dass „ein bayrischer Literaturgeschichtsprofessor für bayrische Literatur mit Vornamen Dietz-Rüdiger heißt und in Berlin geboren ist“ – eine „Demütigung Bayerns“. Außerdem natürlich eine glatte Fehlbesetzung des Literatur-Lehrstuhls mit einem Volkskundler; Rattelmüller: „Wenn ich mir den Fuß breche, möchte ich nicht von einem Zahnarzt behandelt werden“.
Über Mosers Einwand, dass „Dietrich“ wie „Rüdiger“ Figuren aus dem Nibelungenlied sind, das doch zur bayerischen Literatur gehört, konnte man kaum lachen in diesen Kreisen, weil man so weit noch gar nicht gedacht hatte. Allerdings veranstaltete Dietz-Rüdiger Moser schon sehr bald ein Symposion über das Nibelungenlied – für das Institut für Bayerische Literaturgeschichte. Und rief eine Zeitschrift ins Leben: Die Literatur in Bayern. Lauter Sachen, die eben noch niemand in Bayern gemacht hatte. Und auch noch am Leben blieben. Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Publikationen, die „Bayern“ zum Thema hatte – und eine nach der anderen eingingen.
Dietz-Rüdiger Moser erwies sich als zäh, als außerordentlich zäh.
Auch als zehn Kollegen einer Meinung waren, welcher von elf Lehrstühlen in der Germanistik nach staatlicher Maßgabe (Marianne Strauß und auch ihr Mann waren nicht mehr am Leben) eingespart werden sollte: der für Bayerische Literaturgeschichte. Das war 1999. Bei allem Respekt: Moser hatte ein gewisses Geschick, sich keine Freunde zu machen. Bis 2004 rettete man sich noch durch als Lehrstuhl für Bayerische Kulturgeschichte, Mitglied des Instituts für Bayerische Geschichte, dann war auch damit Schluss.
Untergebracht war man in dieser Zeit in der Theresienstraße in einem Gebäude der Fakultät für Mathematik der Ludwig-Maximilians-Universität, in dem sich auch die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns befinden, unter anderem das Museum Reich der Kristalle der Mineralogischen Staatssammlung mit Diamanten, Smaragden, einer Meteoritensammlung, dem König-Ludwig-Diamant und eben dem Institut für Bayerische Literaturgeschichte, eher ein Meteorit von einem anderen Stern als ein König-Ludwig-Diamant.
Schon rein räumlich gehörte dieses Institut nicht zur Germanistik, auch nicht zu den Geisteswissenschaften, im Grunde nicht einmal zur Universität. Aber das war immer so: Der Standort zuvor war auch recht passend für ein solches Institut das Amerikahaus am Karolinenplatz gewesen. Mir war das Amerikahaus voher nur aus den Zeiten der Studentenbewegung in den Jahren 1968 und folgende bekannt, in denen wir unbedingt der Meinung waren, die Amerikaner müssten den Krieg in Vietnam beenden, und zwar sofort. Zu unserer großen Überraschung hörten die Amerikaner nicht auf uns, aber weil die Moral eindeutig auf unserer Seite lag, folgten Farbbeutel als Argumente, welche gegen das Gebäude flogen und dort eine Art abstraktes Fresko in verschiedenen Farbtönen hinterließen; ich erinnerte mich noch lange an ihre Flugbahnen und das Geräusch ihres Aufplatzens am Gemäuer, aber die Amerikaner ließen sich auch davon nicht beeindrucken. Ich stand jetzt auf der Innenseite der Wand mit den Farbflecken und trank mit dem Direktor des Hauses so manches Bier, meist im Anschluss einer Veranstaltung von Literatur in Bayern. Ich erzählte ihm auch von den Farbbeuteln und ihren Flugbahnen und dem Geräusch ihres Aufplatzens am Gemäuer, und wir lachten. Es waren sehr entspannte Gespräche. Wir einigten uns darauf, dass auch Farbbeutel ein Beitrag zur Fassadengestaltung sein können.
Für die damalige Zeit recht als exotische Erscheinung für ein Institut für Bayerische Literaturgeschichte erschien auch die Sekretärin des Hauses. Nachdem sie zum Islam konvertiert war, trug sie natürlich ein Kopftuch, das war neu im Hause: Die bayerische Literaturgeschichte im Amerikahaus mit einer muslimischen Sekretärin. Inzwischen steht das Amerikahaus am Karolinenplatz leer, Amerika hat kein Geld mehr für ein Haus, das sich auf seinen Namen beruft; auch verbleichen an dem vor sich hin verfallenden Gebäude die Flecken von den Farbbeuteln. Die Geschichte bringt es mit sich, dass Dinge auch wieder verschwinden.
Nach der definitiv endgültigen Schließung des Instituts landete mit einem Male sein gesamtes Inventar auf dem Gehsteig der Theresienstraße, die Bibliothek, das Archiv – und plötzlich steht auch eine rote Bulldogge, 3-D-gewordenes Logo der Zeitschrift Simplicissimus, einst Paradestück der Ausstellung über den Simplicissimus, seinerzeit noch im Amerikahaus, kalbsgroß auf der Theresienstraße. Gott sei Dank habe ich einen VW-Bus, mit dem ich wenigstens einen kleinen Stapel Kulturgutes retten kann, inklusive der roten Bulldogge, und fahre damit nach Hause. Zufällig steht gerade auf dem Königsplatz die Nachbildung des trojanischen Pferdes vor der Antikensammlung. Irgendein Teufel, der mich reitet, gibt mir die Eingebung, anzuhalten und die rote Bulldogge des Simplicissimus dem trojanischen Pferd unterzustellen. Es sieht aus, als bießelte der Hund dem Pferd ans Bein, Simplicissimus und die Literatur in Bayern dem Trojanischen Pferd. „Die Mauern von Troja sind längst verfallen, doch sie stehen in Homers Gedicht“, notiert sich Ernst Jünger in sein Tagebuch Siebzig verweht am 10.2.1974. Bald drei Jahrtausende überdauert diese Geschichte das Vergessen der Menschheit, das ist tröstlich, das macht Mut.
Den Hund habe ich immer noch. Zeitweise habe ich ihn dem Gulbransson-Museum am Tegernsee überlassen, damit ich auch einmal in meinem Leben in einem Museum so ein Schildchen lesen kann: „Das Exponat ist Leihgabe von Gerd Holzheimer“. Etwas in der Richtung hatte ich mir schon als Bub gewünscht. Es ist schon toll, wenn man Herausgeber einer Zeitschrift ist! Dass ich aber Mitglied der Gulbransson-Gesellschaft bin, ist, glaube ich, eher dem Umstand zu verdanken, dass sich mein Äußeres immer rasanter dem des Olaf Gulbransson nähert. Vermutlich möchte mich das Olaf-Gulbransson-Musweum dermaleinst als Mumie aufstellen, mit der Aufschrift „Olaf Gulbransson“, aber das ist nur meine Hypothese, von der die Museumsleitung keine Ahnung hat.
Die drei Jahrzehnte des Bestehens der Zeitschrift kann ich einigermaßen überschauen, weil ich von Dietz-Rüdiger Moser am Anfang als Autor für die Literatur in Bayern eingeladen war. Als seinerzeit noch relativ junger Autor saß ich unter anderem mit Autoren wie Michael Ende oder August Kühn auf der Bühne, zwei Autoren, welche die Spannweite von Mosers Spektrum nicht besser illustrieren könnten. Michael Ende, der eine, damals schon längst ein Autor von Weltformat, seit den Geschichten um Jim Knopf und später mit Momo und der Unendlichen Geschichte regelrecht mit Kultstatus versehen: ein freundlicher bescheidener Mann voller Zuwendung – der andere, August Kühn, Autor einer seinerzeit vielbeachteten Familienchronik mit dem Titel Zeit zum Aufstehn; sie erreichte die stolze Auflage von weltweit zwei Millionen Exemplaren, wurde verfilmt und als „Buddenbrooks der Arbeiter“ bezeichnet. Lüftete Kühn, bekennender Kommunist, sein Trachtenhütl, kam darunter die jüdische Kippa zum Vorschein – alles Literatur in Bayern: ein führender Vertreter der phantastischen Literatur, ein engagierter Vertreter eines sozialkritischen Schreibansatzes im Stil des sozialistischen Realismus – und eine Reihe junger Autoren.
Nach einigen Jahren wollte Dietz-Rüdiger Moser mich auch als Lehrperson in das Institut einbinden, was mich für eine Zeitlang wieder in einen Studenten verwandelte. Ich hatte als akademischen Ausweis nur eine abgebrochene Doktorarbeit in alter Geschichte, also wollten die entsprechenden Scheine nachgeholt werden, parallel zum Verfassen der Promotion. In der mündlichen Prüfung, dem Rigorosum, hat mich Professor Moser derart in die Mangel genommen, wie kein anderer meiner Prüfer, wohl um nicht den leisesten Zweifel aufkommen zu lassen, dass ich vielleicht etwas geschenkt bekäme. Freilich hatte man sich schon im Promotionsbüro bei meiner Anmeldung gewundert: „Aber Sie sa doch a Mo!“ Moser hatte nämlich ausschließlich Doktorandinnen bis dahin gehabt. Ich äußerte den Verdacht, dass er vielleicht einen „native speaker“ an seinem Institut bräuchte, den ich dann ja auch abgab – bis ich wieder hinausflog, weil ihm fast zeitgleich zwei Äußerungen von mir ans Ohr gekommen waren, die zwar entweder nicht von mir oder aber aus der Rubrik „dumm dahergredt“ waren, jedenfalls die sich ein Häuptling nicht so gerne gefallen lassen mag.
Viele Jahre später kam es zu einer ungewollten Wiederbegegnung, eigentlich ein Alptraum, denn wenn man in einem Gebäude einen Lift betritt, ohne vorher zu schauen, wer drin ist, wird man natürlich zum Gefangenen der Situation, da gibt's kein Entrinnen. Spontan tat ich etwas ganz Menschliches. Ich grüßte und fragte: „Wie geht's?“ „Ich habe Krebs!“ sagt er. Und noch spontaner rutscht mir heraus: „Oh, Scheiße!“ Und umarme ihn.
Seitdem gehöre ich wieder dazu, ohne dass wir je über ein Davor oder Danach gesprochen hätten. Allerdings auch nicht über sein Vermächtnis, das er seiner letzten Assistentin und Mitherausgeberin hinterlassen hatte. Ob sie sich vorstellen könne, mit dem Holzheimer zusammen die Zeitschrift weiter herauszugeben. Zu Lebzeiten hätte ich dankend abgewunken: „Lieber Moser, sehr ehrenvoll, aber das ist nicht mein Ding!“ Er hat es mir aber nicht gesagt. Was aber sagt man einem Toten?
Und was macht man, wenn die Mitherausgeberin über ein halbes Jahr lang vom Erdboden verschluckt ist, keine Ausgabe mehr erscheint – und Abonnenten und Inserenten auf die tolle Idee kommen: Da gibt's doch noch einen zweiten! Und rücken diesem Zweiten auf die Pelle.
So wird man Herausgeber. Und springt erst einmal im Quadrat. Fährt in den Gäuboden nach Straubing, um mit dem Chef des Verlagshauses zu sprechen, in dem die Zeitschrift gedruckt wird. Und Spargel zu essen, mitten auf dem Marktplatz in Straubing. Keiner geht grußlos an uns vorüber, der Verleger ist eine absolute Größe. „Ich hab mir grad einen Eishockeyclub gekauft“ erzählt er zwischen zwei Spargelstangerl. Später kommt noch die Münchner Abendzeitung dazu. Gesetzt wurde die Literatur in Bayern allerdings nicht dort, sondern bei mir ums Eck in Gauting, bei einer Firma, die sich den Ideen der Zukunftsstadt Auroville verpflichtet fühlt.
Ich fand das sehr passend: die Literatur in Bayern zwischen Gäuboden und Auroville. Im Jubiläumsjahr kommt nun aber alles unter ein Dach, das des allitera-Verlags in München.
Mit freundlicher Genehmigung des Autors