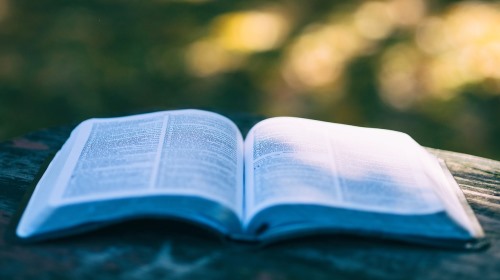Paul Heyses ehemaliges Anwesen soll umgestaltet werden
Die meisten Münchnerinnen und Münchner kennen die nach Paul Heyse benannte Straße oder zumindest ihr von Autoabgasen verpestetes Ende, die Paul-Heyse-Unterführung am Hauptbahnhof, aber nur wenige wissen, wer dieser Mann gewesen ist, oder gar, wo er gewohnt hat, und ebenso wenige werden auch nur eine Zeile von ihm gelesen haben. Dabei war der heute fast nur noch durch Hugo Wolfs Vertonung sowohl des Spanischen als auch des Italienischen Liederbuchs bekannte Heyse ein halbes Jahrhundert lang der berühmteste in München lebende Schriftsteller. Sein ebenso umfangreicher wie gehaltvoller Nachlass zählt zu den bedeutenden Einzelarchiven in der Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, die ihm 1980, zum 150. Geburtstag, eine große Ausstellung gewidmet hat. Dadurch hat Heyses Name, nach Jahrzehnten der Geringschätzung, in der Fachwelt wieder einen gewissen Stellenwert bekommen, und in der Öffentlichkeit wurde immerhin eines deutlich: Wenn man München in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überhaupt als Literaturstadt bezeichnen kann, dann ist das fast ausschließlich diesem einen Autor zu verdanken. Kein Geringerer als sein mit Superlativen sonst sparsamer Freund Theodor Fontane hat 1890 sogar gemeint, Heyse werde seiner „literarischen Epoche sehr wahrscheinlich den Namen geben“.
*
Fontanes Prophezeiung ist zwar nicht in Erfüllung gegangen, eine epochale Erscheinung kann man Heyse aber trotzdem nennen. Schon den Zeitraum seines Wirkens markieren zwei Epochengrenzen: das Revolutionsjahr 1848 und der Beginn des Ersten Weltkriegs 1914. In jedem der dazwischen liegenden Jahre hat er mindestens ein Buch veröffentlicht: neben einer stolzen Reihe von Novellensammlungen, die den eigentlichen Kern seines Werks bilden, mehrere Gedichtbände, Theaterstücke, Versepen und Romane. Zudem war er als Übersetzer (vor allem aus dem Italienischen) und als Editor tätig. Seine Werke fanden beachtlichen Absatz, sie wurden von der Literaturkritik eingehend gewürdigt und erschienen in der Regel in mehreren Auflagen, zum Teil auch in Übersetzungen. Heyse war damit eine zentrale Figur im kulturellen Leben seiner Zeit. Berücksichtigt man seine Aktivitäten in literarischen Zirkeln und Berufsverbänden, seine Freundschaft mit vielen bedeutenden Zeitgenossen, seine weit ausgreifenden gesellschaftlichen Beziehungen und seine Verdienste um die Verbreitung von Werken der Weltliteratur, dann gewinnt selbst das bisweilen eher spöttisch gebrauchte Wort von seiner Goethe-Ähnlichkeit eine gewisse Berechtigung.
Heyse mit Frau in seinem Salon und Heyse in seinem Arbeitszimmer (Foto: Helene Raff/Heyse-Archiv)
Wie Goethe ist auch Heyse vom Fürstenberater zum Dichterfürsten geworden. Nach dem Studium der Altphilologie und der Romanistik und einem längeren Italienaufenthalt hatte ihn 1854 der Ruf Maximilians II. nach München erreicht: Neben Emanuel Geibel und auf dessen Vorschlag hin machte der kulturpolitisch ambitionierte Monarch den kaum 24jährigen Berliner zu seinem literarischen Adlatus. Er stattete ihn mit einem hohen Salär und einer Universitätsprofessur ohne Lehrverpflichtung aus. Heyses einzige Gegenleistung bestand in der Teilnahme an den sogenannten Symposien, wöchentlichen Diskussionsrunden in der Residenz, zu denen der König vorwiegend Intellektuelle nichtbayerischer Herkunft, einlud. Heyse gehörte also zu den von vielen Einheimischen beargwöhnten „Nordlichtern“, erwarb sich aber aufgrund seiner persönlichen Integrität und Liebenswürdigkeit binnen kurzem eine geachtete Stellung innerhalb der Münchner Gesellschaft, in die er durch die Eheschließung mit einer Münchner Bürgerstochter im Jahr 1867 definitiv integriert wurde. Heyses erste Frau, die Tochter seines Berliner Mentors Franz Kugler, war schon 1862 gestorben.
Paul Heyse in jungen Jahren (Foto von Franz Hanfstaengl) und seine zweite Ehefrau (Franz von Lenbach, 1867)
Ungeachtet seiner Loyalität gegenüber dem fürstlichen Mäzen blieb Heyse, wie sein Editor und Biograph Erich Petzet schrieb, „zeitlebens ein treuer Vertreter der Zeit, die zuerst dem deutschen Bürgertum auch politische Mündigkeit und Freiheit zu erkämpfen gesucht hat“. Er zeigte dabei ein hohes Maß an Zivilcourage: Schon 1868 hat er, als Ludwig II. dem alten Geibel wegen eines preußenfreundlichen Gedichts die Staatspension strich, auf die seine freiwillig verzichtet. 1887 ist er, weil man dem von ihm vorgeschlagenen Kandidaten den Maximiliansorden verweigerte, aus dem Ordenskapitel ausgetreten. Kurz darauf verließ er unter Protest das Schillerpreis-Komitee, weil Kaiser Wilhelm II. die Auszeichnung des von diesem gewählten Autors ablehnte. Seine Sympathie für die Frauenbewegung schlug sich unter anderem im Einsatz für die Gründung eines Münchner Mädchengymnasiums nieder. Bei der Förderung junger und der Unterstützung bedürftiger Kollegen scheute er zeitlebens weder Zeit noch Mühe. Und auch im Kampf gegen jedweden Versuch, die Meinungs- und Publikationsfreiheit einzuschränken, war er stets einer der Wortführer unter den Autoren.
Eine wichtige Voraussetzung für Heyses soziales und politisches Engagement war seine finanzielle Unabhängigkeit. Er zählte nämlich nicht nur zu den produktivsten, sondern auch zu den wohlhabendsten Autoren seiner Generation. Neben beträchtlichen Honoraren aus Buchveröffentlichungen und Vorabdrucken in Zeitungen und Zeitschriften bezog er hohe Aufführungstantiemen für einige seiner Bühnenstücke, darunter das oft gespielte Drama Kolberg, das jahrzehntelang zum patriotischen Lektürekanon gehörte. Der Nobelpreis für Literatur, der ihm 1910, zwei Jahre vor Gerhart Hauptmann, als erstem deutschen Autor belletristischer Texte verliehen wurde, machte seine herausragende Stellung unter den Berufskollegen vollends deutlich. Im gleichen Jahr, zum 80. Geburtstag, verlieh ihm die Stadt München die Ehrenbürgerschaft. Mit Heyses Tod im April 1914 endete dann allerdings die Zeit einer nennenswerten Rezeption, zumal sein Stern schon seit dem Aufkommen des literarischen Naturalismus in den 1890er Jahren im Sinken begriffen war. Nach 1933 war eine Heyse-Renaissance schon wegen seiner Einstufung als „Halbjude“ durch die Nationalsozialisten nicht denkbar. „Ihm wurde es erspart“, so Isolde Kurz 1938 in ihren Erinnerungen, „den Zusammenbruch Deutschlands und den Einsturz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft zu sehen, auf deren Wertsetzungen er selbst mit seiner Person und seinen Werken stand. Von seinem Grabe heimkehrend wusste man, dass man dem Begräbnis einer ganzen Ära angewohnt hatte.“
Das frühere Interieur des Hauses: links das Musikzimmer, rechts der Treppenaufgang (Helene Raff/Heyse-Archiv)
Heyses Grab, eines der prächtigsten Denkmäler auf dem Waldfriedhof, und sein Wohnsitz, dem man die einstige Funktion als Residenz eines Dichterfürsten allerdings nicht mehr recht ansieht, sind eindrucksvolle Spuren des zu seiner Zeit so prominenten Bürgers im Münchner Stadtbild. Das Gebäude, in dem der Dichter von 1874 bis zu seinem Tod wohnte, heute Luisenstraße 22, liegt direkt an der einstmals „Propyläenwäldchen“ genannten Parkanlage hinter der Glyptothek. Auf dem Grundstück schräg gegenüber ließ sich sein Freund und Porträtist Franz Lenbach um 1890 ein noch aufwendigeres Wohn- und Atelierhaus bauen, in dem später die Städtische Galerie etabliert wurde. Das von Heyse 1871, auf dem Gipfel seines Erfolgs, erworbene und in seinem Auftrag von Gottfried Neureuther im Stil der Neorenaissance umgestaltete Haus war hingegen schon in den 1830er Jahren als eines der ersten Gebäude auf diesem Areal errichtet worden. Die Gastfreundschaft, die Heyse und seine Frau dort pflegten, machte ihre Wohnung vier Jahrzehnten lang zum Treffpunkt großer Geister aus nah und fern. „Der Vergleich mit Weimar und dem Haus am Frauenplan lag nahe“, schrieb Max Halbe über Heyses Wohnung. „Hier wie dort war es eine Hofhaltung im Kleinen, ein mit Bildern, Büsten, Antiken, Kunstgegenständen und Erinnerungen eines langen Lebens angefülltes Dichterheim. Viele Jahre, weit über ein Menschenalter hindurch, war man in München zu Heyse gepilgert wie vordem nach Weimar zu Goethe.“ Dass der Dichter die wiederholte Einladung des Großherzogs Carl Alexander zur Übersiedlung nach ebendiesem Weimar ausschlug, erklärt sich wohl nicht zuletzt aus der Attraktivität seines Münchner Domizils.
Aufnahme des Anwesens von 1910 (Reclams Universum/Heyse-Archiv)
Die Witwe des Dichters, Anna von Heyse, blieb bis zu ihrem Tod 1930 in der Villa wohnen. Bei Bombenangriffen im Jahr 1944 bis auf die Außenmauern zerstört, wurde das Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg unter Beibehaltung der auch von Neureuther kaum angetasteten biedermeierlichen Dimensionen und Proportionen wiederhergestellt. Trotz der verlorenen historistischen Ausstattung ist es ein auratischer Ort der Münchner Literaturgeschichte geblieben. Abgesehen davon stellt es mit dem vorgelagerten Garten das wohl letzte Zeugnis der ursprünglich als eine Art Gartenstadt, als Ensemble von freistehenden Bauwerken geplanten Maxvorstadt dar, in der sich die Wohnhäuser nach dem Willen Ludwigs I. in ihren Maßen den benachbarten großen Museumsbauten unterzuordnen hatten. Die Heyse- und die Lenbach-Villa bilden dort ein einzigartiges Paar von Künstlerresidenzen und zudem die letzte Reminiszenz an ein hinter den Propyläen gelegenes erstes Münchner Künstlerviertel, wo schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts namhafte Maler und Bildhauer gewohnt haben. Auch die Nachkriegsgestalt des Gebäudes, Musterbeispiel einer für München charakteristischen, auf die historischen Vorgaben Rücksicht nehmende Form von Wiederaufbau, besitzt inzwischen Denkmalwert.
Umso mehr hat die Nachricht, der gegenwärtige Grundstückseigentümer wolle die Villa abreißen und den als ihr Ambiente unentbehrlichen Garten mit einem fünfstöckigen Wohn- und Bürohaus bebauen lassen, die Münchner Kulturszene in Alarm versetzt. Inzwischen sind zahlreiche Protestschreiben von Denkmalexperten und Literaturwissenschaftlern bei verschiedenen Stadt- und Landesbehörden eingegangen und dort durchweg auf positive Resonanz gestoßen. Eine im Mai 2013 gegründete Bürgerinitiative hat inzwischen über 6000 Unterschriften gesammelt und viele Solidaritätsadressen aus dem In- und Ausland empfangen. So scheint die Hoffnung nicht unbegründet, dass städtebauliche und kulturhistorische Rücksichten in diesem Fall über das kommerzielle Interesse eines Privatmanns gestellt werden, und dass es gelingt, die Bedrohung des Denkmalensembles bis zu Heyses 100. Todestag, dem 2. April 2014, endgültig abzuwenden. Dieser Termin böte auch den schönsten Anlass, die Villa durch das vom Stadtrat schon 2008 beschlossene Anbringen einer Gedenktafel als einen bedeutenden Münchner Erinnerungsort zu kennzeichnen.
![]() Online-Petition „Rettet die Paul-Heyse-Villa“
Online-Petition „Rettet die Paul-Heyse-Villa“
Paul Heyses ehemaliges Anwesen soll umgestaltet werden
Die meisten Münchnerinnen und Münchner kennen die nach Paul Heyse benannte Straße oder zumindest ihr von Autoabgasen verpestetes Ende, die Paul-Heyse-Unterführung am Hauptbahnhof, aber nur wenige wissen, wer dieser Mann gewesen ist, oder gar, wo er gewohnt hat, und ebenso wenige werden auch nur eine Zeile von ihm gelesen haben. Dabei war der heute fast nur noch durch Hugo Wolfs Vertonung sowohl des Spanischen als auch des Italienischen Liederbuchs bekannte Heyse ein halbes Jahrhundert lang der berühmteste in München lebende Schriftsteller. Sein ebenso umfangreicher wie gehaltvoller Nachlass zählt zu den bedeutenden Einzelarchiven in der Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, die ihm 1980, zum 150. Geburtstag, eine große Ausstellung gewidmet hat. Dadurch hat Heyses Name, nach Jahrzehnten der Geringschätzung, in der Fachwelt wieder einen gewissen Stellenwert bekommen, und in der Öffentlichkeit wurde immerhin eines deutlich: Wenn man München in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überhaupt als Literaturstadt bezeichnen kann, dann ist das fast ausschließlich diesem einen Autor zu verdanken. Kein Geringerer als sein mit Superlativen sonst sparsamer Freund Theodor Fontane hat 1890 sogar gemeint, Heyse werde seiner „literarischen Epoche sehr wahrscheinlich den Namen geben“.
*
Fontanes Prophezeiung ist zwar nicht in Erfüllung gegangen, eine epochale Erscheinung kann man Heyse aber trotzdem nennen. Schon den Zeitraum seines Wirkens markieren zwei Epochengrenzen: das Revolutionsjahr 1848 und der Beginn des Ersten Weltkriegs 1914. In jedem der dazwischen liegenden Jahre hat er mindestens ein Buch veröffentlicht: neben einer stolzen Reihe von Novellensammlungen, die den eigentlichen Kern seines Werks bilden, mehrere Gedichtbände, Theaterstücke, Versepen und Romane. Zudem war er als Übersetzer (vor allem aus dem Italienischen) und als Editor tätig. Seine Werke fanden beachtlichen Absatz, sie wurden von der Literaturkritik eingehend gewürdigt und erschienen in der Regel in mehreren Auflagen, zum Teil auch in Übersetzungen. Heyse war damit eine zentrale Figur im kulturellen Leben seiner Zeit. Berücksichtigt man seine Aktivitäten in literarischen Zirkeln und Berufsverbänden, seine Freundschaft mit vielen bedeutenden Zeitgenossen, seine weit ausgreifenden gesellschaftlichen Beziehungen und seine Verdienste um die Verbreitung von Werken der Weltliteratur, dann gewinnt selbst das bisweilen eher spöttisch gebrauchte Wort von seiner Goethe-Ähnlichkeit eine gewisse Berechtigung.
Heyse mit Frau in seinem Salon und Heyse in seinem Arbeitszimmer (Foto: Helene Raff/Heyse-Archiv)
Wie Goethe ist auch Heyse vom Fürstenberater zum Dichterfürsten geworden. Nach dem Studium der Altphilologie und der Romanistik und einem längeren Italienaufenthalt hatte ihn 1854 der Ruf Maximilians II. nach München erreicht: Neben Emanuel Geibel und auf dessen Vorschlag hin machte der kulturpolitisch ambitionierte Monarch den kaum 24jährigen Berliner zu seinem literarischen Adlatus. Er stattete ihn mit einem hohen Salär und einer Universitätsprofessur ohne Lehrverpflichtung aus. Heyses einzige Gegenleistung bestand in der Teilnahme an den sogenannten Symposien, wöchentlichen Diskussionsrunden in der Residenz, zu denen der König vorwiegend Intellektuelle nichtbayerischer Herkunft, einlud. Heyse gehörte also zu den von vielen Einheimischen beargwöhnten „Nordlichtern“, erwarb sich aber aufgrund seiner persönlichen Integrität und Liebenswürdigkeit binnen kurzem eine geachtete Stellung innerhalb der Münchner Gesellschaft, in die er durch die Eheschließung mit einer Münchner Bürgerstochter im Jahr 1867 definitiv integriert wurde. Heyses erste Frau, die Tochter seines Berliner Mentors Franz Kugler, war schon 1862 gestorben.
Paul Heyse in jungen Jahren (Foto von Franz Hanfstaengl) und seine zweite Ehefrau (Franz von Lenbach, 1867)
Ungeachtet seiner Loyalität gegenüber dem fürstlichen Mäzen blieb Heyse, wie sein Editor und Biograph Erich Petzet schrieb, „zeitlebens ein treuer Vertreter der Zeit, die zuerst dem deutschen Bürgertum auch politische Mündigkeit und Freiheit zu erkämpfen gesucht hat“. Er zeigte dabei ein hohes Maß an Zivilcourage: Schon 1868 hat er, als Ludwig II. dem alten Geibel wegen eines preußenfreundlichen Gedichts die Staatspension strich, auf die seine freiwillig verzichtet. 1887 ist er, weil man dem von ihm vorgeschlagenen Kandidaten den Maximiliansorden verweigerte, aus dem Ordenskapitel ausgetreten. Kurz darauf verließ er unter Protest das Schillerpreis-Komitee, weil Kaiser Wilhelm II. die Auszeichnung des von diesem gewählten Autors ablehnte. Seine Sympathie für die Frauenbewegung schlug sich unter anderem im Einsatz für die Gründung eines Münchner Mädchengymnasiums nieder. Bei der Förderung junger und der Unterstützung bedürftiger Kollegen scheute er zeitlebens weder Zeit noch Mühe. Und auch im Kampf gegen jedweden Versuch, die Meinungs- und Publikationsfreiheit einzuschränken, war er stets einer der Wortführer unter den Autoren.
Eine wichtige Voraussetzung für Heyses soziales und politisches Engagement war seine finanzielle Unabhängigkeit. Er zählte nämlich nicht nur zu den produktivsten, sondern auch zu den wohlhabendsten Autoren seiner Generation. Neben beträchtlichen Honoraren aus Buchveröffentlichungen und Vorabdrucken in Zeitungen und Zeitschriften bezog er hohe Aufführungstantiemen für einige seiner Bühnenstücke, darunter das oft gespielte Drama Kolberg, das jahrzehntelang zum patriotischen Lektürekanon gehörte. Der Nobelpreis für Literatur, der ihm 1910, zwei Jahre vor Gerhart Hauptmann, als erstem deutschen Autor belletristischer Texte verliehen wurde, machte seine herausragende Stellung unter den Berufskollegen vollends deutlich. Im gleichen Jahr, zum 80. Geburtstag, verlieh ihm die Stadt München die Ehrenbürgerschaft. Mit Heyses Tod im April 1914 endete dann allerdings die Zeit einer nennenswerten Rezeption, zumal sein Stern schon seit dem Aufkommen des literarischen Naturalismus in den 1890er Jahren im Sinken begriffen war. Nach 1933 war eine Heyse-Renaissance schon wegen seiner Einstufung als „Halbjude“ durch die Nationalsozialisten nicht denkbar. „Ihm wurde es erspart“, so Isolde Kurz 1938 in ihren Erinnerungen, „den Zusammenbruch Deutschlands und den Einsturz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft zu sehen, auf deren Wertsetzungen er selbst mit seiner Person und seinen Werken stand. Von seinem Grabe heimkehrend wusste man, dass man dem Begräbnis einer ganzen Ära angewohnt hatte.“
Das frühere Interieur des Hauses: links das Musikzimmer, rechts der Treppenaufgang (Helene Raff/Heyse-Archiv)
Heyses Grab, eines der prächtigsten Denkmäler auf dem Waldfriedhof, und sein Wohnsitz, dem man die einstige Funktion als Residenz eines Dichterfürsten allerdings nicht mehr recht ansieht, sind eindrucksvolle Spuren des zu seiner Zeit so prominenten Bürgers im Münchner Stadtbild. Das Gebäude, in dem der Dichter von 1874 bis zu seinem Tod wohnte, heute Luisenstraße 22, liegt direkt an der einstmals „Propyläenwäldchen“ genannten Parkanlage hinter der Glyptothek. Auf dem Grundstück schräg gegenüber ließ sich sein Freund und Porträtist Franz Lenbach um 1890 ein noch aufwendigeres Wohn- und Atelierhaus bauen, in dem später die Städtische Galerie etabliert wurde. Das von Heyse 1871, auf dem Gipfel seines Erfolgs, erworbene und in seinem Auftrag von Gottfried Neureuther im Stil der Neorenaissance umgestaltete Haus war hingegen schon in den 1830er Jahren als eines der ersten Gebäude auf diesem Areal errichtet worden. Die Gastfreundschaft, die Heyse und seine Frau dort pflegten, machte ihre Wohnung vier Jahrzehnten lang zum Treffpunkt großer Geister aus nah und fern. „Der Vergleich mit Weimar und dem Haus am Frauenplan lag nahe“, schrieb Max Halbe über Heyses Wohnung. „Hier wie dort war es eine Hofhaltung im Kleinen, ein mit Bildern, Büsten, Antiken, Kunstgegenständen und Erinnerungen eines langen Lebens angefülltes Dichterheim. Viele Jahre, weit über ein Menschenalter hindurch, war man in München zu Heyse gepilgert wie vordem nach Weimar zu Goethe.“ Dass der Dichter die wiederholte Einladung des Großherzogs Carl Alexander zur Übersiedlung nach ebendiesem Weimar ausschlug, erklärt sich wohl nicht zuletzt aus der Attraktivität seines Münchner Domizils.
Aufnahme des Anwesens von 1910 (Reclams Universum/Heyse-Archiv)
Die Witwe des Dichters, Anna von Heyse, blieb bis zu ihrem Tod 1930 in der Villa wohnen. Bei Bombenangriffen im Jahr 1944 bis auf die Außenmauern zerstört, wurde das Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg unter Beibehaltung der auch von Neureuther kaum angetasteten biedermeierlichen Dimensionen und Proportionen wiederhergestellt. Trotz der verlorenen historistischen Ausstattung ist es ein auratischer Ort der Münchner Literaturgeschichte geblieben. Abgesehen davon stellt es mit dem vorgelagerten Garten das wohl letzte Zeugnis der ursprünglich als eine Art Gartenstadt, als Ensemble von freistehenden Bauwerken geplanten Maxvorstadt dar, in der sich die Wohnhäuser nach dem Willen Ludwigs I. in ihren Maßen den benachbarten großen Museumsbauten unterzuordnen hatten. Die Heyse- und die Lenbach-Villa bilden dort ein einzigartiges Paar von Künstlerresidenzen und zudem die letzte Reminiszenz an ein hinter den Propyläen gelegenes erstes Münchner Künstlerviertel, wo schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts namhafte Maler und Bildhauer gewohnt haben. Auch die Nachkriegsgestalt des Gebäudes, Musterbeispiel einer für München charakteristischen, auf die historischen Vorgaben Rücksicht nehmende Form von Wiederaufbau, besitzt inzwischen Denkmalwert.
Umso mehr hat die Nachricht, der gegenwärtige Grundstückseigentümer wolle die Villa abreißen und den als ihr Ambiente unentbehrlichen Garten mit einem fünfstöckigen Wohn- und Bürohaus bebauen lassen, die Münchner Kulturszene in Alarm versetzt. Inzwischen sind zahlreiche Protestschreiben von Denkmalexperten und Literaturwissenschaftlern bei verschiedenen Stadt- und Landesbehörden eingegangen und dort durchweg auf positive Resonanz gestoßen. Eine im Mai 2013 gegründete Bürgerinitiative hat inzwischen über 6000 Unterschriften gesammelt und viele Solidaritätsadressen aus dem In- und Ausland empfangen. So scheint die Hoffnung nicht unbegründet, dass städtebauliche und kulturhistorische Rücksichten in diesem Fall über das kommerzielle Interesse eines Privatmanns gestellt werden, und dass es gelingt, die Bedrohung des Denkmalensembles bis zu Heyses 100. Todestag, dem 2. April 2014, endgültig abzuwenden. Dieser Termin böte auch den schönsten Anlass, die Villa durch das vom Stadtrat schon 2008 beschlossene Anbringen einer Gedenktafel als einen bedeutenden Münchner Erinnerungsort zu kennzeichnen.