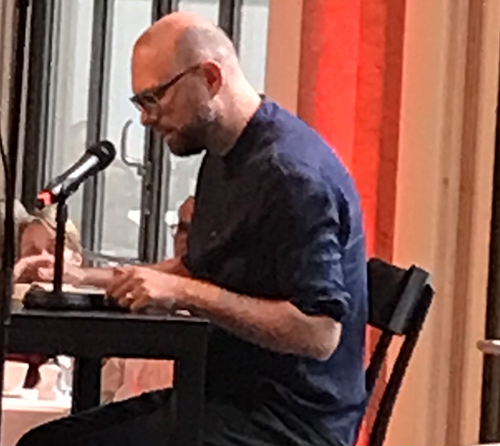Krümmungen. Ein Essay, vorgetragen zum 130. Geburtstag von Oskar Maria Graf
Happy birthday, Oskar Maria!
Anlässlich des 130. Geburtstages von Oskar Maria Graf, einem der bedeutendsten bayerischen Autoren, der 1933 ins Exil nach New York ging, hat die Oskar Maria Graf Gesellschaft jüngst eine Tagung zu den Frauenbildern in seinen Werken durchgeführt. Im Rahmen der damit verbundenen Abendveranstaltung Über Mütter lasen die Autorin Andrea Heuser und der Schriftsteller Markus Ostermair im Literaturhaus München ihre literarischen Texte vor. Texte, die sich im Kontext mit Oskar Maria Grafs berühmtem autobiographischen Roman Das Leben meiner Mutter und dem darin verhandelten Frauen- und Mutterbild lesen lassen.
Die Sprecherin und Performerin ![]() Ruth Geiersberger brachte ausgewählte Passagen aus Das Leben meiner Mutter eindringlich-sinnlich zu Gehör. Zur stimmungsvollen Rahmung der feierlichen Veranstaltung, die vor ausverkauftem Hause stattfand, trug zudem die Musik des Duos
Ruth Geiersberger brachte ausgewählte Passagen aus Das Leben meiner Mutter eindringlich-sinnlich zu Gehör. Zur stimmungsvollen Rahmung der feierlichen Veranstaltung, die vor ausverkauftem Hause stattfand, trug zudem die Musik des Duos ![]() Maxi Pongratz bei. Das Literaturportal stellt die beiden Texte von Markus Ostermair und Andrea Heuser hier im feierlichen Gedenken an Oskar Maria Graf vor. Der folgende Essay stammt von Markus Ostermair. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des
Maxi Pongratz bei. Das Literaturportal stellt die beiden Texte von Markus Ostermair und Andrea Heuser hier im feierlichen Gedenken an Oskar Maria Graf vor. Der folgende Essay stammt von Markus Ostermair. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des ![]() Elif Verlags.
Elif Verlags.
*
Du musst dich schon bücken! Da hilft alles nichts! Wenn das Unkraut zu nah an der Rübe stand, dann war die Hacke, auch die für Kinder mit dem dünneren, kürzeren Stiel und dem kleineren Blatt, zu grob. Zu groß die Gefahr, die Frucht zu verletzen, auf die es ankam. Rüben wurden gesät, Rüben wollte man ernten, und zwar große und fette, sodass auch die Erwachsenen zwei Hände brauchen würden, um sie im Herbst, wenn einem die Finger von der kalten Erde beinahe abfroren, auf den Wagen und von dort aus in den Rübenkeller zu werfen. Bis es so weit war, ging es um Verteilungsfragen: Regen, Sonne, Nährstoffe. Und weil das Unkraut nicht einfach nur wächst, sondern wuchert und dabei alles zieht, was es kriegen kann, musste man es mit Stumpf und Stiel aushacken.
Also rückwärtsgehen, halbgebückt, und schnelle Hackbewegungen in der Mitte, um seine Wurzeln freizulegen, auf dass sie an der Sonne verdorrten. Daher auch das Rückwärtsgehen, sonst würde man es erst raushacken und dann wieder in den Ackerboden hineintreten. Das wäre Unsinn. Da hätte man ja gleich zu Hause bleiben können. Und wäre man zu Hause geblieben, dann wären die Mühen des Säens umsonst gewesen. Aber ich schweife ab und gehe nicht die gerade Reihe rückwärts. Ich nehme einen Umweg, trödle, könnte man sagen. Es ist ein altes Muster. Wenn es ans „Rübengrasen“ ging, fuhren alle zusammen raus aufs Feld – das heißt die, die noch lebten, und die, die keine anderweitigen Verpflichtungen hatten – und standen zwischen den Rübenreihen unter der Sonne und grasten, was mit der Hacke zu grasen war. Und den Rest, den zupfte man eben heraus.
Und dafür musst du tiefer runter! Dein Rücken ist ja noch jung, deine Beine noch kurz, so weit bis zum Boden hast du’s also gar nicht, jetzt stell dich nicht so an. Ich freilich stellte mich immer an. Das war die Erzählung bei uns daheim auf dem Hof, weil ich ein Jammerkind war. Der kleinste, da jüngste von sechs. Mit Ausnahme meines nächst älteren Bruders – uns trennten fünf Jahre – waren meine drei Schwestern und mein zweiter Bruder in meiner Erinnerung immer schon erwachsen oder auf dem Sprung dahin, in jedem Fall keine Spielkameraden mehr. Sie hatten bereits andere Sorgen als zu spielen. Insgesamt hatte unsere Familie andere Sorgen.
Oben lag der weltkriegsversehrte Opa im Bett und wurde von der Oma gepflegt. In meiner Erinnerung ist er bleich und grau wie das Laken, und der Geruch von feucht gewordenem Schnupftabak umgibt ihn. Ihn, den ich nur einmal habe gehen sehen, gebückt, am Stock, als er – ich glaube, mich an die Worte „Ostfront“, „Sturz aus dem Zug aufs Gleis“, „Maschinengewehrwunden im Oberschenkel“ und „halbseitige Lähmung" erinnern zu können – ein Bein nachzog, während er den anderen Fuß im Filzpantoffel vorwärtsschob. Das kurze, leise Pfeifen des schwarzen Gummis am unteren Ende des Gehstocks und das wetzende Geräusch seiner Sohlen auf dem Boden meine ich noch im Ohr zu haben, aber vielleicht fabuliere ich mir das alles auch nur zusammen, weil es zu den wenigen, aufs Unangenehmste wabernden Bildern in meinem Kopf passt.
Es wurde nicht viel erzählt und ich fragte nicht nach. Anderes aber war und ist unumstößlich. Auf dem Friedhof lag der Vater, quasi seit dem Tag, an dem meine Mutter mich zur Grundschule angemeldet hatte und er allein raus ist aufs Feld, und dann kam und kam er nicht heim und die Mutter hatte sich während des Melkens Sorgen gemacht, wo er denn bleibt. Er, der wie alle in der Familie mit dem Körper arbeitete, die Knie, das Kreuz, die Arme und Hände, hatte die Symptome nicht erkannt. Ja, mei, dann zieht’s halt mal komisch von der Schulter in den Oberarm rein, das kann alles bedeuten, das wär nicht das erste Mal. Vielleicht hab ich mich verlegen oder irgendwo gestoßen, ich weiß es nicht mehr. Zum Doktor wird erst gegangen, wenn die Arbeit getan ist. Im Stall standen die Kühe, neun hie’enten, neun herenten, und in der Mitte der Futtertisch, auf dem das frische Gras mit dem Greifer und den Gabeln verteilt wurde, oder im Winter das Heu und die Rüben, die man dann nicht mehr so zimperlich anpackte.
Ich fuhr die Rampe hoch mit einem Schubkarren, der so mit ihnen überladen war, dass es in den kindlichen Unterarmen brannte. Die erste Erleichterung brachten dann die Sprunggelenke, denn in den Armen allein fehlte die Kraft, um den Karren zu heben. Das Stehen auf den Zehenspitzen reichte schon, dass die ersten Rüben purzelten. Und die Zungen der Kühe reckten sich nicht mehr nach den Händen an den Griffen oder den Gummistiefeln, über die sie wie nasses Sandpapier strichen, sondern nach den zuckrigen Wurzeln. Wieder ging man rückwärts, der Karren wurde leichter und leichter, das Brennen in den Armen verstetigte sich. Man würde sie ausschütteln können, wenn er leer war, bevor man den Spaten holte. Mit ihm rollte man die kopfgroßen Früchte wieder in die Mitte zurück, wo die Kuhzungen nicht hinreichten, sodass man gefahrlos – für die Zungen zumindest – zustoßen, die Rüben zerteilen und ihnen die Stücke wieder hinschieben konnte. Die Füße hielt man – das Risiko, mit dem Spaten abzurutschen, bestand immer – durch einen breiten Stand aus der Gefahrenzone heraus, während man das Metallblatt Richtung Steinboden, Richtung Rübe trieb.
Doch so weit waren wir noch nicht. Wir waren beim Jäten und Jammern auf dem Feld, beim Bücken, Hacken und Zupfen. Der große Kreislauf der Jahreszeiten muss widernatürlich zurückgedreht werden, die Hackfrüchte sind noch faustgroß in meiner Vorstellung. Es würde noch unzählige Sonnenstunden gemischt mit der, so war zu hoffen, immer wiederkehrenden Nässe des Regens und der Feuchte des Morgentaus brauchen, bis man sie mit dem Roder aus dem Boden ziehen und mit kalten Händen auf den Ladewagen werfen konnte. Gemach, gemach also! Man konnte nicht einfach so vorpreschen, schließlich brauchte man auch auf dem Feld Geduld, denn man blieb so lange draußen, bis die Arbeit getan war. Schritt um Schritt, Reihe um Reihe. Also, nicht trödeln. Wer trödelte, zwang die anderen zur Mehrarbeit. Und jeder in unserer Schicksalsgemeinschaft sah, dass ich die kürzesten Reihen hatte und trotzdem ging und ging es nicht richtig vorwärts bei mir, meinten die anderen.
Und ich meinte, ich tue, so schnell ich kann, und müsste eigentlich ganz woanders sein, beim Fußballspielen mit meinen Freunden vielleicht, deren Pläne ich im Schulbus belauscht hatte, da sie mich oft gar nicht mehr fragten, weil man mit mir bei schönem Wetter ohnehin nicht richtig rechnen konnte. Und auch meine Geschwister meinten, sie müssten woanders sein, stelle ich mir heute vor, da mir im Rückblick die Jahre verschwimmen, wo man noch Kind war und wo man der Kindheit schon entwuchs, viele lange Jahre lang. Ich weiß nur vom Drängen, das ich spürte, und wie es zunahm mit der Zeit, und ich nehme an, auch sie spürten es, während ich jammerte und trödelte und mich anstellte als hilflose Form des Protests. Denn es half ja nichts. Wir alle wussten, dass die Arbeit getan werden musste, allein schon unserer Mutter zuliebe, der all meine Gnangserei galt und die der anderen wahrscheinlich auch.
Also gingen wir rückwärts, hackten und bückten uns und bekamen an den Armen und im Nacken Farbe. Und auch bei anderen Arbeiten jammerte ich, beim Grasholen und Heupressen, beim Silieren und der Stallarbeit. Es war die Fremdbestimmtheit meiner Zeit über die Schule hinaus, die mir keine Ruhe ließ.
Daher der Wunsch nach einer Uhr zur Erstkommunion. Es war ein Werkzeug, womit sich mir ein zweites Feld des Jammerns eröffnete. Bei jeder unvorhersehbaren Arbeit – der Zeitpunkt für das Grasen der Rüben war für mich nie zu entschlüsseln gewesen und traf mich jedes Mal unvorbereitet – nagelte ich meine Mutter auf eine Zeit fest, wie lang es denn dauern und wann ich also wieder frei sein würde. Mit den Jahren reichte schließlich die Schwere der Arbeit allein nicht mehr aus, nicht für den Jüngsten, dem die Gnade der spätesten Geburt immer deutlicher vor Augen trat, da das Los der Verantwortung des Hoferben auf meinen nächst älteren Bruder fiel. Ich wurde nicht angelernt, sondern für mich blieben die Hilfsdienste übrig, das Zuarbeiten, worauf es im Notfall nicht ankam. Wo sein Gejammer auf felsigen Grund fiel, ging es bei mir hin und wieder auf. Ich konnte Termine vorschieben, Hausaufgaben, Prüfungen, Freunde, mit denen ich vor Wochen schon was ausgemacht hatte. Irgendetwas, was den Druck erhöhte, den Leidensdruck erklärte und damit das Jammern.
Wenn meine Mutter mal nachgab, meinem Gejammer und ihrem schlechten Gewissen vielleicht, und ich früher erlöst war, dann gnangsten die anderen, dass es ungerecht und ich ohnehin immer schon bevorzugt worden sei, und sie hatten recht damit. Also stellte meine Mutter mir sogleich eine weitere Arbeit in Aussicht, die ich die nächsten Tage zusätzlich zu erledigen hatte. Eine Art ausgleichende Gerechtigkeit, die jedoch – das wussten wir beide und die anderen wohl auch – oft weniger schlimm war und ab und zu sogar ganz entfiel, denn sie hatte andere Sorgen, als sich ständig zu merken, was sie mir alles aufgetragen hatte. Wenn Arbeit anstand, dann tat sie sie einfach, komme, was wolle. Dem steht gegenüber: mein Jammern und Betteln und Flehen, und meine Fluchten vom Hof zu Freunden, wo sich nach und nach auch bei mir das schlechte Gewissen Bahn brach. Das war der Zwickmühlenhandel: Freizeit gegen das Nagen der Schuld.
Die Arbeit, sie tat sich nie von allein, das wusste ich. Die Arbeit, sie war allumfassend, das ahnte ich. Es war ein sprachloses Eingeweidewissen vom großen Kreislauf der Jahreszeiten und von der langen Kette der Menschenmägen, an der alles hing, die alles antrieb: das Säen und Hacken und Zupfen und Spritzen und Ackern und Mähen, das Füttern und Melken und Striegeln und Schlachten und Düngen und Ernten und überhaupt. Und ich saß in den Zimmern meiner Freunde, die sämtlich in Häusern ohne Schmutzkammer lagen, in der wir das Stallgewand, die groben, löchrigen Socken, die von Erde schweren Stiefel abstreiften, während wir uns am kammerhohen Schuhregal festhielten, in dem sich alle ausrangierten Schuhe der Familie stapelten, die womöglich noch ein letztes Mal für irgendeine Arbeit herhalten mochten, und ich begriff jedes Mal aufs Neue, dass die allumfassende Arbeit unsere Arbeit war und nicht ihre.
Und ich beneidete meine Freunde und deren Eltern darum und schämte mich für unsere Arbeit, die einer Schmutzkammer bedurfte, ohne es je auszusprechen. Ich durfte mir in der Fremde die Fluchten vom Hof nicht verscherzen, ich durfte und wollte ihnen nichts von der Arbeit erzählen. Überhaupt durfte und wollte und konnte ich nichts von der Arbeit erzählen, die mich niederdrückte und von der ich doch so viel gelernt habe, ja alles eigentlich. In der Anschauung meiner Mutter lernte ich, nicht mehr zu jammern und nichts mehr zu wollen, sodass ich die Scham, manchmal zumindest – und eigentlich nur der Form halber, wie ich zugestehen muss –, überwinden kann, heutzutage.
Ihr Bild, als sie aus dem Stall wankte, nachdem ich einmal zu spät zum Helfen gekommen war, und sie beim hastigen Anziehen des Stallgewandes von der Schmutzkammer aus beobachtete, wie sie sich dreimal, in gelben Schwallen, erbrach, lehrte mich das. Sie hatte nach Frischluft gesucht und dann mit Ellenbogen und Schulter das große Tor aufgeschoben, das immer nur eine Handbreit für die Katzen offenstand, damit man meine Mutter von der Straße aus nicht sehen konnte. Dann krümmte es sie nach vorne und der erste Schwall ergoss sich aus ihrem Mund auf den Raps, den mein Bruder zuvor für die Kühe geholt hatte. Sie atmete schwer, aber sank nicht auf die Knie, während ich wie erstarrt hinter dem Schmutzkammerfenster stehen blieb. Es kamen der zweite und kurz darauf der dritte Schwall, nach dem sie sich aufrichtete und mit dem Handrücken über die Lippen fuhr.
Ich schlüpfte in die Galoschen und stürzte zur Tür hinaus, um ihr zu helfen, wobei ich erwartet hatte, sie würde sich auf den Heuballen gesetzt haben, der immer an der Stallwand lag, doch ich sah sie zunächst nicht mehr. Einige Sekunden später kam sie mit einer Heugabel wieder aus der Stalltür hervor, hob ihr Erbrochenes damit auf und warf es in die Mistrinne hinter die Kühe, bevor sie sich wieder zwischen sie stellte und sich zu ihren Eutern hinabbeugte. Als sie mich sah, schimpfte sie nicht über mein Zuspätkommen, sondern dankte mir, dass ich ihr heute, da es ihr nicht so gut gehe, helfe.
**
Markus Ostermair wurde 1981 in eine Bauernfamilie geboren, die aus Tegernbach bei Pfaffenhofen a. d. Ilm stammt. Nach dem frühen Tod des Vaters gab die Familie den Hopfenanbau auf, behielt aber die Milchvieh- und Landwirtschaft bei. Das Gymnasium brach er mit Mittlerer Reife ab, um eine kaufmännische Ausbildung in einem Autohaus zu absolvieren. Es folgte der Zivildienst in der Bahnhofsmission München, wo er zum ersten Mal mit dem Thema Obdachlosigkeit in Berührung kam. Er holte das Abitur nach und studierte in München Deutsch und Englisch auf Lehramt. Sein mehrfach ausgezeichnetes Romandebüt Der Sandler erschien 2020 im Osburg Verlag und schildert in sechs Tagen und Nächten ein Panorama der Straßenobdachlosigkeit.
Krümmungen. Ein Essay, vorgetragen zum 130. Geburtstag von Oskar Maria Graf
Happy birthday, Oskar Maria!
Anlässlich des 130. Geburtstages von Oskar Maria Graf, einem der bedeutendsten bayerischen Autoren, der 1933 ins Exil nach New York ging, hat die Oskar Maria Graf Gesellschaft jüngst eine Tagung zu den Frauenbildern in seinen Werken durchgeführt. Im Rahmen der damit verbundenen Abendveranstaltung Über Mütter lasen die Autorin Andrea Heuser und der Schriftsteller Markus Ostermair im Literaturhaus München ihre literarischen Texte vor. Texte, die sich im Kontext mit Oskar Maria Grafs berühmtem autobiographischen Roman Das Leben meiner Mutter und dem darin verhandelten Frauen- und Mutterbild lesen lassen.
Die Sprecherin und Performerin ![]() Ruth Geiersberger brachte ausgewählte Passagen aus Das Leben meiner Mutter eindringlich-sinnlich zu Gehör. Zur stimmungsvollen Rahmung der feierlichen Veranstaltung, die vor ausverkauftem Hause stattfand, trug zudem die Musik des Duos
Ruth Geiersberger brachte ausgewählte Passagen aus Das Leben meiner Mutter eindringlich-sinnlich zu Gehör. Zur stimmungsvollen Rahmung der feierlichen Veranstaltung, die vor ausverkauftem Hause stattfand, trug zudem die Musik des Duos ![]() Maxi Pongratz bei. Das Literaturportal stellt die beiden Texte von Markus Ostermair und Andrea Heuser hier im feierlichen Gedenken an Oskar Maria Graf vor. Der folgende Essay stammt von Markus Ostermair. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des
Maxi Pongratz bei. Das Literaturportal stellt die beiden Texte von Markus Ostermair und Andrea Heuser hier im feierlichen Gedenken an Oskar Maria Graf vor. Der folgende Essay stammt von Markus Ostermair. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des ![]() Elif Verlags.
Elif Verlags.
*
Du musst dich schon bücken! Da hilft alles nichts! Wenn das Unkraut zu nah an der Rübe stand, dann war die Hacke, auch die für Kinder mit dem dünneren, kürzeren Stiel und dem kleineren Blatt, zu grob. Zu groß die Gefahr, die Frucht zu verletzen, auf die es ankam. Rüben wurden gesät, Rüben wollte man ernten, und zwar große und fette, sodass auch die Erwachsenen zwei Hände brauchen würden, um sie im Herbst, wenn einem die Finger von der kalten Erde beinahe abfroren, auf den Wagen und von dort aus in den Rübenkeller zu werfen. Bis es so weit war, ging es um Verteilungsfragen: Regen, Sonne, Nährstoffe. Und weil das Unkraut nicht einfach nur wächst, sondern wuchert und dabei alles zieht, was es kriegen kann, musste man es mit Stumpf und Stiel aushacken.
Also rückwärtsgehen, halbgebückt, und schnelle Hackbewegungen in der Mitte, um seine Wurzeln freizulegen, auf dass sie an der Sonne verdorrten. Daher auch das Rückwärtsgehen, sonst würde man es erst raushacken und dann wieder in den Ackerboden hineintreten. Das wäre Unsinn. Da hätte man ja gleich zu Hause bleiben können. Und wäre man zu Hause geblieben, dann wären die Mühen des Säens umsonst gewesen. Aber ich schweife ab und gehe nicht die gerade Reihe rückwärts. Ich nehme einen Umweg, trödle, könnte man sagen. Es ist ein altes Muster. Wenn es ans „Rübengrasen“ ging, fuhren alle zusammen raus aufs Feld – das heißt die, die noch lebten, und die, die keine anderweitigen Verpflichtungen hatten – und standen zwischen den Rübenreihen unter der Sonne und grasten, was mit der Hacke zu grasen war. Und den Rest, den zupfte man eben heraus.
Und dafür musst du tiefer runter! Dein Rücken ist ja noch jung, deine Beine noch kurz, so weit bis zum Boden hast du’s also gar nicht, jetzt stell dich nicht so an. Ich freilich stellte mich immer an. Das war die Erzählung bei uns daheim auf dem Hof, weil ich ein Jammerkind war. Der kleinste, da jüngste von sechs. Mit Ausnahme meines nächst älteren Bruders – uns trennten fünf Jahre – waren meine drei Schwestern und mein zweiter Bruder in meiner Erinnerung immer schon erwachsen oder auf dem Sprung dahin, in jedem Fall keine Spielkameraden mehr. Sie hatten bereits andere Sorgen als zu spielen. Insgesamt hatte unsere Familie andere Sorgen.
Oben lag der weltkriegsversehrte Opa im Bett und wurde von der Oma gepflegt. In meiner Erinnerung ist er bleich und grau wie das Laken, und der Geruch von feucht gewordenem Schnupftabak umgibt ihn. Ihn, den ich nur einmal habe gehen sehen, gebückt, am Stock, als er – ich glaube, mich an die Worte „Ostfront“, „Sturz aus dem Zug aufs Gleis“, „Maschinengewehrwunden im Oberschenkel“ und „halbseitige Lähmung" erinnern zu können – ein Bein nachzog, während er den anderen Fuß im Filzpantoffel vorwärtsschob. Das kurze, leise Pfeifen des schwarzen Gummis am unteren Ende des Gehstocks und das wetzende Geräusch seiner Sohlen auf dem Boden meine ich noch im Ohr zu haben, aber vielleicht fabuliere ich mir das alles auch nur zusammen, weil es zu den wenigen, aufs Unangenehmste wabernden Bildern in meinem Kopf passt.
Es wurde nicht viel erzählt und ich fragte nicht nach. Anderes aber war und ist unumstößlich. Auf dem Friedhof lag der Vater, quasi seit dem Tag, an dem meine Mutter mich zur Grundschule angemeldet hatte und er allein raus ist aufs Feld, und dann kam und kam er nicht heim und die Mutter hatte sich während des Melkens Sorgen gemacht, wo er denn bleibt. Er, der wie alle in der Familie mit dem Körper arbeitete, die Knie, das Kreuz, die Arme und Hände, hatte die Symptome nicht erkannt. Ja, mei, dann zieht’s halt mal komisch von der Schulter in den Oberarm rein, das kann alles bedeuten, das wär nicht das erste Mal. Vielleicht hab ich mich verlegen oder irgendwo gestoßen, ich weiß es nicht mehr. Zum Doktor wird erst gegangen, wenn die Arbeit getan ist. Im Stall standen die Kühe, neun hie’enten, neun herenten, und in der Mitte der Futtertisch, auf dem das frische Gras mit dem Greifer und den Gabeln verteilt wurde, oder im Winter das Heu und die Rüben, die man dann nicht mehr so zimperlich anpackte.
Ich fuhr die Rampe hoch mit einem Schubkarren, der so mit ihnen überladen war, dass es in den kindlichen Unterarmen brannte. Die erste Erleichterung brachten dann die Sprunggelenke, denn in den Armen allein fehlte die Kraft, um den Karren zu heben. Das Stehen auf den Zehenspitzen reichte schon, dass die ersten Rüben purzelten. Und die Zungen der Kühe reckten sich nicht mehr nach den Händen an den Griffen oder den Gummistiefeln, über die sie wie nasses Sandpapier strichen, sondern nach den zuckrigen Wurzeln. Wieder ging man rückwärts, der Karren wurde leichter und leichter, das Brennen in den Armen verstetigte sich. Man würde sie ausschütteln können, wenn er leer war, bevor man den Spaten holte. Mit ihm rollte man die kopfgroßen Früchte wieder in die Mitte zurück, wo die Kuhzungen nicht hinreichten, sodass man gefahrlos – für die Zungen zumindest – zustoßen, die Rüben zerteilen und ihnen die Stücke wieder hinschieben konnte. Die Füße hielt man – das Risiko, mit dem Spaten abzurutschen, bestand immer – durch einen breiten Stand aus der Gefahrenzone heraus, während man das Metallblatt Richtung Steinboden, Richtung Rübe trieb.
Doch so weit waren wir noch nicht. Wir waren beim Jäten und Jammern auf dem Feld, beim Bücken, Hacken und Zupfen. Der große Kreislauf der Jahreszeiten muss widernatürlich zurückgedreht werden, die Hackfrüchte sind noch faustgroß in meiner Vorstellung. Es würde noch unzählige Sonnenstunden gemischt mit der, so war zu hoffen, immer wiederkehrenden Nässe des Regens und der Feuchte des Morgentaus brauchen, bis man sie mit dem Roder aus dem Boden ziehen und mit kalten Händen auf den Ladewagen werfen konnte. Gemach, gemach also! Man konnte nicht einfach so vorpreschen, schließlich brauchte man auch auf dem Feld Geduld, denn man blieb so lange draußen, bis die Arbeit getan war. Schritt um Schritt, Reihe um Reihe. Also, nicht trödeln. Wer trödelte, zwang die anderen zur Mehrarbeit. Und jeder in unserer Schicksalsgemeinschaft sah, dass ich die kürzesten Reihen hatte und trotzdem ging und ging es nicht richtig vorwärts bei mir, meinten die anderen.
Und ich meinte, ich tue, so schnell ich kann, und müsste eigentlich ganz woanders sein, beim Fußballspielen mit meinen Freunden vielleicht, deren Pläne ich im Schulbus belauscht hatte, da sie mich oft gar nicht mehr fragten, weil man mit mir bei schönem Wetter ohnehin nicht richtig rechnen konnte. Und auch meine Geschwister meinten, sie müssten woanders sein, stelle ich mir heute vor, da mir im Rückblick die Jahre verschwimmen, wo man noch Kind war und wo man der Kindheit schon entwuchs, viele lange Jahre lang. Ich weiß nur vom Drängen, das ich spürte, und wie es zunahm mit der Zeit, und ich nehme an, auch sie spürten es, während ich jammerte und trödelte und mich anstellte als hilflose Form des Protests. Denn es half ja nichts. Wir alle wussten, dass die Arbeit getan werden musste, allein schon unserer Mutter zuliebe, der all meine Gnangserei galt und die der anderen wahrscheinlich auch.
Also gingen wir rückwärts, hackten und bückten uns und bekamen an den Armen und im Nacken Farbe. Und auch bei anderen Arbeiten jammerte ich, beim Grasholen und Heupressen, beim Silieren und der Stallarbeit. Es war die Fremdbestimmtheit meiner Zeit über die Schule hinaus, die mir keine Ruhe ließ.
Daher der Wunsch nach einer Uhr zur Erstkommunion. Es war ein Werkzeug, womit sich mir ein zweites Feld des Jammerns eröffnete. Bei jeder unvorhersehbaren Arbeit – der Zeitpunkt für das Grasen der Rüben war für mich nie zu entschlüsseln gewesen und traf mich jedes Mal unvorbereitet – nagelte ich meine Mutter auf eine Zeit fest, wie lang es denn dauern und wann ich also wieder frei sein würde. Mit den Jahren reichte schließlich die Schwere der Arbeit allein nicht mehr aus, nicht für den Jüngsten, dem die Gnade der spätesten Geburt immer deutlicher vor Augen trat, da das Los der Verantwortung des Hoferben auf meinen nächst älteren Bruder fiel. Ich wurde nicht angelernt, sondern für mich blieben die Hilfsdienste übrig, das Zuarbeiten, worauf es im Notfall nicht ankam. Wo sein Gejammer auf felsigen Grund fiel, ging es bei mir hin und wieder auf. Ich konnte Termine vorschieben, Hausaufgaben, Prüfungen, Freunde, mit denen ich vor Wochen schon was ausgemacht hatte. Irgendetwas, was den Druck erhöhte, den Leidensdruck erklärte und damit das Jammern.
Wenn meine Mutter mal nachgab, meinem Gejammer und ihrem schlechten Gewissen vielleicht, und ich früher erlöst war, dann gnangsten die anderen, dass es ungerecht und ich ohnehin immer schon bevorzugt worden sei, und sie hatten recht damit. Also stellte meine Mutter mir sogleich eine weitere Arbeit in Aussicht, die ich die nächsten Tage zusätzlich zu erledigen hatte. Eine Art ausgleichende Gerechtigkeit, die jedoch – das wussten wir beide und die anderen wohl auch – oft weniger schlimm war und ab und zu sogar ganz entfiel, denn sie hatte andere Sorgen, als sich ständig zu merken, was sie mir alles aufgetragen hatte. Wenn Arbeit anstand, dann tat sie sie einfach, komme, was wolle. Dem steht gegenüber: mein Jammern und Betteln und Flehen, und meine Fluchten vom Hof zu Freunden, wo sich nach und nach auch bei mir das schlechte Gewissen Bahn brach. Das war der Zwickmühlenhandel: Freizeit gegen das Nagen der Schuld.
Die Arbeit, sie tat sich nie von allein, das wusste ich. Die Arbeit, sie war allumfassend, das ahnte ich. Es war ein sprachloses Eingeweidewissen vom großen Kreislauf der Jahreszeiten und von der langen Kette der Menschenmägen, an der alles hing, die alles antrieb: das Säen und Hacken und Zupfen und Spritzen und Ackern und Mähen, das Füttern und Melken und Striegeln und Schlachten und Düngen und Ernten und überhaupt. Und ich saß in den Zimmern meiner Freunde, die sämtlich in Häusern ohne Schmutzkammer lagen, in der wir das Stallgewand, die groben, löchrigen Socken, die von Erde schweren Stiefel abstreiften, während wir uns am kammerhohen Schuhregal festhielten, in dem sich alle ausrangierten Schuhe der Familie stapelten, die womöglich noch ein letztes Mal für irgendeine Arbeit herhalten mochten, und ich begriff jedes Mal aufs Neue, dass die allumfassende Arbeit unsere Arbeit war und nicht ihre.
Und ich beneidete meine Freunde und deren Eltern darum und schämte mich für unsere Arbeit, die einer Schmutzkammer bedurfte, ohne es je auszusprechen. Ich durfte mir in der Fremde die Fluchten vom Hof nicht verscherzen, ich durfte und wollte ihnen nichts von der Arbeit erzählen. Überhaupt durfte und wollte und konnte ich nichts von der Arbeit erzählen, die mich niederdrückte und von der ich doch so viel gelernt habe, ja alles eigentlich. In der Anschauung meiner Mutter lernte ich, nicht mehr zu jammern und nichts mehr zu wollen, sodass ich die Scham, manchmal zumindest – und eigentlich nur der Form halber, wie ich zugestehen muss –, überwinden kann, heutzutage.
Ihr Bild, als sie aus dem Stall wankte, nachdem ich einmal zu spät zum Helfen gekommen war, und sie beim hastigen Anziehen des Stallgewandes von der Schmutzkammer aus beobachtete, wie sie sich dreimal, in gelben Schwallen, erbrach, lehrte mich das. Sie hatte nach Frischluft gesucht und dann mit Ellenbogen und Schulter das große Tor aufgeschoben, das immer nur eine Handbreit für die Katzen offenstand, damit man meine Mutter von der Straße aus nicht sehen konnte. Dann krümmte es sie nach vorne und der erste Schwall ergoss sich aus ihrem Mund auf den Raps, den mein Bruder zuvor für die Kühe geholt hatte. Sie atmete schwer, aber sank nicht auf die Knie, während ich wie erstarrt hinter dem Schmutzkammerfenster stehen blieb. Es kamen der zweite und kurz darauf der dritte Schwall, nach dem sie sich aufrichtete und mit dem Handrücken über die Lippen fuhr.
Ich schlüpfte in die Galoschen und stürzte zur Tür hinaus, um ihr zu helfen, wobei ich erwartet hatte, sie würde sich auf den Heuballen gesetzt haben, der immer an der Stallwand lag, doch ich sah sie zunächst nicht mehr. Einige Sekunden später kam sie mit einer Heugabel wieder aus der Stalltür hervor, hob ihr Erbrochenes damit auf und warf es in die Mistrinne hinter die Kühe, bevor sie sich wieder zwischen sie stellte und sich zu ihren Eutern hinabbeugte. Als sie mich sah, schimpfte sie nicht über mein Zuspätkommen, sondern dankte mir, dass ich ihr heute, da es ihr nicht so gut gehe, helfe.
**
Markus Ostermair wurde 1981 in eine Bauernfamilie geboren, die aus Tegernbach bei Pfaffenhofen a. d. Ilm stammt. Nach dem frühen Tod des Vaters gab die Familie den Hopfenanbau auf, behielt aber die Milchvieh- und Landwirtschaft bei. Das Gymnasium brach er mit Mittlerer Reife ab, um eine kaufmännische Ausbildung in einem Autohaus zu absolvieren. Es folgte der Zivildienst in der Bahnhofsmission München, wo er zum ersten Mal mit dem Thema Obdachlosigkeit in Berührung kam. Er holte das Abitur nach und studierte in München Deutsch und Englisch auf Lehramt. Sein mehrfach ausgezeichnetes Romandebüt Der Sandler erschien 2020 im Osburg Verlag und schildert in sechs Tagen und Nächten ein Panorama der Straßenobdachlosigkeit.