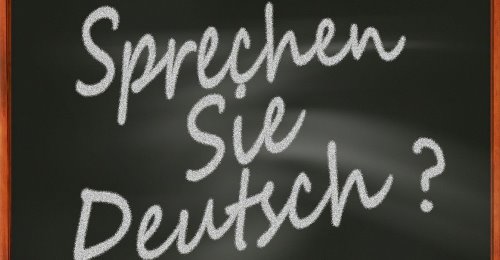Namen im Literaturbetrieb (5). Von Ksenia (Senka) Gorbunova
Wir reden oft über Kategorien wie Geschlecht, Alter, Bildungshintergrund, die Strukturen und Aufstiegschancen im Literaturbetrieb prägen. Über eines reden wir so gut wie nie ‒ über Namen. Welche Erfahrungen machen Autor*innen mit nicht-eindeutigen, nicht-deutschen Namen tagtäglich bei Bewerbungen, Ankündigungen, Lesungen, welche Strategien entwickeln sie dagegen? In dem folgenden Projekt geben sechs Autor*innen einen Einblick in widersprüchliche, komische wie unerträgliche Alltagserlebnisse. Fünfte Folge: ein Text von Ksenia (Senka) Gorbunova.
*
Ich habe einen Namen, ich habe viele Namen.
In jedem neuen Personaldokument in Deutschland wurde mein Name anders geschrieben. Neue Transkriptionsregeln und so. „Passen Sie auf, dass die Unterlagen in der Schule und in der Krankenkasse und überall angepasst sind. Nicht, dass man dann Ihr Kind nicht mehr identifizieren kann.“
In der deutschen Grundschule wurde der Vorname zuerst aufgeschrieben, wie andere ihn hörten: Xenia. Aber es gibt kein X im Kyrillischen, nur ein K und ein S, dafür aber ein Я, also ein JA. Also der kyrillische Buchstabe, der ganz allein für ein großes Wort steht, nämlich „Ich“ auf Russisch, ein einzelner Buchstabe als Zeichen der eigenen Identität.
In den offiziellen Papieren stand nie ein X vorne.
Transkription nach französischen Regeln, dann nach deutschen:
Ксения, Kseniya, Kseniia, Ksenija.
Auf jede neue Schreibweise folgt ein Schwall herauszusendender Briefe: „Beachten Sie bitte, dass…“ Die neuen Schreibweisen fast wie neue Namen.
Und dann noch die Verwirrung in der Schule, sobald das KS in den Schulunterlagen aufgetaucht ist: „Wie spricht man das denn aus? Kasenia? Kesenia?“
Die Verwirrung in jedem neuen Seminar, bei jeder neuen Arbeitsstelle: Was soll denn dieses KS am Anfang?
Als ich eingebürgert werde, darf ich bestimmen, wie mein Name geschrieben werden soll. Ich entscheide mich, das KS aus dem Kyrillischen beizubehalten, und vereinfache die Schreibweise am Ende zu IA.
Ich darf auch entscheiden, wie mein Nachname geschrieben werden soll: mit V, mit W, mit FF. Mit oder ohne den weiblichen Gendermarker a am Ende.
Nur der russische Vatersname passt nicht in das deutsche Namensrecht. Der Vatersname setzt sich aus dem Namen des Vaters und einer gegenderten Endung zusammen. Ich hätte den Namen angeglichen an das andere Rechtsystem behalten dürfen: Ksenia Michail. Kam mir seltsam vor, ich entschied mich dagegen. Damals war mein Vater noch am Leben. Vielleicht wäre meine Entscheidung jetzt anders ausgefallen und ich hätte ihn mit einem Doppelnamen geehrt. Ich hätte einen männlichen Vornamen haben und bei Bedarf darauf zurückgreifen können. Ich hätte.
Meine Mutter nennt mich nie Ksenia, niemand aus dem russischsprachigen Umfeld nennt mich so. Ksenja, Ksjuscha, Osja, Senka, Senechka, Senjusik. Ich mag das freche Senka, abgeleitet vom Kosenamen Senja in einer der vielen russischen Verniedlichungsformen. Ksenia teilt sich diese Kurzform mit Arsenij, sie ist deshalb genderneutral, auch wenn sie im deutschen Sprachraum wegen dem a am Ende oft als feminin gehört wird. Ich versuche, Senka im deutschsprachigen Umfeld einzuführen. Ich fürchte, dass es aus „deutschen“ Lippen komisch klingen wird, und manchmal tut es das, wenn das S und das K zu hart ausgesprochen werden.
Die Verbindung zwischen Senka und Ksenia scheint vielen unklar – ein neuer Name, der richtige Name? Ksenia als Deadname? Der volle Name als Markierung für nationale Identität, der vermeintliche Namenswechsel als Markierung für geschlechtliche Identität? Ich werde von Postboten auf Griechisch angesprochen – ich verstehe kein Griechisch. Man sagt mir, ich solle Bescheid geben, in welchen Kontexten ich nicht Senka genannt werden darf, wo ich noch nicht out bin – das Out-Sein hängt in diesem Fall nicht mit dem Namen zusammen.
Meine Mutter sagte mir, der Name Ksenia komme aus dem Griechischen, von dem Wort „Gastfreundlichkeit“, ξενία. Ich lernte später, dass das nicht die einzige Bedeutung ist. Der Name stammt auch von dem Wort für „Fremde“, ξένη. In einer Schreibwerkstatt merkte mal ein Kommilitone an, wie bezeichnend das doch sei, dass ich als Ksenia gegen Xenophobie anschreibe. Ein Schenkelklopfer, so ein cleveres Kerlchen. Tue ich das, gegen etwas anschreiben? Ich will nicht „gegen“, ich will „mit“ schreiben. Ein Journalist merkt an: „Senka bedeutet Schatten auf Serbisch.“ Wofür das wohl bezeichnend ist?
Die Grenze zwischen dem Eigenen und dem Fremden markiert manchmal ein einzelner Buchstabe, derselbe Laut ks, unterschiedlich transkribiert. Xenia scheint deutsch gelesen zu werden und nicht weiter auffällig zu sein. Ksenia hingegen sorgt für den überbetonten Fleiß, den Namen richtig auszusprechen. Ksenia ist Anlass für unterstellende Fragen zu Russlands Politik und dem Wodkakonsum meiner Eltern, für das Heraussuchen meiner Heimatstadt auf der Karte, für die Feststellung „Das ist ja in Asien. Ach, deshalb schauen deine Augen so aus.“ Plötzlich werden Anzeichen meiner Herkunft an meinem Körper gesucht, ich hätte Fuchsaugen, die Form sei exotisch.
Die Grenze zwischen dem Eigenen und dem Fremden markiert manchmal auch die Kurzform eines Namens, die in dem jeweiligen Sprachraum nicht geläufig ist. Ksenia kann mit Xenia assoziiert werden, Senka wohl nicht. Ich sehe, wie du nach einem Grund für den Namenswechsel suchst, nach Umgangsregeln – solltest du den einen oder den anderen Namen verwenden, was hängt emotional für mich dran, was sagt es über meine Identität aus? Ich sehe deine Unsicherheit, sehe, wie du mit deinem Unwissen versuchst klarzukommen. Ich möchte dir diese Unsicherheit nicht nehmen, ich möchte sie wertschätzen. Denn wenn sie darauf hinausläuft, dass du mir nichts unterstellst, sondern respektvoll fragst, bin ich dieser Unsicherheit dankbar.
**
Fühlen Sie sich angesprochen und möchten zum Projekt beitragen? Dann senden Sie Ihren Text (zw. 4.000 und 7.000 Zeichen, inkl. Leerzeichen) an Slata Roschal: ![]()
Namen im Literaturbetrieb (5). Von Ksenia (Senka) Gorbunova
Wir reden oft über Kategorien wie Geschlecht, Alter, Bildungshintergrund, die Strukturen und Aufstiegschancen im Literaturbetrieb prägen. Über eines reden wir so gut wie nie ‒ über Namen. Welche Erfahrungen machen Autor*innen mit nicht-eindeutigen, nicht-deutschen Namen tagtäglich bei Bewerbungen, Ankündigungen, Lesungen, welche Strategien entwickeln sie dagegen? In dem folgenden Projekt geben sechs Autor*innen einen Einblick in widersprüchliche, komische wie unerträgliche Alltagserlebnisse. Fünfte Folge: ein Text von Ksenia (Senka) Gorbunova.
*
Ich habe einen Namen, ich habe viele Namen.
In jedem neuen Personaldokument in Deutschland wurde mein Name anders geschrieben. Neue Transkriptionsregeln und so. „Passen Sie auf, dass die Unterlagen in der Schule und in der Krankenkasse und überall angepasst sind. Nicht, dass man dann Ihr Kind nicht mehr identifizieren kann.“
In der deutschen Grundschule wurde der Vorname zuerst aufgeschrieben, wie andere ihn hörten: Xenia. Aber es gibt kein X im Kyrillischen, nur ein K und ein S, dafür aber ein Я, also ein JA. Also der kyrillische Buchstabe, der ganz allein für ein großes Wort steht, nämlich „Ich“ auf Russisch, ein einzelner Buchstabe als Zeichen der eigenen Identität.
In den offiziellen Papieren stand nie ein X vorne.
Transkription nach französischen Regeln, dann nach deutschen:
Ксения, Kseniya, Kseniia, Ksenija.
Auf jede neue Schreibweise folgt ein Schwall herauszusendender Briefe: „Beachten Sie bitte, dass…“ Die neuen Schreibweisen fast wie neue Namen.
Und dann noch die Verwirrung in der Schule, sobald das KS in den Schulunterlagen aufgetaucht ist: „Wie spricht man das denn aus? Kasenia? Kesenia?“
Die Verwirrung in jedem neuen Seminar, bei jeder neuen Arbeitsstelle: Was soll denn dieses KS am Anfang?
Als ich eingebürgert werde, darf ich bestimmen, wie mein Name geschrieben werden soll. Ich entscheide mich, das KS aus dem Kyrillischen beizubehalten, und vereinfache die Schreibweise am Ende zu IA.
Ich darf auch entscheiden, wie mein Nachname geschrieben werden soll: mit V, mit W, mit FF. Mit oder ohne den weiblichen Gendermarker a am Ende.
Nur der russische Vatersname passt nicht in das deutsche Namensrecht. Der Vatersname setzt sich aus dem Namen des Vaters und einer gegenderten Endung zusammen. Ich hätte den Namen angeglichen an das andere Rechtsystem behalten dürfen: Ksenia Michail. Kam mir seltsam vor, ich entschied mich dagegen. Damals war mein Vater noch am Leben. Vielleicht wäre meine Entscheidung jetzt anders ausgefallen und ich hätte ihn mit einem Doppelnamen geehrt. Ich hätte einen männlichen Vornamen haben und bei Bedarf darauf zurückgreifen können. Ich hätte.
Meine Mutter nennt mich nie Ksenia, niemand aus dem russischsprachigen Umfeld nennt mich so. Ksenja, Ksjuscha, Osja, Senka, Senechka, Senjusik. Ich mag das freche Senka, abgeleitet vom Kosenamen Senja in einer der vielen russischen Verniedlichungsformen. Ksenia teilt sich diese Kurzform mit Arsenij, sie ist deshalb genderneutral, auch wenn sie im deutschen Sprachraum wegen dem a am Ende oft als feminin gehört wird. Ich versuche, Senka im deutschsprachigen Umfeld einzuführen. Ich fürchte, dass es aus „deutschen“ Lippen komisch klingen wird, und manchmal tut es das, wenn das S und das K zu hart ausgesprochen werden.
Die Verbindung zwischen Senka und Ksenia scheint vielen unklar – ein neuer Name, der richtige Name? Ksenia als Deadname? Der volle Name als Markierung für nationale Identität, der vermeintliche Namenswechsel als Markierung für geschlechtliche Identität? Ich werde von Postboten auf Griechisch angesprochen – ich verstehe kein Griechisch. Man sagt mir, ich solle Bescheid geben, in welchen Kontexten ich nicht Senka genannt werden darf, wo ich noch nicht out bin – das Out-Sein hängt in diesem Fall nicht mit dem Namen zusammen.
Meine Mutter sagte mir, der Name Ksenia komme aus dem Griechischen, von dem Wort „Gastfreundlichkeit“, ξενία. Ich lernte später, dass das nicht die einzige Bedeutung ist. Der Name stammt auch von dem Wort für „Fremde“, ξένη. In einer Schreibwerkstatt merkte mal ein Kommilitone an, wie bezeichnend das doch sei, dass ich als Ksenia gegen Xenophobie anschreibe. Ein Schenkelklopfer, so ein cleveres Kerlchen. Tue ich das, gegen etwas anschreiben? Ich will nicht „gegen“, ich will „mit“ schreiben. Ein Journalist merkt an: „Senka bedeutet Schatten auf Serbisch.“ Wofür das wohl bezeichnend ist?
Die Grenze zwischen dem Eigenen und dem Fremden markiert manchmal ein einzelner Buchstabe, derselbe Laut ks, unterschiedlich transkribiert. Xenia scheint deutsch gelesen zu werden und nicht weiter auffällig zu sein. Ksenia hingegen sorgt für den überbetonten Fleiß, den Namen richtig auszusprechen. Ksenia ist Anlass für unterstellende Fragen zu Russlands Politik und dem Wodkakonsum meiner Eltern, für das Heraussuchen meiner Heimatstadt auf der Karte, für die Feststellung „Das ist ja in Asien. Ach, deshalb schauen deine Augen so aus.“ Plötzlich werden Anzeichen meiner Herkunft an meinem Körper gesucht, ich hätte Fuchsaugen, die Form sei exotisch.
Die Grenze zwischen dem Eigenen und dem Fremden markiert manchmal auch die Kurzform eines Namens, die in dem jeweiligen Sprachraum nicht geläufig ist. Ksenia kann mit Xenia assoziiert werden, Senka wohl nicht. Ich sehe, wie du nach einem Grund für den Namenswechsel suchst, nach Umgangsregeln – solltest du den einen oder den anderen Namen verwenden, was hängt emotional für mich dran, was sagt es über meine Identität aus? Ich sehe deine Unsicherheit, sehe, wie du mit deinem Unwissen versuchst klarzukommen. Ich möchte dir diese Unsicherheit nicht nehmen, ich möchte sie wertschätzen. Denn wenn sie darauf hinausläuft, dass du mir nichts unterstellst, sondern respektvoll fragst, bin ich dieser Unsicherheit dankbar.
**
Fühlen Sie sich angesprochen und möchten zum Projekt beitragen? Dann senden Sie Ihren Text (zw. 4.000 und 7.000 Zeichen, inkl. Leerzeichen) an Slata Roschal: ![]()