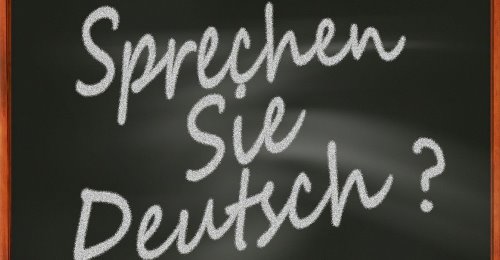Namen im Literaturbetrieb (4). Von Vladimir Kholodkov
Wir reden oft über Kategorien wie Geschlecht, Alter, Bildungshintergrund, die Strukturen und Aufstiegschancen im Literaturbetrieb prägen. Über eines reden wir so gut wie nie ‒ über Namen. Welche Erfahrungen machen Autor*innen mit nicht-eindeutigen, nicht-deutschen Namen tagtäglich bei Bewerbungen, Ankündigungen, Lesungen, welche Strategien entwickeln sie dagegen? In dem folgenden Projekt geben sechs Autor*innen einen Einblick in widersprüchliche, komische wie unerträgliche Alltagserlebnisse. Vierte Folge: ein Text von Vladimir Kholodkov.
*
Identität oder Formalität?
Die Namensgebung fand bei mir zweimal statt. Die erste war in Moskau Ende der Achtzigerjahre kurz vor meiner Geburt. Meine Eltern beschlossen, mich Vladimir zu nennen – ein recht verbreiteter Name im russischen Sprachraum, mit einem megalomanischen Beigeschmack (der Name bedeutet so viel wie „Herrscher der Welt“). Die zweite Namensgebung gab es dreizehn Jahre später in München an meinem ersten (deutschen) Schultag. Ich war gerade seit drei Monaten in Deutschland, sprach kaum Deutsch und war für alle in meinem Umfeld in sprachlicher, sozialer und optischer Hinsicht ein absoluter Fremdkörper. Nach der ersten Stunde versammelte sich um mich eine Gruppe von Neugierigen. Nachdem ich mithilfe der Taschenausgabe eines PONS-Wörterbuchs mich vorgestellt hatte, an die ich mich wie an einen Rettungsring festklammerte, gaben sie mir meinen neuen Namen: Vladi. Ich fand ihn sofort gut. Nicht nur hatte er einen coolen, deutschen Klang (Vladi klang nicht viel anders als Benni, Konsti oder Basti, mit denen meine Klasse voll war). Vor allem gab mir mein neuer Name das Gefühl, zumindest ein kleines bisschen dazuzugehören. Immerhin erfanden meine neuen Mitmenschen extra für mich einen Namen, nahmen also Kenntnis von mir, räumten mir einen Platz in ihrer Gruppe ein. Ich war nicht der Einzige, dem das passiert war. So wurde Oleg – ein anderer Junge bei mir in der Klasse – nicht mit Betonung auf e, wie im Russischen, sondern mit Betonung auf o ausgesprochen. Bei Nassim, dessen Eltern aus dem Iran kamen, wurde statt dem i das a betont. Und auch die vollständige Variante meines Namens wurde verändert: Lehrer und andere Erwachsene sagten zwar Vladimir zu mir, betonten aber nicht das erste i, wie im Russischen, sondern das a. Die Namensänderung schien also ein unumgänglicher Prozess zu sein, den jeder, dessen Eltern nicht in Deutschland geboren wurde, zu akzeptieren hatte. Ich hatte kein Problem damit und stellte mich fortan entweder als Vladi oder Vladimir vor, mit Betonung auf a.
Am Anfang wurde meine Herkunft recht oft zum Thema. Es gab ein paar Vodka-Witze, ein paar abfällige Kommentare. Unser Biolehrer, ein großer Bayer mit einer tiefen Stimme und einer Weißbierplauze, nannte mich ab und zu im Unterricht „Ivan“ oder „der Ruß“. Ich glaube nicht, dass er es als Beleidigung meinte. Vielmehr wirkte es wie eine grobschlächtige Bemühung um Humor, ein von der politischen Korrektheit unberührtes Auf-den-Arm-Nehmen, so wie er es wahrscheinlich aus seiner Jugend kannte. Insgesamt war es eine recht einsame Zeit – ich gehörte einfach nicht dazu, und die anderen Kinder in der Klasse mieden mich, meine billigen Klamotten, mein schlechtes Deutsch. Wahrscheinlich wäre es nicht viel anders gewesen, wenn ich Wolfgang geheißen hätte.
Sobald ich die Sprache sprechen konnte und mir einen Freundeskreis aufgebaut hatte, erfuhr mein Name ein paar weitere Wandlungen. „Waldefred“ nannten mich meine Freunde, wenn es gerade mal sehr witzig war. Oder „Waldi“. Insgesamt schien es immer weniger Leute zu interessieren, woher ich und mein Name stammten. Nur von den Älteren hörte ich immer wieder das obligatorische „Sie können aber gut Deutsch“ oder „Das ist aber kein deutscher Name“. Für solche Situationen entwickelte ich ein Vorgehen, das ich heute immer noch anwende: Beim ersten Spruch antworte ich, dass es kein großes Verdienst ist, da ich ja bereits ein paar Jährchen Zeit hatte, um Deutsch zu lernen. Beim zweiten Spruch sage ich, dass ich in Moskau geboren bin, und beantworte dann die anschließenden zwei, drei Fragen („Und wie lange...“), ohne dabei ins Detail zu gehen. Es stört mich nicht besonders – ich finde es nur etwas langweilig.
Während der Unizeit bekam ich die Chance, die Namensgebung zum dritten Mal stattfinden zu lassen. Als ich die deutsche Staatsbürgerschaft annahm, kam das Angebot, meinen Vornamen nun offiziell eindeutschen zu lassen: zu Waldemar. Ich lehnte dankend ab.
Mein Name rückte nochmal kurz in den Mittelpunkt, als ich bei meiner Familie meine deutsche Freundin vorstellte, die mich bis dahin auch nur als Vladi kannte. Sie machte mich damals auf die Tatsache aufmerksam, dass meine Eltern und meine Geschwister den Vladi überhaupt nicht kannten, sondern die vielen Namensabwandlungen nutzten, die es im Russischen gibt: Wowa, Wolodja, Wowtschik. Meine Freundin brauchte eine Weile, um zu verstehen, wer all diese Menschen waren, die meine Familie adressierte. Da wurde mir zum ersten Mal richtig bewusst, dass es mich in zwei Versionen gab: Als Wowa und Wolodja in der Familie, als Vladi und Vladimir außerhalb. Erst Jahre später fand Wowa den Weg nach draußen, als der deutsche Freund von meiner Schwester begonnen hatte, mich so zu nennen und sich damit seinen Platz in der Familie gefestigt hatte. Er tat es aber auf seine eigene Initiative. Ich würde niemandem außerhalb der Familie anbieten, mich Wowa zu nennen, genauso wie ich es meinen Brüdern den Vladi untersagt hatte – es fühlte sich einfach nicht richtig an, aufgesetzt, unnatürlich.
Der Name wurde wieder relevant – oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass er relevant wurde – als ich nach der Uni mit der Wohnungssuche begann. Bei jeder Absage hing die Frage in der Luft: Hat es vielleicht wegen des Namens nicht geklappt? Allerdings wusste ich nicht, ob es vielleicht doch an meinem Einkommen lag, und auch wenn es am Namen lag, wusste ich nicht, was ich daran ändern konnte, und verschickte einfach so lange Bewerbungen, bis ich endlich ein WG-Zimmer und später dann meine erste Wohnung fand. Bei der Jobsuche dagegen hatte ich öfter den Eindruck, dass der Name mir weiterhalf. Jemand wie ich war ein guter Fund für all die Unternehmen, die sich Diversität auf die Fahne schrieben. Aber auch hier war es immer reine Spekulation – niemand nahm mich bei der Hand und sagte, dass sie mich nun als Russen einstellen möchten, und ich fragte auch nicht nach, sondern machte das, was alle um mich machten – meine Arbeit.
Vor zwei Jahren hatte ich ein interessantes Erlebnis. Es war eine Wohnungsbesichtigung. Der Makler, ein Araber, stand neben den beiden Vermietern – zwei dicke, langsame, misstrauisch dreinblickende Bayer, Vater und Sohn – und zeigte begeistert mit dem Finger auf mich: „Sieht aus wie ein Deutscher. Spricht wie ein Deutscher. Ist aber ein Ausländer. Wahnsinn!“ Der Vater-Vermieter studierte wie bei einer Polizeikontrolle auffällig lange meinen Ausweis, der Sohn fragte, warum ich nach Deutschland gekommen war. Nach dem jahrelangen Aufenthalt in der akademischen Blase kam mir das alles fremd vor, wie aus einem anderen Zeitalter. Plötzlich merkte ich, dass es sie immer noch gab, die Leute, für die es wichtig war, wie man hieß, wo man her kam. Ich kriegte die Wohnung, es blieb aber ein trübes Gefühl zurück. Als ich die Episode meinem Vater erzählte, sagte er: „Das ist in Ordnung. Mach dir keinen Kopf. Für die wirst du immer ein Fremder bleiben.“ Er hat wohl recht – für Leute wie meine Vermieter werde ich wohl immer ein Fremder sein, unabhängig davon, wie gut ich Deutsch kann, wie viel Geld ich verdiene, wie lange ich in diesem Land lebe. Aber das ist egal. Wenn sie mir ihre Wohnung nicht vermieten wollen, finde ich eine andere. Wenn sie mir nicht den Job geben, den ich haben will, bewerbe ich mich woanders. Es ist kein Weltuntergang, höchstens ein Umweg. Mein Glück, mein Erfolg, meine Ziele gehören mir, und nicht meinen Vermietern und ihrer muffigen Denke.
Die Wohnung kündigte ich übrigens nach einem halben Jahr – sie war kalt und schimmlig – und zog in eine größere, besser gelegene. Und was den Namen angeht – ich stelle mich neuerdings nicht mehr als Vladi vor, sondern als Vladimir, mit Betonung auf a. Ist irgendwie solider.
**
Fühlen Sie sich angesprochen und möchten zum Projekt beitragen? Dann senden Sie Ihren Text (zw. 4.000 und 7.000 Zeichen, inkl. Leerzeichen) an Slata Roschal: ![]()
Namen im Literaturbetrieb (4). Von Vladimir Kholodkov
Wir reden oft über Kategorien wie Geschlecht, Alter, Bildungshintergrund, die Strukturen und Aufstiegschancen im Literaturbetrieb prägen. Über eines reden wir so gut wie nie ‒ über Namen. Welche Erfahrungen machen Autor*innen mit nicht-eindeutigen, nicht-deutschen Namen tagtäglich bei Bewerbungen, Ankündigungen, Lesungen, welche Strategien entwickeln sie dagegen? In dem folgenden Projekt geben sechs Autor*innen einen Einblick in widersprüchliche, komische wie unerträgliche Alltagserlebnisse. Vierte Folge: ein Text von Vladimir Kholodkov.
*
Identität oder Formalität?
Die Namensgebung fand bei mir zweimal statt. Die erste war in Moskau Ende der Achtzigerjahre kurz vor meiner Geburt. Meine Eltern beschlossen, mich Vladimir zu nennen – ein recht verbreiteter Name im russischen Sprachraum, mit einem megalomanischen Beigeschmack (der Name bedeutet so viel wie „Herrscher der Welt“). Die zweite Namensgebung gab es dreizehn Jahre später in München an meinem ersten (deutschen) Schultag. Ich war gerade seit drei Monaten in Deutschland, sprach kaum Deutsch und war für alle in meinem Umfeld in sprachlicher, sozialer und optischer Hinsicht ein absoluter Fremdkörper. Nach der ersten Stunde versammelte sich um mich eine Gruppe von Neugierigen. Nachdem ich mithilfe der Taschenausgabe eines PONS-Wörterbuchs mich vorgestellt hatte, an die ich mich wie an einen Rettungsring festklammerte, gaben sie mir meinen neuen Namen: Vladi. Ich fand ihn sofort gut. Nicht nur hatte er einen coolen, deutschen Klang (Vladi klang nicht viel anders als Benni, Konsti oder Basti, mit denen meine Klasse voll war). Vor allem gab mir mein neuer Name das Gefühl, zumindest ein kleines bisschen dazuzugehören. Immerhin erfanden meine neuen Mitmenschen extra für mich einen Namen, nahmen also Kenntnis von mir, räumten mir einen Platz in ihrer Gruppe ein. Ich war nicht der Einzige, dem das passiert war. So wurde Oleg – ein anderer Junge bei mir in der Klasse – nicht mit Betonung auf e, wie im Russischen, sondern mit Betonung auf o ausgesprochen. Bei Nassim, dessen Eltern aus dem Iran kamen, wurde statt dem i das a betont. Und auch die vollständige Variante meines Namens wurde verändert: Lehrer und andere Erwachsene sagten zwar Vladimir zu mir, betonten aber nicht das erste i, wie im Russischen, sondern das a. Die Namensänderung schien also ein unumgänglicher Prozess zu sein, den jeder, dessen Eltern nicht in Deutschland geboren wurde, zu akzeptieren hatte. Ich hatte kein Problem damit und stellte mich fortan entweder als Vladi oder Vladimir vor, mit Betonung auf a.
Am Anfang wurde meine Herkunft recht oft zum Thema. Es gab ein paar Vodka-Witze, ein paar abfällige Kommentare. Unser Biolehrer, ein großer Bayer mit einer tiefen Stimme und einer Weißbierplauze, nannte mich ab und zu im Unterricht „Ivan“ oder „der Ruß“. Ich glaube nicht, dass er es als Beleidigung meinte. Vielmehr wirkte es wie eine grobschlächtige Bemühung um Humor, ein von der politischen Korrektheit unberührtes Auf-den-Arm-Nehmen, so wie er es wahrscheinlich aus seiner Jugend kannte. Insgesamt war es eine recht einsame Zeit – ich gehörte einfach nicht dazu, und die anderen Kinder in der Klasse mieden mich, meine billigen Klamotten, mein schlechtes Deutsch. Wahrscheinlich wäre es nicht viel anders gewesen, wenn ich Wolfgang geheißen hätte.
Sobald ich die Sprache sprechen konnte und mir einen Freundeskreis aufgebaut hatte, erfuhr mein Name ein paar weitere Wandlungen. „Waldefred“ nannten mich meine Freunde, wenn es gerade mal sehr witzig war. Oder „Waldi“. Insgesamt schien es immer weniger Leute zu interessieren, woher ich und mein Name stammten. Nur von den Älteren hörte ich immer wieder das obligatorische „Sie können aber gut Deutsch“ oder „Das ist aber kein deutscher Name“. Für solche Situationen entwickelte ich ein Vorgehen, das ich heute immer noch anwende: Beim ersten Spruch antworte ich, dass es kein großes Verdienst ist, da ich ja bereits ein paar Jährchen Zeit hatte, um Deutsch zu lernen. Beim zweiten Spruch sage ich, dass ich in Moskau geboren bin, und beantworte dann die anschließenden zwei, drei Fragen („Und wie lange...“), ohne dabei ins Detail zu gehen. Es stört mich nicht besonders – ich finde es nur etwas langweilig.
Während der Unizeit bekam ich die Chance, die Namensgebung zum dritten Mal stattfinden zu lassen. Als ich die deutsche Staatsbürgerschaft annahm, kam das Angebot, meinen Vornamen nun offiziell eindeutschen zu lassen: zu Waldemar. Ich lehnte dankend ab.
Mein Name rückte nochmal kurz in den Mittelpunkt, als ich bei meiner Familie meine deutsche Freundin vorstellte, die mich bis dahin auch nur als Vladi kannte. Sie machte mich damals auf die Tatsache aufmerksam, dass meine Eltern und meine Geschwister den Vladi überhaupt nicht kannten, sondern die vielen Namensabwandlungen nutzten, die es im Russischen gibt: Wowa, Wolodja, Wowtschik. Meine Freundin brauchte eine Weile, um zu verstehen, wer all diese Menschen waren, die meine Familie adressierte. Da wurde mir zum ersten Mal richtig bewusst, dass es mich in zwei Versionen gab: Als Wowa und Wolodja in der Familie, als Vladi und Vladimir außerhalb. Erst Jahre später fand Wowa den Weg nach draußen, als der deutsche Freund von meiner Schwester begonnen hatte, mich so zu nennen und sich damit seinen Platz in der Familie gefestigt hatte. Er tat es aber auf seine eigene Initiative. Ich würde niemandem außerhalb der Familie anbieten, mich Wowa zu nennen, genauso wie ich es meinen Brüdern den Vladi untersagt hatte – es fühlte sich einfach nicht richtig an, aufgesetzt, unnatürlich.
Der Name wurde wieder relevant – oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass er relevant wurde – als ich nach der Uni mit der Wohnungssuche begann. Bei jeder Absage hing die Frage in der Luft: Hat es vielleicht wegen des Namens nicht geklappt? Allerdings wusste ich nicht, ob es vielleicht doch an meinem Einkommen lag, und auch wenn es am Namen lag, wusste ich nicht, was ich daran ändern konnte, und verschickte einfach so lange Bewerbungen, bis ich endlich ein WG-Zimmer und später dann meine erste Wohnung fand. Bei der Jobsuche dagegen hatte ich öfter den Eindruck, dass der Name mir weiterhalf. Jemand wie ich war ein guter Fund für all die Unternehmen, die sich Diversität auf die Fahne schrieben. Aber auch hier war es immer reine Spekulation – niemand nahm mich bei der Hand und sagte, dass sie mich nun als Russen einstellen möchten, und ich fragte auch nicht nach, sondern machte das, was alle um mich machten – meine Arbeit.
Vor zwei Jahren hatte ich ein interessantes Erlebnis. Es war eine Wohnungsbesichtigung. Der Makler, ein Araber, stand neben den beiden Vermietern – zwei dicke, langsame, misstrauisch dreinblickende Bayer, Vater und Sohn – und zeigte begeistert mit dem Finger auf mich: „Sieht aus wie ein Deutscher. Spricht wie ein Deutscher. Ist aber ein Ausländer. Wahnsinn!“ Der Vater-Vermieter studierte wie bei einer Polizeikontrolle auffällig lange meinen Ausweis, der Sohn fragte, warum ich nach Deutschland gekommen war. Nach dem jahrelangen Aufenthalt in der akademischen Blase kam mir das alles fremd vor, wie aus einem anderen Zeitalter. Plötzlich merkte ich, dass es sie immer noch gab, die Leute, für die es wichtig war, wie man hieß, wo man her kam. Ich kriegte die Wohnung, es blieb aber ein trübes Gefühl zurück. Als ich die Episode meinem Vater erzählte, sagte er: „Das ist in Ordnung. Mach dir keinen Kopf. Für die wirst du immer ein Fremder bleiben.“ Er hat wohl recht – für Leute wie meine Vermieter werde ich wohl immer ein Fremder sein, unabhängig davon, wie gut ich Deutsch kann, wie viel Geld ich verdiene, wie lange ich in diesem Land lebe. Aber das ist egal. Wenn sie mir ihre Wohnung nicht vermieten wollen, finde ich eine andere. Wenn sie mir nicht den Job geben, den ich haben will, bewerbe ich mich woanders. Es ist kein Weltuntergang, höchstens ein Umweg. Mein Glück, mein Erfolg, meine Ziele gehören mir, und nicht meinen Vermietern und ihrer muffigen Denke.
Die Wohnung kündigte ich übrigens nach einem halben Jahr – sie war kalt und schimmlig – und zog in eine größere, besser gelegene. Und was den Namen angeht – ich stelle mich neuerdings nicht mehr als Vladi vor, sondern als Vladimir, mit Betonung auf a. Ist irgendwie solider.
**
Fühlen Sie sich angesprochen und möchten zum Projekt beitragen? Dann senden Sie Ihren Text (zw. 4.000 und 7.000 Zeichen, inkl. Leerzeichen) an Slata Roschal: ![]()