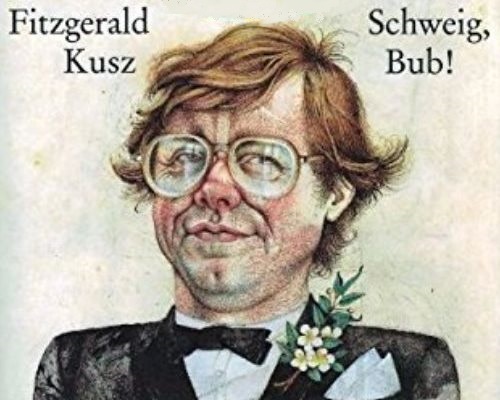Fitzgerald Kusz über die neue Fassung seines Volksstücks „Schweig, Bub“
Über 40 Jahre sind inzwischen seit der Uraufführung von Fitzgerald Kuszs Klassiker Schweig, Bub! vergangen. Das Stück, das die langsame Eskalation einer Konfirmationsfeier erzählt, wurde allein in Nürnberg mehr als 700 Mal aufgeführt, erfolgreich verfilmt und in viele andere deutsche Dialekte übertragen. Nun hat der renommierte Nürnberger Autor sein Erfolgstück noch einmal neu überarbeitet. Zu sehen ist die aktualisierte Fassung ab dem 12. Oktober in ![]() zahlreichen Vorstellungen im Landestheater Coburg. Im folgenden erzählt Kusz, wie es zu Schweig, Bub! und seiner Überarbeitung kam.
zahlreichen Vorstellungen im Landestheater Coburg. Im folgenden erzählt Kusz, wie es zu Schweig, Bub! und seiner Überarbeitung kam.
*
Alles begann mit einem Satz, der mir nicht mehr aus dem Kopf wollte: „Du, wou hammer letzthin ä suer Leberknidlersuppm gessn?“(= Du, wo haben wir letzthin so eine Leberknödelsuppe gegessen?) Ein seltsames Mantra, das den Kern des fränkischen Wesens heraufzubeschwören schien. Ein nicht tot zu kriegender Ohrwurm, gegen den unbedingt etwas unternommen werden musste. „Du, wou hammer letzthin ä suer Leberknidlersuppm gessn?“.
Ich geb´s ja zu: Alles in allem kein sehr gewichtiger Satz, nein, eher ein furchtbar banaler. Ich konnte machen, was ich wollte: Ich brachte diesen Un-Satz nicht mehr aus meinem Kopf. Er war stärker. Unmöglich, ihn in einem meiner Mundartgedichte unterzubringen. Er hätte sofort die Form des Gedichts gesprengt. Gedichte sind zarte Gebilde, die eine Leberknidlersuppm nicht vertragen. Der vermaledaite Satz verlangte nach mehr, schrie nach dem großen Suppenteller eines Theaterstücks.
Ein Stück für und über das Volk sollte es werden, ein Volksstück. Brechts Anmerkungen dazu hatte ich als 68er natürlich stets im Hinterkopf. Sein Ruf nach einer Rundumerneuerung des alten verkommenen Genres in seinen Anmerkungen zu seinem Volksstück Herr Puntila und sein Knecht Matti war immer noch aktuell: „Das Volksstück ist für gewöhnlich krudes und anspruchsloses Theater, und die gelehrte Ästhetik schweigt es tot oder behandelt es herablassend...Da gibt es derbe Späße, gemischt mit Rührseligkeiten, das ist hanebüchene Moral und billige Sexualität. Die Bösen werden bestraft, und die Guten werden geheiratet...Die Technik der Volksstückschreiber ist ziemlich international und ändert sich beinahe nie...Es genügt eine tüchtige Portion der gefürchteten Routiniertheit des Dilettantismus.“
Da saß ich nun mit einem Satz und Brechts Postulat im Nacken. Was ließ sich damit bloß anfangen? „Du, wou hammer letzthin ä suer Leberknidlersuppm gessn?“ Und schon war ich mitten in der Exposition: Auf so eine Frage konnte nur ein Fest folgen, ein fränkisches mit allen Gängen. Eine Konfirmationsfeier bot sich an. Sie lieferte die Struktur, das fünfaktige Gefäß, in das ich das ganze in meinem Kopf gespeicherte Gerede gießen konnte, mit dem mich meine Umwelt ein Leben lang drangsaliert hatte. Schweig, Bub! war wie ein Befreiungsschlag für mich. Schweig, Bub! wurde zum größten Publikumsrenner der Nürnberger Theatergeschichte. Es stand 34 Jahre lang mit 730 Vorstellungen bis 2010 auf dem Spielplan.
Vor kurzem bin ich auf einen Aphorismus von Hugo von Hofmannsthal gestoßen, der vielleicht den Erfolg des Stückes erklärt : „Die Tiefe muß man verstecken. Wo? An der Oberfläche.“ Im Programmheft der Uraufführung, die am 6.10.1976 in den Nürnberger Kammerspielen über die Bühne ging, fand sich unter anderem auch ein Zitat von Anton Tschechow, das immer noch Gültigkeit besitzt: „Im wirklichen Leben verbringen die Menschen nicht jede Minute damit, einander zu erschießen, sich aufzuhängen und Liebeserklärungen zu machen. Sie widmen nicht ihre ganze Zeit dem Bestreben, gescheite Dinge zu sagen. Sie sind damit beschäftigt zu essen, zu trinken, zu flirten und Dummheiten zu sagen – und das ist es, was auf der Bühne vor sich gehen sollte. Man sollte ein Stück schreiben, in dem die Menschen kommen, gehen, speisen, über das Wetter reden und Karten spielen. Leben sollte genauso sein, wie es ist, und Menschen sollten genauso sein, wie sie sind. Auf der Bühne sollte alles genauso kompliziert und gleichzeitig genauso einfach sein, wie es im Leben ist. Die Menschen nehmen ihre Mahlzeit, und inzwischen ist ihr Glück gemacht oder ihr Leben ruiniert.“
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Oder doch? Schweig, Bub! wurde bislang in ungefähr dreizehn deutsche Dialekte und ins Flämische übertragen. Jede Übersetzung hat, mit entsprechenden Lokalkolorit versehen, erstaunlicherweise gut funktioniert. Ich habe das Stück unzählige Male in den verschiedensten Dialekten gesehen. Es zündet immer noch. Ich mag es noch immer. Bei der szenischen Lesung, die anlässlich des vierzigsten Jahrestages der Uraufführung im Nürnberger Staatstheater stattfand, wurde mir schmerzlich bewusst, dass ich inzwischen längst selbst das Alter meiner Protagonisten Onkel Willi und Tante Anna erreicht habe! Grund genug, mich noch einmal an die Arbeit zu machen.
Ich habe mir meine in der phonetischen Schreibweise meiner Gedichte geschriebene Urfassung zur Hand genommen und das ganze Stück, das ich in einem Interview einmal als mein „längstes Gedicht“ bezeichnete habe, ganz behutsam aktualisiert. Ich habe versucht den Klang, den Sound des Originals, den Sprach-Rhythmus in eine süddeutsch gefärbte Kunstsprache hinüber zu retten. Ich will hoffen, dass es mir gelungen ist. Das für den Erfolg des Stücks unverzichtbare Pointen-Feuerwerk musste auf jeden Fall erhalten bleiben, denn „Humor ist ” – nach Jean Paul – „überwundenes Leiden.” Humor ist die Katharsis.
Fitzgerald Kusz über die neue Fassung seines Volksstücks „Schweig, Bub“
Über 40 Jahre sind inzwischen seit der Uraufführung von Fitzgerald Kuszs Klassiker Schweig, Bub! vergangen. Das Stück, das die langsame Eskalation einer Konfirmationsfeier erzählt, wurde allein in Nürnberg mehr als 700 Mal aufgeführt, erfolgreich verfilmt und in viele andere deutsche Dialekte übertragen. Nun hat der renommierte Nürnberger Autor sein Erfolgstück noch einmal neu überarbeitet. Zu sehen ist die aktualisierte Fassung ab dem 12. Oktober in ![]() zahlreichen Vorstellungen im Landestheater Coburg. Im folgenden erzählt Kusz, wie es zu Schweig, Bub! und seiner Überarbeitung kam.
zahlreichen Vorstellungen im Landestheater Coburg. Im folgenden erzählt Kusz, wie es zu Schweig, Bub! und seiner Überarbeitung kam.
*
Alles begann mit einem Satz, der mir nicht mehr aus dem Kopf wollte: „Du, wou hammer letzthin ä suer Leberknidlersuppm gessn?“(= Du, wo haben wir letzthin so eine Leberknödelsuppe gegessen?) Ein seltsames Mantra, das den Kern des fränkischen Wesens heraufzubeschwören schien. Ein nicht tot zu kriegender Ohrwurm, gegen den unbedingt etwas unternommen werden musste. „Du, wou hammer letzthin ä suer Leberknidlersuppm gessn?“.
Ich geb´s ja zu: Alles in allem kein sehr gewichtiger Satz, nein, eher ein furchtbar banaler. Ich konnte machen, was ich wollte: Ich brachte diesen Un-Satz nicht mehr aus meinem Kopf. Er war stärker. Unmöglich, ihn in einem meiner Mundartgedichte unterzubringen. Er hätte sofort die Form des Gedichts gesprengt. Gedichte sind zarte Gebilde, die eine Leberknidlersuppm nicht vertragen. Der vermaledaite Satz verlangte nach mehr, schrie nach dem großen Suppenteller eines Theaterstücks.
Ein Stück für und über das Volk sollte es werden, ein Volksstück. Brechts Anmerkungen dazu hatte ich als 68er natürlich stets im Hinterkopf. Sein Ruf nach einer Rundumerneuerung des alten verkommenen Genres in seinen Anmerkungen zu seinem Volksstück Herr Puntila und sein Knecht Matti war immer noch aktuell: „Das Volksstück ist für gewöhnlich krudes und anspruchsloses Theater, und die gelehrte Ästhetik schweigt es tot oder behandelt es herablassend...Da gibt es derbe Späße, gemischt mit Rührseligkeiten, das ist hanebüchene Moral und billige Sexualität. Die Bösen werden bestraft, und die Guten werden geheiratet...Die Technik der Volksstückschreiber ist ziemlich international und ändert sich beinahe nie...Es genügt eine tüchtige Portion der gefürchteten Routiniertheit des Dilettantismus.“
Da saß ich nun mit einem Satz und Brechts Postulat im Nacken. Was ließ sich damit bloß anfangen? „Du, wou hammer letzthin ä suer Leberknidlersuppm gessn?“ Und schon war ich mitten in der Exposition: Auf so eine Frage konnte nur ein Fest folgen, ein fränkisches mit allen Gängen. Eine Konfirmationsfeier bot sich an. Sie lieferte die Struktur, das fünfaktige Gefäß, in das ich das ganze in meinem Kopf gespeicherte Gerede gießen konnte, mit dem mich meine Umwelt ein Leben lang drangsaliert hatte. Schweig, Bub! war wie ein Befreiungsschlag für mich. Schweig, Bub! wurde zum größten Publikumsrenner der Nürnberger Theatergeschichte. Es stand 34 Jahre lang mit 730 Vorstellungen bis 2010 auf dem Spielplan.
Vor kurzem bin ich auf einen Aphorismus von Hugo von Hofmannsthal gestoßen, der vielleicht den Erfolg des Stückes erklärt : „Die Tiefe muß man verstecken. Wo? An der Oberfläche.“ Im Programmheft der Uraufführung, die am 6.10.1976 in den Nürnberger Kammerspielen über die Bühne ging, fand sich unter anderem auch ein Zitat von Anton Tschechow, das immer noch Gültigkeit besitzt: „Im wirklichen Leben verbringen die Menschen nicht jede Minute damit, einander zu erschießen, sich aufzuhängen und Liebeserklärungen zu machen. Sie widmen nicht ihre ganze Zeit dem Bestreben, gescheite Dinge zu sagen. Sie sind damit beschäftigt zu essen, zu trinken, zu flirten und Dummheiten zu sagen – und das ist es, was auf der Bühne vor sich gehen sollte. Man sollte ein Stück schreiben, in dem die Menschen kommen, gehen, speisen, über das Wetter reden und Karten spielen. Leben sollte genauso sein, wie es ist, und Menschen sollten genauso sein, wie sie sind. Auf der Bühne sollte alles genauso kompliziert und gleichzeitig genauso einfach sein, wie es im Leben ist. Die Menschen nehmen ihre Mahlzeit, und inzwischen ist ihr Glück gemacht oder ihr Leben ruiniert.“
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Oder doch? Schweig, Bub! wurde bislang in ungefähr dreizehn deutsche Dialekte und ins Flämische übertragen. Jede Übersetzung hat, mit entsprechenden Lokalkolorit versehen, erstaunlicherweise gut funktioniert. Ich habe das Stück unzählige Male in den verschiedensten Dialekten gesehen. Es zündet immer noch. Ich mag es noch immer. Bei der szenischen Lesung, die anlässlich des vierzigsten Jahrestages der Uraufführung im Nürnberger Staatstheater stattfand, wurde mir schmerzlich bewusst, dass ich inzwischen längst selbst das Alter meiner Protagonisten Onkel Willi und Tante Anna erreicht habe! Grund genug, mich noch einmal an die Arbeit zu machen.
Ich habe mir meine in der phonetischen Schreibweise meiner Gedichte geschriebene Urfassung zur Hand genommen und das ganze Stück, das ich in einem Interview einmal als mein „längstes Gedicht“ bezeichnete habe, ganz behutsam aktualisiert. Ich habe versucht den Klang, den Sound des Originals, den Sprach-Rhythmus in eine süddeutsch gefärbte Kunstsprache hinüber zu retten. Ich will hoffen, dass es mir gelungen ist. Das für den Erfolg des Stücks unverzichtbare Pointen-Feuerwerk musste auf jeden Fall erhalten bleiben, denn „Humor ist ” – nach Jean Paul – „überwundenes Leiden.” Humor ist die Katharsis.