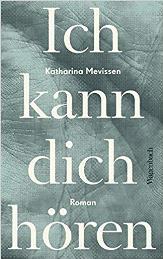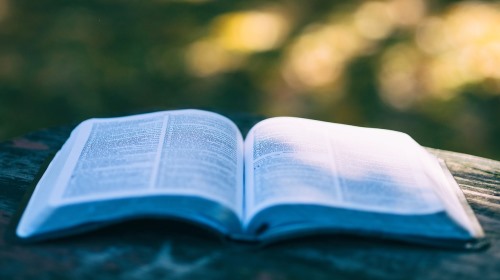Katharina Mevissens Debütroman „Ich kann dich hören“
Katharina Mevissen (*1991) hat in Bremen Kulturwissenschaft und transnationale Literaturwissenschaft studiert und in Berlin eine Drehbuch-Ausbildung absolviert. Heute lebt sie als freie Autorin in Berlin und leitet zudem die von ihr mitgegründete Literaturinitiative „handverlesen“. Im Januar ist ihr Debütroman ![]() Ich kann dich hören erschienen. Präsentiert hat sie ihr Buch unter anderem im Rahmen des diesjährigen Wortspiele-Festivals in München.
Ich kann dich hören erschienen. Präsentiert hat sie ihr Buch unter anderem im Rahmen des diesjährigen Wortspiele-Festivals in München.
*
Es wird viel geatmet in Katharina Mevissens Buch. Vielleicht atmen die Protagonisten einfach, weil auch Romanfiguren hin und wieder Sauerstoff benötigen, um nicht zu ersticken. Vielleicht saugen sie aber auch deshalb immer wieder so gierig Luft in sich ein, um zu zeigen, dass sie lebendig sind. Um sich selbst und dem Leser zu beweisen, dass sie wirklich existieren.
„Ich bin einer von denen, die atmen.“ – So stellt sich Protagonist Osman auch gleich zu Beginn des Buches selbst vor und schafft somit eine Gemeinsamkeit, eine klare Verbindung zwischen sich selbst und dem Leser, die das gesamte Buch über bestehen bleibt. Man begleitet den 24-Jährigen durch eine schwierige Zeit und atmet mit ihm, wenn er mit neuen Problemen konfrontiert wird.
Osman studiert Cello. Eigentlich will er das gar nicht, denn auch sein Vater ist Berufsmusiker und mit dem will er so wenig wie möglich gemeinsam haben – die Familienverhältnisse sind kompliziert. Doch irgendwie kommt er nicht von der Musik los. Er verflucht sie und braucht sie zugleich. Weder an der Uni noch im Fußballverein passt er so richtig zu den anderen, und in seine Mitbewohnerin ist er verliebt, schafft es aber nicht, ihr das auch zu zeigen. Dass sein Vater nun wegen eines gebrochenen Handgelenks nicht mehr Geige spielen kann und seine Tante will, dass er ihr dabei hilft, den Vater wieder aufzupäppeln, macht die Sache nicht einfacher. Also atmet Osman. Zu mehr ist er nicht fähig.
Man fühlt mit Osman, doch diese Empathie muss nicht zwangsläufig Sympathie bedeuten, findet Autorin Katharina Mevissen: „Osman hat mich auch immer wieder genervt, und ich bin mir sicher, so manche Leser*in wird das streckenweise auch sein. Aber diese Distanz, diese Reibungen sind notwendig, um die Figur im Blick zu behalten.“
Ein verlorenes Aufnahmegerät und klingende Wörter
Bewegung kommt in die Geschichte, als Osman am Bahnhof zufällig ein Aufnahmegerät findet und kurzerhand einsteckt. Auf den Aufnahmen ist Ella zu hören. Ella, die sich das Gerät für ein Interview im Rahmen eines Uniprojekts ausgeliehen hat und es dann halb zufällig, halb absichtlich als eine Art Audiotagebuch verwendet, das sie führt, während sie mit ihrer tauben Schwester Jo durch Schottland reist. Osman ist fasziniert von den Aufnahmen und verliert sich zwischenzeitlich völlig in ihnen:
Ich befühle das Gerät und komme mir vor wie ein Spanner. Weil mir das, was ich höre, nicht gehört. Eine Stimme entblößt viel mehr von einer Person als ein Bild. Stimmen sind viel persönlicher, mehr wie Haare, die man findet. Wie der spezifische Geruch, den man in Textilien hinterlässt, oder die Körperwärme im Bussitz, die noch von der Person vor dir stammt. Ich will mehr davon.
Nach und nach helfen Ellas Audioaufnahmen Osman dabei, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, besser zuzuhören und schließlich auch da zu handeln, wo er zuvor nur atmen konnte. Sehr eindrücklich gelingt es Mevissen dabei, das in Worte zu fassen, was Osman auf den Aufnahmen hört. Zum Beispiel als Ella am Meer steht:
Die Wellen rauschen nicht, sie schlagen, es klingt wild und wütend. Die Wassermassen brechen auf Fels und Gestein […]. Die Töne fließen zurück, sammeln sich erneut und schlagen wieder zu. Von dem großen, gewaltigen Meereston splittern feine, rieselnde, klickende Töne ab. Wie die Salzkristalle, die zurückbleiben, wenn sich das Wasser zurückzieht. Salzige, körnige Töne, die auf der Haut eintrocknen und leichtes Jucken verursachen.
Eine bestimmte Technik habe sie nicht gehabt, um ihre Wörter zum Klingen zu bringen, erklärt Mevissen: „Wenn die richtige Sprache und Rhythmik für die jeweilige Geschichte einmal gefunden sind, geht das ganz intuitiv.“
Die Autorin Katharina Mevissen © Denise Sterr
Wie belauscht man ein gebärdensprachliches Gespräch?
Doch was ist in Fällen, in denen das Gehörte allein nicht ausreichen kann, um eine Situation vollends zu verstehen? Eine der Aufnahmen dokumentiert einen heftigen Streit zwischen Ella und Jo. Da die entsprechenden Gebärden und die Mimik der beiden nicht zu sehen sind, bleiben Osman und der Leser über den genaueren Hergang der Szene im Ungewissen:
Rascheln, Klickern, Bewegungs- und Mundgeräusche. Kräftige, schnelle, kurze Bewegungen im Zelt. Klatschen, Pusten, dazwischen kehlige Laute und helle, hohe Obertöne, Schnalzen, Silben und Wortstücke. Dann das Rascheln von Polyester, Pause.
Und doch schaffen es die Beschreibungen, dass wir ein Gefühl von dem bekommen, was sich dort im Zelt abspielt. Wie sich im Laufe des Buches zeigen wird, fühlt sich Jo in ihrer Gehörlosigkeit allein gelassen und spielt mit dem Gedanken, sich einer komplizierten Operation zu unterziehen, um hören und dadurch studieren gehen zu können.
Gehörlosigkeit ist ein Thema, mit dem sich Mevissen auch über ihr Buch hinaus beschäftigt. Ihre Literaturinitiative ![]() handverlesen fördert gebärdensprachliche Poesie und Prosa und fordert ein neues und breiteres Verständnis von Literatur. Die Autorin will dieses Projekt und ihren Roman streng voneinander trennen, doch dass Geräusche und Töne, Akustisches und dessen Fernbleiben wichtige Themen für sie zu sein scheinen, steht außer Frage.
handverlesen fördert gebärdensprachliche Poesie und Prosa und fordert ein neues und breiteres Verständnis von Literatur. Die Autorin will dieses Projekt und ihren Roman streng voneinander trennen, doch dass Geräusche und Töne, Akustisches und dessen Fernbleiben wichtige Themen für sie zu sein scheinen, steht außer Frage.
„Meine beste Antwort auf die Frage, welche Rolle das Akustische spielen kann, ist der Roman selbst“
Den Roman selbst bezeichnet Mevissen als eine „Geschichte des Zuhörens“. Während die Figuren langsam und teilweise auch schmerzhaft voneinander lernen müssen, was zuhören bedeutet, erfährt man als Leser, wie sich auf dem Cello gespielter Nieselregen, zerbrechendes Altglas, wütendes Türkisch, im Raum schwebendes Ungesagtes und verzweifelte Atemzüge anhören können.
Viele kleine Einzelgeschichten werden in Ich kann dich hören angedeutet, aber nicht alles wird zu Ende erzählt. Dies war auch das Ziel der Autorin: „Ich kann Bücher nicht leiden, in denen zu viel erzählt wird. Es ist mir beim Schreiben sehr wichtig, in aussagekräftigen Ausschnitten zu erzählen. Durch die Lücken bleibt der Text offener.“
Diese Offenheit gibt den Tönen den Raum, den sie benötigen, um ihre volle Wirkung zu entfalten und den Text zum Klingen zu bringen. Und so kann man innerlich nur zustimmend nicken, wenn Mevissen sagt: „Meine beste Antwort auf die Frage, welche Rolle das Akustische spielen kann, ist ganz sicher der Roman selbst.“ Eine gute Antwort, die sie da hat.
Katharina Mevissens Debütroman „Ich kann dich hören“
Katharina Mevissen (*1991) hat in Bremen Kulturwissenschaft und transnationale Literaturwissenschaft studiert und in Berlin eine Drehbuch-Ausbildung absolviert. Heute lebt sie als freie Autorin in Berlin und leitet zudem die von ihr mitgegründete Literaturinitiative „handverlesen“. Im Januar ist ihr Debütroman ![]() Ich kann dich hören erschienen. Präsentiert hat sie ihr Buch unter anderem im Rahmen des diesjährigen Wortspiele-Festivals in München.
Ich kann dich hören erschienen. Präsentiert hat sie ihr Buch unter anderem im Rahmen des diesjährigen Wortspiele-Festivals in München.
*
Es wird viel geatmet in Katharina Mevissens Buch. Vielleicht atmen die Protagonisten einfach, weil auch Romanfiguren hin und wieder Sauerstoff benötigen, um nicht zu ersticken. Vielleicht saugen sie aber auch deshalb immer wieder so gierig Luft in sich ein, um zu zeigen, dass sie lebendig sind. Um sich selbst und dem Leser zu beweisen, dass sie wirklich existieren.
„Ich bin einer von denen, die atmen.“ – So stellt sich Protagonist Osman auch gleich zu Beginn des Buches selbst vor und schafft somit eine Gemeinsamkeit, eine klare Verbindung zwischen sich selbst und dem Leser, die das gesamte Buch über bestehen bleibt. Man begleitet den 24-Jährigen durch eine schwierige Zeit und atmet mit ihm, wenn er mit neuen Problemen konfrontiert wird.
Osman studiert Cello. Eigentlich will er das gar nicht, denn auch sein Vater ist Berufsmusiker und mit dem will er so wenig wie möglich gemeinsam haben – die Familienverhältnisse sind kompliziert. Doch irgendwie kommt er nicht von der Musik los. Er verflucht sie und braucht sie zugleich. Weder an der Uni noch im Fußballverein passt er so richtig zu den anderen, und in seine Mitbewohnerin ist er verliebt, schafft es aber nicht, ihr das auch zu zeigen. Dass sein Vater nun wegen eines gebrochenen Handgelenks nicht mehr Geige spielen kann und seine Tante will, dass er ihr dabei hilft, den Vater wieder aufzupäppeln, macht die Sache nicht einfacher. Also atmet Osman. Zu mehr ist er nicht fähig.
Man fühlt mit Osman, doch diese Empathie muss nicht zwangsläufig Sympathie bedeuten, findet Autorin Katharina Mevissen: „Osman hat mich auch immer wieder genervt, und ich bin mir sicher, so manche Leser*in wird das streckenweise auch sein. Aber diese Distanz, diese Reibungen sind notwendig, um die Figur im Blick zu behalten.“
Ein verlorenes Aufnahmegerät und klingende Wörter
Bewegung kommt in die Geschichte, als Osman am Bahnhof zufällig ein Aufnahmegerät findet und kurzerhand einsteckt. Auf den Aufnahmen ist Ella zu hören. Ella, die sich das Gerät für ein Interview im Rahmen eines Uniprojekts ausgeliehen hat und es dann halb zufällig, halb absichtlich als eine Art Audiotagebuch verwendet, das sie führt, während sie mit ihrer tauben Schwester Jo durch Schottland reist. Osman ist fasziniert von den Aufnahmen und verliert sich zwischenzeitlich völlig in ihnen:
Ich befühle das Gerät und komme mir vor wie ein Spanner. Weil mir das, was ich höre, nicht gehört. Eine Stimme entblößt viel mehr von einer Person als ein Bild. Stimmen sind viel persönlicher, mehr wie Haare, die man findet. Wie der spezifische Geruch, den man in Textilien hinterlässt, oder die Körperwärme im Bussitz, die noch von der Person vor dir stammt. Ich will mehr davon.
Nach und nach helfen Ellas Audioaufnahmen Osman dabei, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, besser zuzuhören und schließlich auch da zu handeln, wo er zuvor nur atmen konnte. Sehr eindrücklich gelingt es Mevissen dabei, das in Worte zu fassen, was Osman auf den Aufnahmen hört. Zum Beispiel als Ella am Meer steht:
Die Wellen rauschen nicht, sie schlagen, es klingt wild und wütend. Die Wassermassen brechen auf Fels und Gestein […]. Die Töne fließen zurück, sammeln sich erneut und schlagen wieder zu. Von dem großen, gewaltigen Meereston splittern feine, rieselnde, klickende Töne ab. Wie die Salzkristalle, die zurückbleiben, wenn sich das Wasser zurückzieht. Salzige, körnige Töne, die auf der Haut eintrocknen und leichtes Jucken verursachen.
Eine bestimmte Technik habe sie nicht gehabt, um ihre Wörter zum Klingen zu bringen, erklärt Mevissen: „Wenn die richtige Sprache und Rhythmik für die jeweilige Geschichte einmal gefunden sind, geht das ganz intuitiv.“
Die Autorin Katharina Mevissen © Denise Sterr
Wie belauscht man ein gebärdensprachliches Gespräch?
Doch was ist in Fällen, in denen das Gehörte allein nicht ausreichen kann, um eine Situation vollends zu verstehen? Eine der Aufnahmen dokumentiert einen heftigen Streit zwischen Ella und Jo. Da die entsprechenden Gebärden und die Mimik der beiden nicht zu sehen sind, bleiben Osman und der Leser über den genaueren Hergang der Szene im Ungewissen:
Rascheln, Klickern, Bewegungs- und Mundgeräusche. Kräftige, schnelle, kurze Bewegungen im Zelt. Klatschen, Pusten, dazwischen kehlige Laute und helle, hohe Obertöne, Schnalzen, Silben und Wortstücke. Dann das Rascheln von Polyester, Pause.
Und doch schaffen es die Beschreibungen, dass wir ein Gefühl von dem bekommen, was sich dort im Zelt abspielt. Wie sich im Laufe des Buches zeigen wird, fühlt sich Jo in ihrer Gehörlosigkeit allein gelassen und spielt mit dem Gedanken, sich einer komplizierten Operation zu unterziehen, um hören und dadurch studieren gehen zu können.
Gehörlosigkeit ist ein Thema, mit dem sich Mevissen auch über ihr Buch hinaus beschäftigt. Ihre Literaturinitiative ![]() handverlesen fördert gebärdensprachliche Poesie und Prosa und fordert ein neues und breiteres Verständnis von Literatur. Die Autorin will dieses Projekt und ihren Roman streng voneinander trennen, doch dass Geräusche und Töne, Akustisches und dessen Fernbleiben wichtige Themen für sie zu sein scheinen, steht außer Frage.
handverlesen fördert gebärdensprachliche Poesie und Prosa und fordert ein neues und breiteres Verständnis von Literatur. Die Autorin will dieses Projekt und ihren Roman streng voneinander trennen, doch dass Geräusche und Töne, Akustisches und dessen Fernbleiben wichtige Themen für sie zu sein scheinen, steht außer Frage.
„Meine beste Antwort auf die Frage, welche Rolle das Akustische spielen kann, ist der Roman selbst“
Den Roman selbst bezeichnet Mevissen als eine „Geschichte des Zuhörens“. Während die Figuren langsam und teilweise auch schmerzhaft voneinander lernen müssen, was zuhören bedeutet, erfährt man als Leser, wie sich auf dem Cello gespielter Nieselregen, zerbrechendes Altglas, wütendes Türkisch, im Raum schwebendes Ungesagtes und verzweifelte Atemzüge anhören können.
Viele kleine Einzelgeschichten werden in Ich kann dich hören angedeutet, aber nicht alles wird zu Ende erzählt. Dies war auch das Ziel der Autorin: „Ich kann Bücher nicht leiden, in denen zu viel erzählt wird. Es ist mir beim Schreiben sehr wichtig, in aussagekräftigen Ausschnitten zu erzählen. Durch die Lücken bleibt der Text offener.“
Diese Offenheit gibt den Tönen den Raum, den sie benötigen, um ihre volle Wirkung zu entfalten und den Text zum Klingen zu bringen. Und so kann man innerlich nur zustimmend nicken, wenn Mevissen sagt: „Meine beste Antwort auf die Frage, welche Rolle das Akustische spielen kann, ist ganz sicher der Roman selbst.“ Eine gute Antwort, die sie da hat.