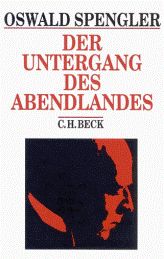Der "Untergang des Abendlandes" wird auch schon 100!
Spiegel bayerischer Literatur und Kultur, fundiert und unterhaltsam, Essays, Prosatexte und Gedichte von prominenten und unbekannten Autoren: Das ist die Zeitschrift Literatur in Bayern. In der 134. Ausgabe beschäftigt sich Publizist Klaus Hübner mit einem speziellen Jubiläum: Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes" wird 100.
*
Selten einmal bleibt ein Buchtitel in aller Munde, wenn das Buch selbst schon fast vergessen ist. 1918, mitten in der Revolutionszeit, erschien in Wien der erste Teil eines monumentalen geschichtsphilosophischen Wälzers: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. „Kein deutsches Werk über Geschichte hat ein ähnlich starkes und anhaltendes Echo gefunden", schreibt der Althistoriker Alexander Demandt im Vorwort seines trotz mancher Redundanzen lesenswerten Essaybands Untergänge des Abendlandes.
Verfasst wurde der von Stefan Zweig, Thomas Mann und zahlreichen anderen Zeitgenossen bald bejubelte Untergang des Abendlandes zwischen 1911 und 1917 von einem 1880 in Blankenburg am Harz geborenen, wegen eines schweren Herzfehlers kriegsuntauglichen Stubenhocker, der als „Privatier" unauffällig in Schwabing hauste – Detlef Felken hat Oswald Spenglers Münchner Jahre detailliert beschrieben.
Der zweite Band des Untergangs erschien 1922 bei C.H. Beck. Das gar nicht so einfach zu lesende Werk erlebte bis 1940 mehr als 70 Auflagen und prägte maßgeblich das Geschichtsbild einer ganzen Generation.
„Kein deutsches Buch der letzten zwanzig Jahre ist noch umkämpft worden wie, vor einem halben Jahrhundert, 'Der Untergang des Abendlandes'", schrieb der bessere Marcuse in seinem Nachruf auf Ludwig Marcuse (1969). Noch vor Kurzem konnte der in der Wiener Neustadt geborene israelische Aphoristiker Elazar Benyoetz lapidar formulieren: „Der Untergang des Abendlandes/ist im Westen nichts Neues". Und jeder wusste, was gemeint war.
Folgt man Spenglers Biographen und Interpreten Gilbert Merlio, der sich seit Jahrzehnten mit dem Untergang beschäftigt, war der „scheinbar so selbstsichere, apodiktisch schreibende Autor" im praktischen Leben „ein zögerlicher Schwächling, ein weinerlicher Weichling, ein Feigling und Angstvogel" – allerdings einer, der schon als Kind meinte, eine Art Messias werden zu müssen. Spengler, der sich eher als Schriftsteller denn als Philosoph oder Historiker verstand und unter anderem einen Münchner Roman plante – woraus nichts geworden ist –, hatte sich eine geistesaristokratische Aura à la Nietzsche zugelegt und hegte eine unüberwindliche Abscheu vor dem ganz normalen Leben. Vor der Großstadt generell und dem Schwabinger Alltag auch, vor den Frauen sowieso, vor allem aber vor der „Masse" und vor der Unübersichtlichkeit der Moderne.
Der Untergang des Abendlandes sei „unter anderem eine Reaktion auf einen von ihm wahrgenommenen 'information overload'" gewesen, meint Benjamin Gittel. Antidemokratisch und antiliberal war Spengler auf jeden Fall. Er träumte von einem „Imperium Germanicum" mit einem starken Caesar an der Spitze. Der Caesar allerdings, der dann 1933 an die Macht kam, war nun wirklich keiner. „Spengler liebäugelte mit Mussolini, aber verachtete Hitler", fasst Alexander Demandt zusammen. Bald wurde er vom nationalsozialistischen Philosophen Alfred Baeumler auf den Müllhaufen der Ideologen befördert.
Ein sympathischer Zeitgenosse scheint Oswald Spengler nicht gewesen zu sein. 1936 ist er in München gestorben, beigesetzt wurde er auf dem Nordfriedhof. Sein Untergang des Abendlandes wird tatsächlich noch manchmal gelesen, meist mit sehr berechtigter skeptischer Distanz. Wer sich das nicht antun möchte, zitiert wenigstens ab und zu den Buchtitel.
***
Klaus Hübner, Dr. phil., wurde 1953 in Landshut geboren und legte sein Abitur am dortigen Hans-Carossa-Gymnasium ab. Er studierte Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft in Erlangen und München und wurde 1980 mit der Studie Alltag im literarischen Werk. Eine literatursoziologische Studie zu Goethes Werther promoviert. An der Universidad de Deusto in Bilbao (Spanien) war er von 1981 bis 1983 als DAAD-Lektor tätig. Später wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Institut für Deutsch als Fremdsprache und am Institut für Deutsche Philologie der Universität München.
Von 1984 bis 2016 war Hübner Redakteur der monatlich erscheinenden Zeitschrift Fachdienst Germanistik. In den Jahren 1985 bis 1999 war er hauptsächlich für den Münchner iudicium-Verlag tätig. Von 2003 bis 2017 war er außerdem Ständiger Sekretär des Adelbert-von-Chamisso-Preises der Robert Bosch Stiftung und im Zusammenhang damit auch als Journalist und Moderator tätig. Seit 2012 ist Hübner Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Literatur in Bayern, seit 2016 Redaktionsbeirat der Literaturzeitschrift Neue Sirene.
Als Publizist veröffentlichte er zahlreiche Buchkritiken, Autorenporträts und andere Arbeiten in Zeitschriften, Zeitungen und Internetforen sowie mehr als 100 Lexikonartikel, z.B. für Kindlers Neues Literaturlexikon, das Metzler Literatur Lexikon und das von Walther Killy begründete Literaturlexikon. Hübner ist zudem Mitarbeiter am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) der Universität München.
Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Mit einem Nachwort von Detlef Felken, Verlag C.H. Beck, München 1998, 2 Bde., XV1/1271 8.
Detlef Felken: Oswald Spengler. Konservativer Denker zwischen Kaiserreich und Diktatur, Verlag C.H. Beck, München 1988, 304 S.
Gilbert Merlio: Spenglers kleine Untergänge. In: Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft X/4 (Winter 2016), S. 15-27.
Ludwig Marcuse: Nachruf auf Ludwig Marcuse, Paul List Verlag, München 1969. 205 S. (Diogenes-Taschenbuch, Zürich 1975).
Elazar Benyoetz: Was nicht zündet, leuchtet nicht ein. Ein Büchlein vom Menschen und seiner Ausgesprochenheit, Hg. und mit einem Nachwort versehen von Andreas Steffens, NordPark Verlag, Wuppertal 2016, 117 5.
Alexander Demandt: Untergänge des Abendlandes. Studien zu Oswald Spengler, Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2017, 225 S.
Benjamin Gittel: Weltaneignung unter den Bedingungen des »information overload«. Bewältigungsstrategien jenseits von Wissenssynthese und Wissensindexierung bei Montaigne, Spengler und der »Riesenmaschine«. In: KulturPoetik/Journal for Cultural Poetics, Heft 1/2018, S. 90-106.
Externe Links:
Der "Untergang des Abendlandes" wird auch schon 100!
Spiegel bayerischer Literatur und Kultur, fundiert und unterhaltsam, Essays, Prosatexte und Gedichte von prominenten und unbekannten Autoren: Das ist die Zeitschrift Literatur in Bayern. In der 134. Ausgabe beschäftigt sich Publizist Klaus Hübner mit einem speziellen Jubiläum: Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes" wird 100.
*
Selten einmal bleibt ein Buchtitel in aller Munde, wenn das Buch selbst schon fast vergessen ist. 1918, mitten in der Revolutionszeit, erschien in Wien der erste Teil eines monumentalen geschichtsphilosophischen Wälzers: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. „Kein deutsches Werk über Geschichte hat ein ähnlich starkes und anhaltendes Echo gefunden", schreibt der Althistoriker Alexander Demandt im Vorwort seines trotz mancher Redundanzen lesenswerten Essaybands Untergänge des Abendlandes.
Verfasst wurde der von Stefan Zweig, Thomas Mann und zahlreichen anderen Zeitgenossen bald bejubelte Untergang des Abendlandes zwischen 1911 und 1917 von einem 1880 in Blankenburg am Harz geborenen, wegen eines schweren Herzfehlers kriegsuntauglichen Stubenhocker, der als „Privatier" unauffällig in Schwabing hauste – Detlef Felken hat Oswald Spenglers Münchner Jahre detailliert beschrieben.
Der zweite Band des Untergangs erschien 1922 bei C.H. Beck. Das gar nicht so einfach zu lesende Werk erlebte bis 1940 mehr als 70 Auflagen und prägte maßgeblich das Geschichtsbild einer ganzen Generation.
„Kein deutsches Buch der letzten zwanzig Jahre ist noch umkämpft worden wie, vor einem halben Jahrhundert, 'Der Untergang des Abendlandes'", schrieb der bessere Marcuse in seinem Nachruf auf Ludwig Marcuse (1969). Noch vor Kurzem konnte der in der Wiener Neustadt geborene israelische Aphoristiker Elazar Benyoetz lapidar formulieren: „Der Untergang des Abendlandes/ist im Westen nichts Neues". Und jeder wusste, was gemeint war.
Folgt man Spenglers Biographen und Interpreten Gilbert Merlio, der sich seit Jahrzehnten mit dem Untergang beschäftigt, war der „scheinbar so selbstsichere, apodiktisch schreibende Autor" im praktischen Leben „ein zögerlicher Schwächling, ein weinerlicher Weichling, ein Feigling und Angstvogel" – allerdings einer, der schon als Kind meinte, eine Art Messias werden zu müssen. Spengler, der sich eher als Schriftsteller denn als Philosoph oder Historiker verstand und unter anderem einen Münchner Roman plante – woraus nichts geworden ist –, hatte sich eine geistesaristokratische Aura à la Nietzsche zugelegt und hegte eine unüberwindliche Abscheu vor dem ganz normalen Leben. Vor der Großstadt generell und dem Schwabinger Alltag auch, vor den Frauen sowieso, vor allem aber vor der „Masse" und vor der Unübersichtlichkeit der Moderne.
Der Untergang des Abendlandes sei „unter anderem eine Reaktion auf einen von ihm wahrgenommenen 'information overload'" gewesen, meint Benjamin Gittel. Antidemokratisch und antiliberal war Spengler auf jeden Fall. Er träumte von einem „Imperium Germanicum" mit einem starken Caesar an der Spitze. Der Caesar allerdings, der dann 1933 an die Macht kam, war nun wirklich keiner. „Spengler liebäugelte mit Mussolini, aber verachtete Hitler", fasst Alexander Demandt zusammen. Bald wurde er vom nationalsozialistischen Philosophen Alfred Baeumler auf den Müllhaufen der Ideologen befördert.
Ein sympathischer Zeitgenosse scheint Oswald Spengler nicht gewesen zu sein. 1936 ist er in München gestorben, beigesetzt wurde er auf dem Nordfriedhof. Sein Untergang des Abendlandes wird tatsächlich noch manchmal gelesen, meist mit sehr berechtigter skeptischer Distanz. Wer sich das nicht antun möchte, zitiert wenigstens ab und zu den Buchtitel.
***
Klaus Hübner, Dr. phil., wurde 1953 in Landshut geboren und legte sein Abitur am dortigen Hans-Carossa-Gymnasium ab. Er studierte Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft in Erlangen und München und wurde 1980 mit der Studie Alltag im literarischen Werk. Eine literatursoziologische Studie zu Goethes Werther promoviert. An der Universidad de Deusto in Bilbao (Spanien) war er von 1981 bis 1983 als DAAD-Lektor tätig. Später wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Institut für Deutsch als Fremdsprache und am Institut für Deutsche Philologie der Universität München.
Von 1984 bis 2016 war Hübner Redakteur der monatlich erscheinenden Zeitschrift Fachdienst Germanistik. In den Jahren 1985 bis 1999 war er hauptsächlich für den Münchner iudicium-Verlag tätig. Von 2003 bis 2017 war er außerdem Ständiger Sekretär des Adelbert-von-Chamisso-Preises der Robert Bosch Stiftung und im Zusammenhang damit auch als Journalist und Moderator tätig. Seit 2012 ist Hübner Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Literatur in Bayern, seit 2016 Redaktionsbeirat der Literaturzeitschrift Neue Sirene.
Als Publizist veröffentlichte er zahlreiche Buchkritiken, Autorenporträts und andere Arbeiten in Zeitschriften, Zeitungen und Internetforen sowie mehr als 100 Lexikonartikel, z.B. für Kindlers Neues Literaturlexikon, das Metzler Literatur Lexikon und das von Walther Killy begründete Literaturlexikon. Hübner ist zudem Mitarbeiter am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) der Universität München.
Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Mit einem Nachwort von Detlef Felken, Verlag C.H. Beck, München 1998, 2 Bde., XV1/1271 8.
Detlef Felken: Oswald Spengler. Konservativer Denker zwischen Kaiserreich und Diktatur, Verlag C.H. Beck, München 1988, 304 S.
Gilbert Merlio: Spenglers kleine Untergänge. In: Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft X/4 (Winter 2016), S. 15-27.
Ludwig Marcuse: Nachruf auf Ludwig Marcuse, Paul List Verlag, München 1969. 205 S. (Diogenes-Taschenbuch, Zürich 1975).
Elazar Benyoetz: Was nicht zündet, leuchtet nicht ein. Ein Büchlein vom Menschen und seiner Ausgesprochenheit, Hg. und mit einem Nachwort versehen von Andreas Steffens, NordPark Verlag, Wuppertal 2016, 117 5.
Alexander Demandt: Untergänge des Abendlandes. Studien zu Oswald Spengler, Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2017, 225 S.
Benjamin Gittel: Weltaneignung unter den Bedingungen des »information overload«. Bewältigungsstrategien jenseits von Wissenssynthese und Wissensindexierung bei Montaigne, Spengler und der »Riesenmaschine«. In: KulturPoetik/Journal for Cultural Poetics, Heft 1/2018, S. 90-106.