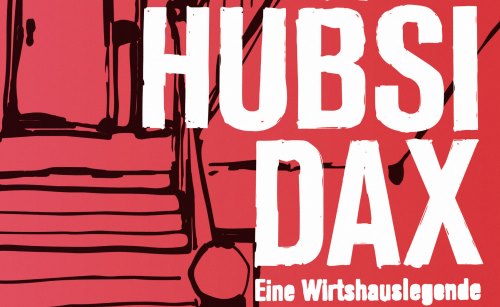Ein Auszug aus dem neuen Roman von Benedikt Feiten
Benedikt Feiten wurde 1982 in Berlin geboren und lebt in München. Er ist mit dem Literaturstipendium der Stadt München ausgezeichnet worden. Nach dem Studium der Amerikanischen Literatur hat er seine Doktorarbeit über Musik in den Filmen von Jim Jarmusch geschrieben und an der Ludwig-Maximilians-Universität unterrichtet. Neben seiner Arbeit als Kulturjournalist und Redakteur ist er Trompeter und Cellist bei der Band „my boys don‘t cry“. Wir veröffentlichen einen Auszug aus seinem neuen Roman Hubsi Dax, der am 10. Oktober im Verlag Voland & Quist erschienen ist.
*
Klappentext
Der Gitarrenlehrer Mark lebt mit seiner Frau Ida und der gemeinsamen Tochter Maja ein harmonisches Leben in einem Flow zufriedener Ambitionslosigkeit. Er schlingert durch seinen Alltag voller verpasster Termine, verbrannter Kuchen, ungeplanter Räusche und gescheiterter Vorhaben. Dass ihm seit Jahren keine eigenen Songs einfallen, stört ihn längst nicht mehr und auch dass sein Viertel sich schleichend gentrifiziert, hat ihn bisher wenig interessiert. Als aber das Haus, in dem er lebt, Luxuswohnungen weichen soll, wächst Trotz in ihm. Um die wenigen verbliebenen umzugsunwilligen Mieter zu vertreiben, denkt sich der Eigentümer immer neue Schikanen aus. Mark entschließt sich, den hausinternen Widerstandsgeist zu wecken und dem Vermieter entgegenzutreten. Könnte der Abriss gestoppt werden, wenn früher jemand von historischer Bedeutung in dem Haus gelebt hätte? Der legendäre Hubsi Dax muss helfen.
*
Kapitel 1
Schon seit drei Stationen erreicht er immer genau dann die Haltestelle, wenn der Bus wieder losfährt. Aber er hat Kampfgeist. Mit hochrotem Kopf rennt er neben dem Bus her. Und das bei der Hitze. Sogar hier im Bus ist es warm, obwohl die Klimaanlage trockene Plastikluft durchbläst und meine Kehle ausdörrt. Ich ziehe an meinem T-Shirt und fächere ein bisschen Luft darunter. Im Spiegel vorne sehe ich das Gesicht des Busfahrers. Riesige, silbern verblendete Sonnenbrille, doppelt gespiegelt die Straße. Mein Blick wandert zwischen ihm und dem Typen draußen hin und her. Die Augen des Busfahrers sind starr geradeaus gerichtet, na ja, soweit man das hinter der Brille beurteilen kann. Zumindest ist die Richtung fixiert, der Nacken unbewegt. Er scheint den Kerl gar nicht wahrzunehmen. Der holt noch mal alles aus sich raus. Verbissener Sprint, tief aus den Knien, bestimmt ein Sportler, Nackenmuskeln kontrahiert, Sehnen treten hervor, mit jedem Schritt eine ruckartige Kopfbewegung. Er findet in seinem letzten Aufbäumen sogar noch die Luft dafür, drohend mit den Fäusten herumzuwedeln, bevor seine Schritte austrudeln und er völlig außer Atem die Hände auf die Knie stützt. Für einen kurzen Moment glaube ich, einen flüchtigen Ausdruck der Zufriedenheit in den Mundwinkeln unter der verspiegelten Sonnenbrille zu erkennen. Dreckstag. Ich bin froh, im Bus zu stehen, auf der richtigen Seite, bei dem Typen mit der Sonnenbrille. Der hat die Kontrolle, Daumen hoch, oder eben runter. Neben ihm steht ein etwa fünfzehnjähriges Mädchen, schwanger. Moment mal, die dicke Mutter neben ihr, der kleine Bruder auch schon mit leichtem Bauchansatz … sie ist gar nicht schwanger, das ist eine normale Entwicklungsstufe, ganz im Rahmen des Familienwachstums. Kolumbusplatz. Ich stehe auf. Der Bus hält abrupt, und ich rutsche mit der verschwitzten Hand fast von der Stange ab.
»Schaug d’an o«, sagt hinter mir ein Sandler zu seinem Saufkumpan, »wo d’Hosn hängt.«
Der andere grinst:
»Hat er d’Hosn voll, ha?«
Sie lachen und prosten sich zu, mit ihren Oettingerflaschen. Ein Komikerduo, eingespielt, geben sich Vorlage, Pointe und auch gleich Applaus, alles im abgeschlossenen Kreis reguliert, selbstgenügend. Und sie nerven mich, nicht wegen des Kommentars, sondern wegen der Ironie. Wegen der Ironie, dass ich wirklich, wirklich dringend aufs Klo muss, und der Witz ist ganz klar zu einfach gestrickt, als dass ich über mich selbst darin lachen könnte. Die Türen gehen auf. Draußen ist es noch viel heißer als im Bus, die Hosenbeine kleben sofort an den Oberschenkeln. Der Bürgersteig ist aufgeheizt, die Außenmauern auch, schwere Haustür aus Holz aufsperren, rein in den modrigen kühlen Flur, dunkel ist es hier drinnen. An den Briefkästen stoße ich fast mit einem der Punker zusammen. Seit Neuestem hausen sie in den schon leer stehenden Wohnungen oder hängen dort rum, leben, wie auch immer.
»Oh, Verzeihung«, sagt er übertrieben höflich, oder vielleicht auch nur höflich, je nachdem, ob er es ironisch gemeint hat.
»Macht nichts.«
Wusste vorher gar nicht, dass es die überhaupt noch gibt, Punker, sieht man ja fast nie in München. Vielleicht sind es ja auch keine Punks, sondern Anarcho-Punks, Pop-Punks oder Post-Punks. Aber der hier wirkt recht klassisch, Prachtexemplar, T-Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln, Sicherheitsnadel im Ohr. Der Fahrstuhl ist kaputt, ich weiß nicht, wie lange schon, gehe die Treppe hoch. Vier Stockwerke alter, schiefer Giesinger Holztreppenstufen, jede ein anderes Knarzen, wie die Klaviatur eines riesigen abgewetzten Xylophons. Eine fremde Skala, nicht in Halbtonschritten organisiert, sondern nach irgendeinem vergessenen System. Mein Gehör ist nicht gut genug ausgebildet, um es zu verstehen. Oben, am Ende der Tonleiter, ein komischer Kerl. Lungert vor meiner Tür rum. Halt, Richtigstellung, er lungert nicht rum, er steht aufrecht da, perfekte Körperspannung, wie ein Statist im Wirbelsäulengymnastik- Video. Vielleicht macht das der Anzug, für den es eigentlich zu heiß ist. Der Typ grinst mich an.
»Da hab ich aber Glück gehabt«, sagt er. Etwas in seiner Stimme klingt, als hätte ich selbst dadurch Pech gehabt.
»Hier, für die Dame des Hauses. Feininger mein Name.«
Eine gelbe Blume, keine Ahnung, was für eine, konnte mir so was noch nie merken. Ich nicke.
»Wie Sie sicher wissen …«, setzt er an, sein Scheitel ist gekämmt, und seine Krawatte hat dieselbe Farbe wie die Blume. Perfekt geputzte Schuhe, man könnte sich drin spiegeln, vielleicht sogar neu. Glatt rasiert, Babyface, randlose Brille, heißt bestimmt nichts Gutes, wenn solche Typen auftauchen.
»Also, was sagen Sie?«, sagt er, wie als Abschluss einer längeren Ausführung.
»Tschuldigung. Hab grad nich aufgepasst.«
Aber nicht schlecht auf Zack der Mann, keine Irritation, das Lächeln hilft ihm wie eine gefrorene Brücke von einem Satz zum nächsten. Er rutscht da einfach drüber.
»Die Kandidatur«, wiederholt er geduldig, »für die Stadtratswahl. Da Sie momentan den Kopf nicht freizuhaben scheinen, wer hat das schon, nicht wahr? So viele Dinge, das Leben ist so hektisch heutzutage … jedenfalls würde ich Ihnen gerne diese Broschüre hierlassen, da können Sie mein Wahlprogramm nachlesen. Einen angenehmen Feierabend wünsche ich.«
Ich nicke schon wieder. Einen angenehmen Feierabend wünscht er, ein waschechter Opportunist, Gott sei Dank hat er nicht noch angefangen, Jugendslang mit jemandem zu reden, der Mitte dreißig ist. Ein Typ, der für die Presse quer durch den Darkroom tollen würde, um zu beweisen, dass er nicht homophob ist. Ich sperre die Tür auf und als ich sie hinter mir schließe, ein misstrauischer Blick durch den Spalt, sehe ich noch, dass er bei den Nachbarn klingelt und sich den Kragen zurechtrückt. Jochen und Sabine. Getöpfertes Namensschild an der Tür, da stehen die Chancen besser. Tür fällt zu, die Welt ist draußen, ich drinnen, gut so. Durchatmen. Die Broschüre schmeiße ich in den Papiermüll, ungelesen wie die Zeitungen, die sich darin stapeln.
Irgendwo hatte ich noch ein Bier, ich bin mir sicher. Aber im Kasten sind nur leere Flaschen, und die füllen ihn auch nur zur Hälfte. Was ist mit den anderen Flaschen passiert? Vielleicht hab ich sie mitgenommen und getrunken, auf dem Weg irgendwohin, und dann abgestellt. Genau, und dann haben sie die Pfandsammler genommen, für acht Cent zurückgebracht. Von den Isarauen, aus den Papierkörben der Bushaltestellen, von den Stromkästen, warum stellt man Bierflaschen eigentlich immer auf diesen Stromkästen ab? Wäre mal was für eine Diplomarbeit in Psychologie, ich sollte eine schreiben. Energiezyklen des 21. Jahrhunderts, Sandlertum an urbanen Verteilungsorten. Zu anstrengend. Besser ein voyeuristisches Fotografieprojekt: Trinker an U-Bahnhöfen und leere Flaschen auf Verteilerkästen. Knotenpunkte. Aber vielleicht ist es auch anders. Ein Zurückbringen. Kühlschrank und Stromkasten, wie Anfang und Ende. Mein Freund, der Kühlschrank, hat jedenfalls noch Käsescheiben, ach ja, und saure Gurken. Kann man gut zusammen essen, Gurken in den Käse einrollen, bestens. Und hinter den Gurken, da grüßt er, quer im Kühlschrank, der Augustinermönch. Ich rolle eine Gurke in eine Käsescheibe und mach das Bier auf. So lässt es sich leben. Auf der Kühlschranktür fällt mir die Werbepostkarte für vegetarische Schnitzel ins Auge: »Nächste Woche wird besser.« Wie lang ist das jetzt her, Majas Geburt? Jeden Tag diese Karte vor Augen, jeden Abend der Gedanke, morgen fang ich an zu schreiben, endlich neue Songs, genug Akkordfolgen gesammelt, genug vage Ideen skizziert. Morgen fange ich an zu schreiben. Eine blasse Erinnerung. Aber bald trägt mich ein kreativer Aufwind, ich ahne es, ich kann die Brise schon spüren. Gleich morgen werde ich anfangen, alles zu ordnen, zu strukturieren, zu formulieren, aber erst brauche ich ein neues Notizbuch, ein hochwertiges, mit schwerem Einband, eines, das sich wie ein Neuanfang anfühlt.
Jemand klingelt an der Tür, es ist Jochen. Jochen, mein Nachbar. Wenn es nicht Jochen wäre, dann hätte ich jemanden auf der Treppe hören müssen.
»Hallo Jochen«, sage ich also, während ich die Tür aufmache, noch bevor ich ihn dastehen sehe, in Polohemd und Leinenhose, mit seinem chronisch leicht geröteten Hals.
»Hallo Mark«, sagt er und grinst, »ein Hellseher? Hast du dir gerade was Leckeres in der Küche gezaubert?«
»Was gezaubert«, so redet Jochen. Jochen redet wie ein Vollidiot. Jochen hat aber anscheinend auch irgendwann mal »tolerant« in einen Selbstauskunftsbogen geschrieben, und seitdem kämpft er täglich um die Berechtigung dafür, nach dem Credo: Tolerant ist man nicht, man muss es jeden Tag aufs Neue werden.
»Kleines Feierabendbierchen?«, fragt er mit Blick auf die Flasche in meiner Hand.
»Ach ja, so’n Bierchen zum Feierabend«, sinniert er und fixiert einen Punkt in der Luft, »vielleicht ’nen kleinen Joint … erinnert mich an meine Studentenzeit.«
Mir fällt nichts ein, was ich darauf antworten könnte. Ich versuche, mir Jochen in der soeben entworfenen Situation vorzustellen: Ich schaffe es nicht.
»Aber jetzt, mit Familie … Weißt ja, wie’s ist, nicht wahr?«
»Ja«, lüge ich – ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, wie es ist.
»Ich wollt’ eigentlich nur fragen«, fährt er fort, »hat die Maja vielleicht die Hausaufgaben mitgebracht? Weil, die Jennifer war heut nicht in der Schule. Krank.«
»Tja, weißt du«, sage ich und kratze mich wie zur Unterstützung am Kopf, »Maja ist noch in der Musikschule. Ida holt sie gerade ab.«
Das macht Jochen nervös.
»Wann kommt sie denn heim? Weil, nachher wird’s vielleicht zu spät für die Jennifer.«
»Meinst du, es ist so schlimm, wenn sie mal die Hausaufgaben nicht macht? Ich mein, wenn sie schon krank ist …«
»Klar, klar, keine Frage«, schneidet mir Jochen das Wort ab und grinst sein bestes Unternehmensberaterlächeln, »ich sag ja bloß, wenn sie in einer halben Stunde nach Hause kommt, kannst du sie ja kurz rüberschicken.«
»Klar, mach ich.«
»Bis morgen dann.«
Wieso bis morgen? Egal. Tür zu, Jochen weg, Bier auf, hinsetzen, ausruhen. Ich lege eine Baden-Powell-Platte auf und setze mich so auf das Sofa, dass ich noch die letzten Sonnenstrahlen abkriege. Ausruhen, oder besser: ruhen. Früher, wenn mein Opa schnarchend im Sessel saß, Kopf nach hinten weggeklappt, offener Mund in Richtung Zimmerdecke, hat Oma immer gesagt: »Vati ruht.« Ich ruhe. Badens Gitarrenläufe gleiten mit meinem Atem dahin, fließen mit der Abendsonne über das Parkett, tief und gleichmäßig. An manchen Stellen ist das hallende Geräusch der Saiten zu hören, wenn Baden umgreift – ein Geräusch, das mir schon vor dem folgenden Akkord ein Gefühl der Sicherheit gibt. Baden als der gute Busfahrer und ich als Passagier, bis der Schlüssel im Schloss geht, Tür auf, Maja und Ida kommen rein.
»Hallo.«
»Hey, na?« Ich geh zur Anlage und stell die Musik ein bisschen leiser. Ida legt die Schlüssel auf der Kommode ab und küsst mich, ihre Lippen sind noch kalt von draußen, dabei war es heute tagsüber so warm, vielleicht reicht der Aufstieg durch das Treppenhaus zum Abkühlen.
»Wie geht’s euch?«, frage ich.
»Wir haben Essen mitgebracht«, sagt Maja, als wäre das die passende Antwort. Vielleicht ist das auch so. Sie zeigt auf zwei Plastiktüten, die auf dem Boden stehen. Ida stellt sie auf den Tisch und zieht drei alubedeckelte Styroporschalen heraus.
»Wir kamen grade am Vietnamesen vorbei«, sagt sie, »und da ist mir eingefallen, dass wir gar nichts mehr im Kühlschrank haben. Ich meine, es sei denn, man steht auf Käse und saure Gurken.«
»Nichts gegen Käse und saure Gurken.«
Ich hole Teller und Gläser, wo ist mein Bier, ah ja, auf dem Couchtisch. Mir fällt Jochen ein, aber ich denke, es ist vertretbar, seine Tochter heute ohne Hausaufgaben ins Bett gehen zu lassen. Zum Einspruch klingelt es schon wieder.
»Wer ist das?«, fragt Ida.
»Jochen. Er hat Angst, dass Jennifer die Hausaufgaben nicht bekommt.«
Maja verdreht die Augen, nimmt ihren Schulranzen und macht die Tür auf.
»Hallo Maja«, höre ich Jochen, »mmh, hier riecht’s aber gut. Chinesisch, oder?«
»Vietnamesisch«, sagt Maja bestimmt, und ich schaue Ida an, sie muss grinsen.
»Ich wollte nur fragen …«, fährt Jochen fort.
»… wegen den Hausaufgaben«, vervollständigt Maja.
»Mark wollte mich schon zu euch rüberschicken.«
Das lernen sie in der Schule, vervollständigen. Dazu sind diese ganzen Lückentexte gut.
»Äh, ja genau.«
»Das sind die beiden Blätter hier«, sagt Maja, »beim zweiten nur die Aufgaben eins bis acht.«
»Eins bis acht. Gut.«
»Ich ringel es ein.« Maja traut ihm nicht zu, sich allzu viel merken zu können. Daran bin wahrscheinlich ich schuld.
»Das ist ja mal ein Service. Also, dankschön, gell? Und guten Appetit.«
»Danke.«
Die Tür fällt ins Schloss. Maja kommt wieder zurück an den Tisch. Ida schüttet ihren Reis auf den Teller um. Sie nimmt einen Bissen und schaut mich komisch an.
»Was ist? Schmeckt es nicht?«, frage ich und merke, sie schaut nicht mich an, sie schaut hinter mich. Sie geht zum Fenster.
*
Ein Auszug aus dem neuen Roman von Benedikt Feiten
Benedikt Feiten wurde 1982 in Berlin geboren und lebt in München. Er ist mit dem Literaturstipendium der Stadt München ausgezeichnet worden. Nach dem Studium der Amerikanischen Literatur hat er seine Doktorarbeit über Musik in den Filmen von Jim Jarmusch geschrieben und an der Ludwig-Maximilians-Universität unterrichtet. Neben seiner Arbeit als Kulturjournalist und Redakteur ist er Trompeter und Cellist bei der Band „my boys don‘t cry“. Wir veröffentlichen einen Auszug aus seinem neuen Roman Hubsi Dax, der am 10. Oktober im Verlag Voland & Quist erschienen ist.
*
Klappentext
Der Gitarrenlehrer Mark lebt mit seiner Frau Ida und der gemeinsamen Tochter Maja ein harmonisches Leben in einem Flow zufriedener Ambitionslosigkeit. Er schlingert durch seinen Alltag voller verpasster Termine, verbrannter Kuchen, ungeplanter Räusche und gescheiterter Vorhaben. Dass ihm seit Jahren keine eigenen Songs einfallen, stört ihn längst nicht mehr und auch dass sein Viertel sich schleichend gentrifiziert, hat ihn bisher wenig interessiert. Als aber das Haus, in dem er lebt, Luxuswohnungen weichen soll, wächst Trotz in ihm. Um die wenigen verbliebenen umzugsunwilligen Mieter zu vertreiben, denkt sich der Eigentümer immer neue Schikanen aus. Mark entschließt sich, den hausinternen Widerstandsgeist zu wecken und dem Vermieter entgegenzutreten. Könnte der Abriss gestoppt werden, wenn früher jemand von historischer Bedeutung in dem Haus gelebt hätte? Der legendäre Hubsi Dax muss helfen.
*
Kapitel 1
Schon seit drei Stationen erreicht er immer genau dann die Haltestelle, wenn der Bus wieder losfährt. Aber er hat Kampfgeist. Mit hochrotem Kopf rennt er neben dem Bus her. Und das bei der Hitze. Sogar hier im Bus ist es warm, obwohl die Klimaanlage trockene Plastikluft durchbläst und meine Kehle ausdörrt. Ich ziehe an meinem T-Shirt und fächere ein bisschen Luft darunter. Im Spiegel vorne sehe ich das Gesicht des Busfahrers. Riesige, silbern verblendete Sonnenbrille, doppelt gespiegelt die Straße. Mein Blick wandert zwischen ihm und dem Typen draußen hin und her. Die Augen des Busfahrers sind starr geradeaus gerichtet, na ja, soweit man das hinter der Brille beurteilen kann. Zumindest ist die Richtung fixiert, der Nacken unbewegt. Er scheint den Kerl gar nicht wahrzunehmen. Der holt noch mal alles aus sich raus. Verbissener Sprint, tief aus den Knien, bestimmt ein Sportler, Nackenmuskeln kontrahiert, Sehnen treten hervor, mit jedem Schritt eine ruckartige Kopfbewegung. Er findet in seinem letzten Aufbäumen sogar noch die Luft dafür, drohend mit den Fäusten herumzuwedeln, bevor seine Schritte austrudeln und er völlig außer Atem die Hände auf die Knie stützt. Für einen kurzen Moment glaube ich, einen flüchtigen Ausdruck der Zufriedenheit in den Mundwinkeln unter der verspiegelten Sonnenbrille zu erkennen. Dreckstag. Ich bin froh, im Bus zu stehen, auf der richtigen Seite, bei dem Typen mit der Sonnenbrille. Der hat die Kontrolle, Daumen hoch, oder eben runter. Neben ihm steht ein etwa fünfzehnjähriges Mädchen, schwanger. Moment mal, die dicke Mutter neben ihr, der kleine Bruder auch schon mit leichtem Bauchansatz … sie ist gar nicht schwanger, das ist eine normale Entwicklungsstufe, ganz im Rahmen des Familienwachstums. Kolumbusplatz. Ich stehe auf. Der Bus hält abrupt, und ich rutsche mit der verschwitzten Hand fast von der Stange ab.
»Schaug d’an o«, sagt hinter mir ein Sandler zu seinem Saufkumpan, »wo d’Hosn hängt.«
Der andere grinst:
»Hat er d’Hosn voll, ha?«
Sie lachen und prosten sich zu, mit ihren Oettingerflaschen. Ein Komikerduo, eingespielt, geben sich Vorlage, Pointe und auch gleich Applaus, alles im abgeschlossenen Kreis reguliert, selbstgenügend. Und sie nerven mich, nicht wegen des Kommentars, sondern wegen der Ironie. Wegen der Ironie, dass ich wirklich, wirklich dringend aufs Klo muss, und der Witz ist ganz klar zu einfach gestrickt, als dass ich über mich selbst darin lachen könnte. Die Türen gehen auf. Draußen ist es noch viel heißer als im Bus, die Hosenbeine kleben sofort an den Oberschenkeln. Der Bürgersteig ist aufgeheizt, die Außenmauern auch, schwere Haustür aus Holz aufsperren, rein in den modrigen kühlen Flur, dunkel ist es hier drinnen. An den Briefkästen stoße ich fast mit einem der Punker zusammen. Seit Neuestem hausen sie in den schon leer stehenden Wohnungen oder hängen dort rum, leben, wie auch immer.
»Oh, Verzeihung«, sagt er übertrieben höflich, oder vielleicht auch nur höflich, je nachdem, ob er es ironisch gemeint hat.
»Macht nichts.«
Wusste vorher gar nicht, dass es die überhaupt noch gibt, Punker, sieht man ja fast nie in München. Vielleicht sind es ja auch keine Punks, sondern Anarcho-Punks, Pop-Punks oder Post-Punks. Aber der hier wirkt recht klassisch, Prachtexemplar, T-Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln, Sicherheitsnadel im Ohr. Der Fahrstuhl ist kaputt, ich weiß nicht, wie lange schon, gehe die Treppe hoch. Vier Stockwerke alter, schiefer Giesinger Holztreppenstufen, jede ein anderes Knarzen, wie die Klaviatur eines riesigen abgewetzten Xylophons. Eine fremde Skala, nicht in Halbtonschritten organisiert, sondern nach irgendeinem vergessenen System. Mein Gehör ist nicht gut genug ausgebildet, um es zu verstehen. Oben, am Ende der Tonleiter, ein komischer Kerl. Lungert vor meiner Tür rum. Halt, Richtigstellung, er lungert nicht rum, er steht aufrecht da, perfekte Körperspannung, wie ein Statist im Wirbelsäulengymnastik- Video. Vielleicht macht das der Anzug, für den es eigentlich zu heiß ist. Der Typ grinst mich an.
»Da hab ich aber Glück gehabt«, sagt er. Etwas in seiner Stimme klingt, als hätte ich selbst dadurch Pech gehabt.
»Hier, für die Dame des Hauses. Feininger mein Name.«
Eine gelbe Blume, keine Ahnung, was für eine, konnte mir so was noch nie merken. Ich nicke.
»Wie Sie sicher wissen …«, setzt er an, sein Scheitel ist gekämmt, und seine Krawatte hat dieselbe Farbe wie die Blume. Perfekt geputzte Schuhe, man könnte sich drin spiegeln, vielleicht sogar neu. Glatt rasiert, Babyface, randlose Brille, heißt bestimmt nichts Gutes, wenn solche Typen auftauchen.
»Also, was sagen Sie?«, sagt er, wie als Abschluss einer längeren Ausführung.
»Tschuldigung. Hab grad nich aufgepasst.«
Aber nicht schlecht auf Zack der Mann, keine Irritation, das Lächeln hilft ihm wie eine gefrorene Brücke von einem Satz zum nächsten. Er rutscht da einfach drüber.
»Die Kandidatur«, wiederholt er geduldig, »für die Stadtratswahl. Da Sie momentan den Kopf nicht freizuhaben scheinen, wer hat das schon, nicht wahr? So viele Dinge, das Leben ist so hektisch heutzutage … jedenfalls würde ich Ihnen gerne diese Broschüre hierlassen, da können Sie mein Wahlprogramm nachlesen. Einen angenehmen Feierabend wünsche ich.«
Ich nicke schon wieder. Einen angenehmen Feierabend wünscht er, ein waschechter Opportunist, Gott sei Dank hat er nicht noch angefangen, Jugendslang mit jemandem zu reden, der Mitte dreißig ist. Ein Typ, der für die Presse quer durch den Darkroom tollen würde, um zu beweisen, dass er nicht homophob ist. Ich sperre die Tür auf und als ich sie hinter mir schließe, ein misstrauischer Blick durch den Spalt, sehe ich noch, dass er bei den Nachbarn klingelt und sich den Kragen zurechtrückt. Jochen und Sabine. Getöpfertes Namensschild an der Tür, da stehen die Chancen besser. Tür fällt zu, die Welt ist draußen, ich drinnen, gut so. Durchatmen. Die Broschüre schmeiße ich in den Papiermüll, ungelesen wie die Zeitungen, die sich darin stapeln.
Irgendwo hatte ich noch ein Bier, ich bin mir sicher. Aber im Kasten sind nur leere Flaschen, und die füllen ihn auch nur zur Hälfte. Was ist mit den anderen Flaschen passiert? Vielleicht hab ich sie mitgenommen und getrunken, auf dem Weg irgendwohin, und dann abgestellt. Genau, und dann haben sie die Pfandsammler genommen, für acht Cent zurückgebracht. Von den Isarauen, aus den Papierkörben der Bushaltestellen, von den Stromkästen, warum stellt man Bierflaschen eigentlich immer auf diesen Stromkästen ab? Wäre mal was für eine Diplomarbeit in Psychologie, ich sollte eine schreiben. Energiezyklen des 21. Jahrhunderts, Sandlertum an urbanen Verteilungsorten. Zu anstrengend. Besser ein voyeuristisches Fotografieprojekt: Trinker an U-Bahnhöfen und leere Flaschen auf Verteilerkästen. Knotenpunkte. Aber vielleicht ist es auch anders. Ein Zurückbringen. Kühlschrank und Stromkasten, wie Anfang und Ende. Mein Freund, der Kühlschrank, hat jedenfalls noch Käsescheiben, ach ja, und saure Gurken. Kann man gut zusammen essen, Gurken in den Käse einrollen, bestens. Und hinter den Gurken, da grüßt er, quer im Kühlschrank, der Augustinermönch. Ich rolle eine Gurke in eine Käsescheibe und mach das Bier auf. So lässt es sich leben. Auf der Kühlschranktür fällt mir die Werbepostkarte für vegetarische Schnitzel ins Auge: »Nächste Woche wird besser.« Wie lang ist das jetzt her, Majas Geburt? Jeden Tag diese Karte vor Augen, jeden Abend der Gedanke, morgen fang ich an zu schreiben, endlich neue Songs, genug Akkordfolgen gesammelt, genug vage Ideen skizziert. Morgen fange ich an zu schreiben. Eine blasse Erinnerung. Aber bald trägt mich ein kreativer Aufwind, ich ahne es, ich kann die Brise schon spüren. Gleich morgen werde ich anfangen, alles zu ordnen, zu strukturieren, zu formulieren, aber erst brauche ich ein neues Notizbuch, ein hochwertiges, mit schwerem Einband, eines, das sich wie ein Neuanfang anfühlt.
Jemand klingelt an der Tür, es ist Jochen. Jochen, mein Nachbar. Wenn es nicht Jochen wäre, dann hätte ich jemanden auf der Treppe hören müssen.
»Hallo Jochen«, sage ich also, während ich die Tür aufmache, noch bevor ich ihn dastehen sehe, in Polohemd und Leinenhose, mit seinem chronisch leicht geröteten Hals.
»Hallo Mark«, sagt er und grinst, »ein Hellseher? Hast du dir gerade was Leckeres in der Küche gezaubert?«
»Was gezaubert«, so redet Jochen. Jochen redet wie ein Vollidiot. Jochen hat aber anscheinend auch irgendwann mal »tolerant« in einen Selbstauskunftsbogen geschrieben, und seitdem kämpft er täglich um die Berechtigung dafür, nach dem Credo: Tolerant ist man nicht, man muss es jeden Tag aufs Neue werden.
»Kleines Feierabendbierchen?«, fragt er mit Blick auf die Flasche in meiner Hand.
»Ach ja, so’n Bierchen zum Feierabend«, sinniert er und fixiert einen Punkt in der Luft, »vielleicht ’nen kleinen Joint … erinnert mich an meine Studentenzeit.«
Mir fällt nichts ein, was ich darauf antworten könnte. Ich versuche, mir Jochen in der soeben entworfenen Situation vorzustellen: Ich schaffe es nicht.
»Aber jetzt, mit Familie … Weißt ja, wie’s ist, nicht wahr?«
»Ja«, lüge ich – ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, wie es ist.
»Ich wollt’ eigentlich nur fragen«, fährt er fort, »hat die Maja vielleicht die Hausaufgaben mitgebracht? Weil, die Jennifer war heut nicht in der Schule. Krank.«
»Tja, weißt du«, sage ich und kratze mich wie zur Unterstützung am Kopf, »Maja ist noch in der Musikschule. Ida holt sie gerade ab.«
Das macht Jochen nervös.
»Wann kommt sie denn heim? Weil, nachher wird’s vielleicht zu spät für die Jennifer.«
»Meinst du, es ist so schlimm, wenn sie mal die Hausaufgaben nicht macht? Ich mein, wenn sie schon krank ist …«
»Klar, klar, keine Frage«, schneidet mir Jochen das Wort ab und grinst sein bestes Unternehmensberaterlächeln, »ich sag ja bloß, wenn sie in einer halben Stunde nach Hause kommt, kannst du sie ja kurz rüberschicken.«
»Klar, mach ich.«
»Bis morgen dann.«
Wieso bis morgen? Egal. Tür zu, Jochen weg, Bier auf, hinsetzen, ausruhen. Ich lege eine Baden-Powell-Platte auf und setze mich so auf das Sofa, dass ich noch die letzten Sonnenstrahlen abkriege. Ausruhen, oder besser: ruhen. Früher, wenn mein Opa schnarchend im Sessel saß, Kopf nach hinten weggeklappt, offener Mund in Richtung Zimmerdecke, hat Oma immer gesagt: »Vati ruht.« Ich ruhe. Badens Gitarrenläufe gleiten mit meinem Atem dahin, fließen mit der Abendsonne über das Parkett, tief und gleichmäßig. An manchen Stellen ist das hallende Geräusch der Saiten zu hören, wenn Baden umgreift – ein Geräusch, das mir schon vor dem folgenden Akkord ein Gefühl der Sicherheit gibt. Baden als der gute Busfahrer und ich als Passagier, bis der Schlüssel im Schloss geht, Tür auf, Maja und Ida kommen rein.
»Hallo.«
»Hey, na?« Ich geh zur Anlage und stell die Musik ein bisschen leiser. Ida legt die Schlüssel auf der Kommode ab und küsst mich, ihre Lippen sind noch kalt von draußen, dabei war es heute tagsüber so warm, vielleicht reicht der Aufstieg durch das Treppenhaus zum Abkühlen.
»Wie geht’s euch?«, frage ich.
»Wir haben Essen mitgebracht«, sagt Maja, als wäre das die passende Antwort. Vielleicht ist das auch so. Sie zeigt auf zwei Plastiktüten, die auf dem Boden stehen. Ida stellt sie auf den Tisch und zieht drei alubedeckelte Styroporschalen heraus.
»Wir kamen grade am Vietnamesen vorbei«, sagt sie, »und da ist mir eingefallen, dass wir gar nichts mehr im Kühlschrank haben. Ich meine, es sei denn, man steht auf Käse und saure Gurken.«
»Nichts gegen Käse und saure Gurken.«
Ich hole Teller und Gläser, wo ist mein Bier, ah ja, auf dem Couchtisch. Mir fällt Jochen ein, aber ich denke, es ist vertretbar, seine Tochter heute ohne Hausaufgaben ins Bett gehen zu lassen. Zum Einspruch klingelt es schon wieder.
»Wer ist das?«, fragt Ida.
»Jochen. Er hat Angst, dass Jennifer die Hausaufgaben nicht bekommt.«
Maja verdreht die Augen, nimmt ihren Schulranzen und macht die Tür auf.
»Hallo Maja«, höre ich Jochen, »mmh, hier riecht’s aber gut. Chinesisch, oder?«
»Vietnamesisch«, sagt Maja bestimmt, und ich schaue Ida an, sie muss grinsen.
»Ich wollte nur fragen …«, fährt Jochen fort.
»… wegen den Hausaufgaben«, vervollständigt Maja.
»Mark wollte mich schon zu euch rüberschicken.«
Das lernen sie in der Schule, vervollständigen. Dazu sind diese ganzen Lückentexte gut.
»Äh, ja genau.«
»Das sind die beiden Blätter hier«, sagt Maja, »beim zweiten nur die Aufgaben eins bis acht.«
»Eins bis acht. Gut.«
»Ich ringel es ein.« Maja traut ihm nicht zu, sich allzu viel merken zu können. Daran bin wahrscheinlich ich schuld.
»Das ist ja mal ein Service. Also, dankschön, gell? Und guten Appetit.«
»Danke.«
Die Tür fällt ins Schloss. Maja kommt wieder zurück an den Tisch. Ida schüttet ihren Reis auf den Teller um. Sie nimmt einen Bissen und schaut mich komisch an.
»Was ist? Schmeckt es nicht?«, frage ich und merke, sie schaut nicht mich an, sie schaut hinter mich. Sie geht zum Fenster.
*