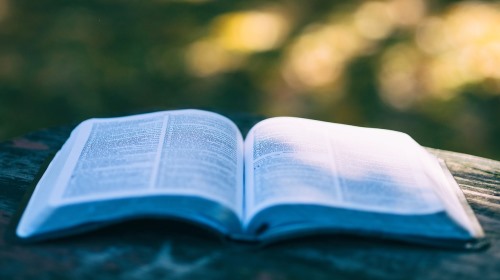Ein Wieland-Vortrag in Kaufbeuren
Vor dem Hintergrund der vielfachen Wechselbeziehungen zwischen Christoph Martin Wieland, seiner Kaufbeurer Cousine und Verlobten Sophie La Roche und anderer Kaufbeurer Familien, war Kerstin Buchwald M. A. aus Biberach als Geschäftsführerin der Wieland Stiftung erneut als Referentin beim Freundeskreises Sophie La Roche e. V. in Kaufbeuren. Die Vortragsveranstaltung bildete auch die regelmäßige Jahresabschluss-Veranstaltung des Freundeskreises, die immer im zeitlichen Umfeld des Geburtstages der Sophie Gutermann stattfindet. Nach der Begrüßung durch Gerd F. Thomae berichtete die Referentin über die aus Anlass des 200. Todestages von Wieland, dem ehemaligen Verlobten von Sophie La Roche durchgeführten Erinnerungsveranstaltungen. Allein aus diesem Grunde bildet der Vortrag auch eine weitere sinnfällige Erinnerung an den 200. Todestag von Wieland, der am Geburtsort der ersten deutschsprachigen Romanautorin, die auch im weiteren Verlauf ihres Lebens mit Wieland immer wieder in Verbindung stand, zum Ausdruck kommt.
Kerstin Buchwald stellte sich der Aufgabe, Wieland als „modernen Denker“ zu vermitteln. Diese Bewertung wird zum einen bereits dadurch deutlich, dass er der erste war, der Shakespeare in die deutsche Sprache übersetzte, den deutschen Bildungsroman etablierte, die Epoche „Weimarer Klassik“ begründete, Märchen literarisierte, die Novellendefinition schuf und den Begriff der „Weltliteratur“ prägte. Wieland, der Aufklärer und moderne Denker bezeichnete sich und gab sich und selbst schon als „Weltbürger“. Viele seiner Verlautbarungen, so beispielsweise „Leben und leben lassen“ geben Hinweis auf das „Toleranzgebot“, sein Begriff „Politbarometer“ ist aus der Tagesaktualität des 21. Jahrhundert nicht mehr wegzudenken; die Volksweisheit „Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen“ gehören zum täglichen Sprachgebrauch.
Zum anderen war Wieland einer der großen Vorkämpfer für die Presse- und Meinungsfreiheit. Nachdem sich etwa bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts eine wahre „Zeitschriften- und Lese-Revolution“ und ein Publikationsboom einsetzten, reifte die Überzeugung, dass die Freiheit des Wortes besser sei als eine Beschränkung der Presse. Aus dieser Erkenntnis heraus entstand dann der Begriff der „Pressefreiheit“. Die „Zensur“, die zwar nicht abgeschafft war, wurde allgemein immer mehr zurückgewiesen und sogar in den Karlsbader Beschlüssen von 1819, bei denen es vor allem um die Überwachung liberaler und nationaler Bestrebungen in der nach-napoleonischen Zeit ging, gemieden. Wieland, Herausgeber der wohl bedeutendsten Kulturzeitschrift des 18. Jahrhunderts, des Teutschen Merkur, leitete die Pressefreiheit interessanterweise nicht vom formalen Verfassungsrecht ab sondern stufte den Grundsatz „Der Mensch als Vernunftwesen hat ein Recht auf Erkenntnis und Wahrheit“ noch höher ein.
Wieland setzte sich allerdings von den radikalen Aufklärern ab, indem er auch Grenzen der Meinungs- und Pressefreiheit definierte, die u. a. darin bestehen, einerseits nicht zum Umsturz aufzurufen und andererseits nicht beleidigend zu wirken. Allzu scharfe Kritik am bestehenden System war ihm zuwider, da diese nach seiner Auffassung auch destruktive Kräfte freisetze, wie diese auch im Verlauf der französischen Revolution zu beobachten waren. Wieland war stets bemüht, seinen Lesern keine abschließenden Wahrheiten zu vermitteln, sondern vielmehr anzuregen, die eigene Urteilskraft der Leser anzuregen. Er vertrat dabei die Auffassung, dass der jeweilige Leser in der Lage sein muss, sich auf der Grundlage einer sachlichen Berichterstattung selbst ein Urteil über die politischen und gesellschaftlichen Zustände und Zusammenhänge bilden zu können. Als erste Pflichten der Autoren nannte er deren „Wahrhaftigkeit“ und „Unparteilichkeit“ – mithin auch die hehren Aufgaben des klassischen Journalismus. Kerstin Buchwald schlug dabei auch einen aktuellen Bogen zur heutigen Zeit, in der zunehmend eine eher profane „Klickfabrik“ das meinungsbildende Geschehen bestimme. Sie stellte diese Entwicklung anhand der Merkmale „schneller, aggressiver, emotionaler“ dar, wobei diese Erscheinungsformen der Online-Welt des 21. Jahrhunderts die Medienlandschaft bereits radikal verändert haben und noch weiter verändern werden. Die Referentin schloss ihr eindrucksvolles Referat, mit einem Wieland-Zitat: „Ich bin ein Chamäleon. Ich scheine grün gegenüber grünen Gegenständen und gelb gegenüber gelben Gegenständen. Aber ich bin weder grün noch gelb. Ich bin durchscheinen oder weiß.“
Ein Wieland-Vortrag in Kaufbeuren
Vor dem Hintergrund der vielfachen Wechselbeziehungen zwischen Christoph Martin Wieland, seiner Kaufbeurer Cousine und Verlobten Sophie La Roche und anderer Kaufbeurer Familien, war Kerstin Buchwald M. A. aus Biberach als Geschäftsführerin der Wieland Stiftung erneut als Referentin beim Freundeskreises Sophie La Roche e. V. in Kaufbeuren. Die Vortragsveranstaltung bildete auch die regelmäßige Jahresabschluss-Veranstaltung des Freundeskreises, die immer im zeitlichen Umfeld des Geburtstages der Sophie Gutermann stattfindet. Nach der Begrüßung durch Gerd F. Thomae berichtete die Referentin über die aus Anlass des 200. Todestages von Wieland, dem ehemaligen Verlobten von Sophie La Roche durchgeführten Erinnerungsveranstaltungen. Allein aus diesem Grunde bildet der Vortrag auch eine weitere sinnfällige Erinnerung an den 200. Todestag von Wieland, der am Geburtsort der ersten deutschsprachigen Romanautorin, die auch im weiteren Verlauf ihres Lebens mit Wieland immer wieder in Verbindung stand, zum Ausdruck kommt.
Kerstin Buchwald stellte sich der Aufgabe, Wieland als „modernen Denker“ zu vermitteln. Diese Bewertung wird zum einen bereits dadurch deutlich, dass er der erste war, der Shakespeare in die deutsche Sprache übersetzte, den deutschen Bildungsroman etablierte, die Epoche „Weimarer Klassik“ begründete, Märchen literarisierte, die Novellendefinition schuf und den Begriff der „Weltliteratur“ prägte. Wieland, der Aufklärer und moderne Denker bezeichnete sich und gab sich und selbst schon als „Weltbürger“. Viele seiner Verlautbarungen, so beispielsweise „Leben und leben lassen“ geben Hinweis auf das „Toleranzgebot“, sein Begriff „Politbarometer“ ist aus der Tagesaktualität des 21. Jahrhundert nicht mehr wegzudenken; die Volksweisheit „Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen“ gehören zum täglichen Sprachgebrauch.
Zum anderen war Wieland einer der großen Vorkämpfer für die Presse- und Meinungsfreiheit. Nachdem sich etwa bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts eine wahre „Zeitschriften- und Lese-Revolution“ und ein Publikationsboom einsetzten, reifte die Überzeugung, dass die Freiheit des Wortes besser sei als eine Beschränkung der Presse. Aus dieser Erkenntnis heraus entstand dann der Begriff der „Pressefreiheit“. Die „Zensur“, die zwar nicht abgeschafft war, wurde allgemein immer mehr zurückgewiesen und sogar in den Karlsbader Beschlüssen von 1819, bei denen es vor allem um die Überwachung liberaler und nationaler Bestrebungen in der nach-napoleonischen Zeit ging, gemieden. Wieland, Herausgeber der wohl bedeutendsten Kulturzeitschrift des 18. Jahrhunderts, des Teutschen Merkur, leitete die Pressefreiheit interessanterweise nicht vom formalen Verfassungsrecht ab sondern stufte den Grundsatz „Der Mensch als Vernunftwesen hat ein Recht auf Erkenntnis und Wahrheit“ noch höher ein.
Wieland setzte sich allerdings von den radikalen Aufklärern ab, indem er auch Grenzen der Meinungs- und Pressefreiheit definierte, die u. a. darin bestehen, einerseits nicht zum Umsturz aufzurufen und andererseits nicht beleidigend zu wirken. Allzu scharfe Kritik am bestehenden System war ihm zuwider, da diese nach seiner Auffassung auch destruktive Kräfte freisetze, wie diese auch im Verlauf der französischen Revolution zu beobachten waren. Wieland war stets bemüht, seinen Lesern keine abschließenden Wahrheiten zu vermitteln, sondern vielmehr anzuregen, die eigene Urteilskraft der Leser anzuregen. Er vertrat dabei die Auffassung, dass der jeweilige Leser in der Lage sein muss, sich auf der Grundlage einer sachlichen Berichterstattung selbst ein Urteil über die politischen und gesellschaftlichen Zustände und Zusammenhänge bilden zu können. Als erste Pflichten der Autoren nannte er deren „Wahrhaftigkeit“ und „Unparteilichkeit“ – mithin auch die hehren Aufgaben des klassischen Journalismus. Kerstin Buchwald schlug dabei auch einen aktuellen Bogen zur heutigen Zeit, in der zunehmend eine eher profane „Klickfabrik“ das meinungsbildende Geschehen bestimme. Sie stellte diese Entwicklung anhand der Merkmale „schneller, aggressiver, emotionaler“ dar, wobei diese Erscheinungsformen der Online-Welt des 21. Jahrhunderts die Medienlandschaft bereits radikal verändert haben und noch weiter verändern werden. Die Referentin schloss ihr eindrucksvolles Referat, mit einem Wieland-Zitat: „Ich bin ein Chamäleon. Ich scheine grün gegenüber grünen Gegenständen und gelb gegenüber gelben Gegenständen. Aber ich bin weder grün noch gelb. Ich bin durchscheinen oder weiß.“