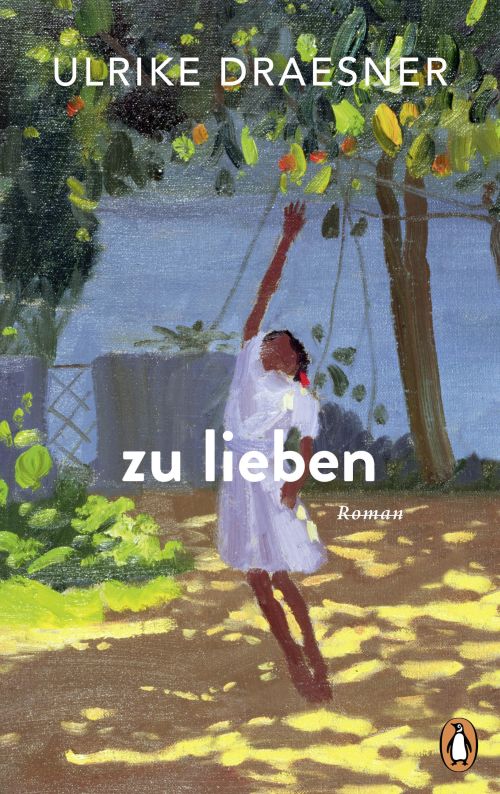Ulrike Draesners autobiographische Erzählung „zu lieben“
Ulrike Draesner, im Klappentext wohl nicht zu Unrecht als „eine der bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen der Gegenwart“ (Times Literary Supplement) bezeichnet, tritt in ihrem aktuellen Prosawerk zu lieben, erschienen im Penguin Verlag, als Autorin und Ich-Erzählerin in Personalunion auf. Rückblickend erzählt sie von der Adoption ihrer Tochter Mary – ein langer, mühevoller Prozess mit allen nur vorstellbaren emotionalen Hoch- und Tiefpunkten. Über weite Strecken des Textes werden die Ereignisse auf der Insel Sri Lanka erinnert, von der die Ich-Erzählerin und ihr Ehemann, hier mit dem Namen Hunter, die kleine Mary nach ausufernden Phasen des Kennenlernens und zahlreichen bürokratischen Hindernissen schließlich mit sich nach Deutschland nehmen können – ins kontrapunktisch gestaltete Berlin, das in vergleichsweise knappen Episoden geschildert wird.
*
Schonungslose Darstellung des eigenen Ichs
Ulrike Draesner legt auf sehr direkte, schonungslose Art Zeugnis ab von ihren inneren Kämpfen, der Adoption vorangehenden Enttäuschungen („Ich war eine traurige Frau. (…) Ich war eine unfruchtbare Frau.“ (S. 31)) und immer wieder aufkommenden Irritationen und Zweifeln während des Adoptionsverfahrens: „Mary rief nicht einmal das Kindchenschema ab, auf das wir getrimmt waren. Bestenfalls halb“ (S. 98). Zurückliegende Schwangerschaften und die Brutalität einer Totgeburt werden ebenso thematisiert wie die Schuldgefühle des Ehepaars (vgl. S.48ff.). Bei allen Schwierigkeiten und aller Schwermut, die ihre Bemühungen um die Adoption des Kindes begleiten, wird die Erzählerin doch auch immer wieder bemerkenswert selbstironisch, was das mütterliche Reflexionsniveau hervorhebt und dem Text trotz seiner Ernsthaftigkeit beinahe einen gewissen Unterhaltungswert verleiht: „(…) Begeisterung (Kind), Sorge (Bakterien), Zweifeln (meine Zukunft als Kriechtier) und Dummheit“ (S. 232).
Formale Experimente: Ein Spiel mit den Genres
Im Hinblick auf die formale Gestaltung finden sich in zu lieben einige interessante Auffälligkeiten. So ist die Gattungsbezeichnung „Roman“ auf dem Buchcover durchgestrichen. Beim vorliegenden Werk scheint es sich also um einen genreübergreifenden Text zu handeln, der in der Form eines Romans erzählt ist, jedoch gleichzeitig die ungeschminkt wahre Geschichte der Ich-Erzählerin in präziser autobiographischer Wiedergabe zum Inhalt hat. Streichungen einzelner Wörter oder Phrasen finden sich auch gelegentlich im Verlauf des Textes, etwa auf den Seiten 7 und 9, was für ein höchst ernsthaftes Ringen um die Wahrhaftigkeit des eigenen Ausdrucks stehen mag, und gleichermaßen die formale Schnoddrigkeit eines lediglich zur Selbstbesinnung geführten Tagebuchs nachahmt. Dieser Eindruck wird zusätzlich durch die Vignetten verstärkt, die vielen Kapiteln vorangestellt sind, und die „Tabelle der verborgenen Zweifel“ auf S. 21, eine Art notizhafte Erörterung in Stichpunkten.
In kühlem Erzählbericht liefert die Autorin/Erzählerin zahlreiche Fakten des eigenen Lebens oder der Lebensumstände auf Sri Lanka: „Wir wussten es. Zwölf Jahre alt war die Mutter unseres Kindes gewesen, als sie schwanger wurde“ (S. 80). Kontrastiv zu diesen unkommentierten, in seiner Nacktheit schockierenden Tatsachen widmet sich die Erzählerin – und hier fühlt sich der Leser wiederum als Teil eines Romansettings – der ausgiebigen Schilderung ihrer Wahrnehmung Sri Lankas, eine hochpoetische Ansammlung von zahllosen Sinneseindrücken (am eindringlichsten der Geruch) und Leitmotiven aus dem Bereich der Natur bzw. der Tierwelt und urbanen Erfahrungen. Besonders hervorgehoben sei hier der wiederkehrende Gesang des indischen Kuckucks (z. B. S. 167), dessen hinlänglich bekannte Ablehnung der eigenen Brut als Kontra-Punkt zu den Bemühungen der Erzählerin um Nachkommenschaft verstanden werden könnte. Aus europäischer Sicht befremdend scheint die Rolle, die das Meer aus Sri Lanka spielt: Man hinterlässt Unrat und Kot am Strand und niemand geht schwimmen (vgl. S. 75 und S. 160ff.).
Sri Lanka unmittelbar nach dem Bürgerkrieg
Die im Text nicht namentlich genannte, freilich mit der Autorin Ulrike Draesner identische Ich-Erzählerin reist mit ihrem Mann Hunter, dessen fiktiver Name sich irgendwann auf traurige Art und Weise begründet, nach Sri Lanka, um die die dreijährige Mary zu adoptieren, die dort in einem Kinderheim, den defizitären Umständen entsprechend, mehr oder weniger gut versorgt von Ordensschwestern, neben anderen, häufig auch behinderten Kindern ihr Dasein fristet und motorisch unterentwickelt ist. Entgegen der landläufigen Vorstellung adoptionsunerfahrener Menschen kann das Ehepaar das kleine Mädchen nicht einfach mitnehmen, sondern die neuen Eltern und das Kind sollen in einem wochenlangen Prozess des gegenseitigen Kennenlernens erst aneinander gewöhnt werden – ehe eine endgültige Entscheidung über die Adoption fällt. Diese trifft dann ein Richter in einem völlig überfüllten Gerichtssaal. Die bürokratischen Hürden wirken kaum überwindbar, und nur dank der Hilfe Heidis, einer aus Deutschland stammenden Adoptionsvermittlerin von leicht zweifelhaftem Charakter, bei der das Ehepaar vorübergehend wohnt, wird die Adoption Marys – „Ich“ und Hunter müssen dabei zahlreiche Verhaltensregeln penibel genau einhalten – schließlich bewilligt.
Auf Sri Lanka ging am Tag vor der Ankunft des Berliner Ehepaars gerade der Bürgerkrieg zu Ende, und die Atmosphäre auf der Insel ist massiv von seinen Nachwehen geprägt, die Ulrike Draesner sehr eindringlich darstellt: „Was waren wir naiv. Kriege endeten nicht wie im Film: ‚Klappe Krieg zu‘, ‚Klappe Frieden auf‘. Sie fransten aus, versickerten allmählich, man musste sich als ‚Volk‘ die Kriegsgewohnheiten erst wieder abtrainieren, das war der beste Fall. Im schlechtesten Fall wurden diese Gewohnheiten erst einmal härter, obwohl sie ‚Frieden‘ hießen, weil die siegende Partei nun ‚durchgriff‘ und ‚aufräumte‘ und Gegner suchte“ (S. 175). So herrscht auf den Straßen Colombos eine allgegenwärtige Bedrohung, die schwer auf der Psyche der deutschen Besucher lastet. Auch im Gerichtssaal wimmelt es von schwer bewaffneten Männern, denen der Griff zum Gewehr jederzeit zuzutrauen ist: „Ich wusste, dass wirkliche Kugeln in den Läufen der auf uns gerichteten Gewehre steckten und dass ein Abzug ein Abzug ist und ein Trigger ein Trigger und ein Finger nervös“ (S. 194).
Annäherung und Rückzug
Im Zuge der emotionalen Zuwendung zu Mary, die diese nur in kleinen Schüben und mit vielen Rückschritten zulässt, kommt es zu einer allmählichen Entfremdung des Ehepaars. Nach und nach fokussiert sich das Mädchen intuitiv mehr auf den von der Autorin hinsichtlich seiner Geschlechterrolle sehr differenziert erinnerten Hunter, was neben der Tatsache, dass Frau und Mann mittlerweile ausschließlich mit den Angelegenheiten der Adoption befasst sind, auch einen Teil zum Auseinanderleben des Ehepaars beitragen mag: „Ab sofort durfte Hunter Mary berühren. Hunter wurde Marys Ersatz-große-Schwester. Hunter. Und nur Hunter. Akka-Hunter. Ich stand daneben und schaute zu“ (S. 217). Betont sei aber erneut, dass die Ich-Erzählerin keine Ressentiments gegen Hunter hegt und ihre Entfremdung als einen gegenseitigen Vorgang zeigt.
Auch die übrigen Figuren der autobiographischen Erzählung werden selbst in ihren Nebenrollen präzise gezeichnet und bei der Bewältigung ihrer Lebensaufgaben und den damit verbundenen Nöten sehr plastisch vor dem Auge des Lesers: Heidi, die Vermittlerin, Ordensschwestern, weitere Kinder, deren Schicksal wesentlich ungünstiger verlaufen dürfte, als dasjenige Marys, Taxifahrer, Soldaten.
Alles in allem beeindruckt Ulrike Draesners zu lieben durch die sprachliche Brillanz, mit der sie verschiedenste Register zieht, die Eindringlichkeit und Schonungslosigkeit der Darstellung sowie die poetische Qualität, die sie dem menschlich so schwierigen Thema abgewinnt.
Ulrike Draesners autobiographische Erzählung „zu lieben“
Ulrike Draesner, im Klappentext wohl nicht zu Unrecht als „eine der bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen der Gegenwart“ (Times Literary Supplement) bezeichnet, tritt in ihrem aktuellen Prosawerk zu lieben, erschienen im Penguin Verlag, als Autorin und Ich-Erzählerin in Personalunion auf. Rückblickend erzählt sie von der Adoption ihrer Tochter Mary – ein langer, mühevoller Prozess mit allen nur vorstellbaren emotionalen Hoch- und Tiefpunkten. Über weite Strecken des Textes werden die Ereignisse auf der Insel Sri Lanka erinnert, von der die Ich-Erzählerin und ihr Ehemann, hier mit dem Namen Hunter, die kleine Mary nach ausufernden Phasen des Kennenlernens und zahlreichen bürokratischen Hindernissen schließlich mit sich nach Deutschland nehmen können – ins kontrapunktisch gestaltete Berlin, das in vergleichsweise knappen Episoden geschildert wird.
*
Schonungslose Darstellung des eigenen Ichs
Ulrike Draesner legt auf sehr direkte, schonungslose Art Zeugnis ab von ihren inneren Kämpfen, der Adoption vorangehenden Enttäuschungen („Ich war eine traurige Frau. (…) Ich war eine unfruchtbare Frau.“ (S. 31)) und immer wieder aufkommenden Irritationen und Zweifeln während des Adoptionsverfahrens: „Mary rief nicht einmal das Kindchenschema ab, auf das wir getrimmt waren. Bestenfalls halb“ (S. 98). Zurückliegende Schwangerschaften und die Brutalität einer Totgeburt werden ebenso thematisiert wie die Schuldgefühle des Ehepaars (vgl. S.48ff.). Bei allen Schwierigkeiten und aller Schwermut, die ihre Bemühungen um die Adoption des Kindes begleiten, wird die Erzählerin doch auch immer wieder bemerkenswert selbstironisch, was das mütterliche Reflexionsniveau hervorhebt und dem Text trotz seiner Ernsthaftigkeit beinahe einen gewissen Unterhaltungswert verleiht: „(…) Begeisterung (Kind), Sorge (Bakterien), Zweifeln (meine Zukunft als Kriechtier) und Dummheit“ (S. 232).
Formale Experimente: Ein Spiel mit den Genres
Im Hinblick auf die formale Gestaltung finden sich in zu lieben einige interessante Auffälligkeiten. So ist die Gattungsbezeichnung „Roman“ auf dem Buchcover durchgestrichen. Beim vorliegenden Werk scheint es sich also um einen genreübergreifenden Text zu handeln, der in der Form eines Romans erzählt ist, jedoch gleichzeitig die ungeschminkt wahre Geschichte der Ich-Erzählerin in präziser autobiographischer Wiedergabe zum Inhalt hat. Streichungen einzelner Wörter oder Phrasen finden sich auch gelegentlich im Verlauf des Textes, etwa auf den Seiten 7 und 9, was für ein höchst ernsthaftes Ringen um die Wahrhaftigkeit des eigenen Ausdrucks stehen mag, und gleichermaßen die formale Schnoddrigkeit eines lediglich zur Selbstbesinnung geführten Tagebuchs nachahmt. Dieser Eindruck wird zusätzlich durch die Vignetten verstärkt, die vielen Kapiteln vorangestellt sind, und die „Tabelle der verborgenen Zweifel“ auf S. 21, eine Art notizhafte Erörterung in Stichpunkten.
In kühlem Erzählbericht liefert die Autorin/Erzählerin zahlreiche Fakten des eigenen Lebens oder der Lebensumstände auf Sri Lanka: „Wir wussten es. Zwölf Jahre alt war die Mutter unseres Kindes gewesen, als sie schwanger wurde“ (S. 80). Kontrastiv zu diesen unkommentierten, in seiner Nacktheit schockierenden Tatsachen widmet sich die Erzählerin – und hier fühlt sich der Leser wiederum als Teil eines Romansettings – der ausgiebigen Schilderung ihrer Wahrnehmung Sri Lankas, eine hochpoetische Ansammlung von zahllosen Sinneseindrücken (am eindringlichsten der Geruch) und Leitmotiven aus dem Bereich der Natur bzw. der Tierwelt und urbanen Erfahrungen. Besonders hervorgehoben sei hier der wiederkehrende Gesang des indischen Kuckucks (z. B. S. 167), dessen hinlänglich bekannte Ablehnung der eigenen Brut als Kontra-Punkt zu den Bemühungen der Erzählerin um Nachkommenschaft verstanden werden könnte. Aus europäischer Sicht befremdend scheint die Rolle, die das Meer aus Sri Lanka spielt: Man hinterlässt Unrat und Kot am Strand und niemand geht schwimmen (vgl. S. 75 und S. 160ff.).
Sri Lanka unmittelbar nach dem Bürgerkrieg
Die im Text nicht namentlich genannte, freilich mit der Autorin Ulrike Draesner identische Ich-Erzählerin reist mit ihrem Mann Hunter, dessen fiktiver Name sich irgendwann auf traurige Art und Weise begründet, nach Sri Lanka, um die die dreijährige Mary zu adoptieren, die dort in einem Kinderheim, den defizitären Umständen entsprechend, mehr oder weniger gut versorgt von Ordensschwestern, neben anderen, häufig auch behinderten Kindern ihr Dasein fristet und motorisch unterentwickelt ist. Entgegen der landläufigen Vorstellung adoptionsunerfahrener Menschen kann das Ehepaar das kleine Mädchen nicht einfach mitnehmen, sondern die neuen Eltern und das Kind sollen in einem wochenlangen Prozess des gegenseitigen Kennenlernens erst aneinander gewöhnt werden – ehe eine endgültige Entscheidung über die Adoption fällt. Diese trifft dann ein Richter in einem völlig überfüllten Gerichtssaal. Die bürokratischen Hürden wirken kaum überwindbar, und nur dank der Hilfe Heidis, einer aus Deutschland stammenden Adoptionsvermittlerin von leicht zweifelhaftem Charakter, bei der das Ehepaar vorübergehend wohnt, wird die Adoption Marys – „Ich“ und Hunter müssen dabei zahlreiche Verhaltensregeln penibel genau einhalten – schließlich bewilligt.
Auf Sri Lanka ging am Tag vor der Ankunft des Berliner Ehepaars gerade der Bürgerkrieg zu Ende, und die Atmosphäre auf der Insel ist massiv von seinen Nachwehen geprägt, die Ulrike Draesner sehr eindringlich darstellt: „Was waren wir naiv. Kriege endeten nicht wie im Film: ‚Klappe Krieg zu‘, ‚Klappe Frieden auf‘. Sie fransten aus, versickerten allmählich, man musste sich als ‚Volk‘ die Kriegsgewohnheiten erst wieder abtrainieren, das war der beste Fall. Im schlechtesten Fall wurden diese Gewohnheiten erst einmal härter, obwohl sie ‚Frieden‘ hießen, weil die siegende Partei nun ‚durchgriff‘ und ‚aufräumte‘ und Gegner suchte“ (S. 175). So herrscht auf den Straßen Colombos eine allgegenwärtige Bedrohung, die schwer auf der Psyche der deutschen Besucher lastet. Auch im Gerichtssaal wimmelt es von schwer bewaffneten Männern, denen der Griff zum Gewehr jederzeit zuzutrauen ist: „Ich wusste, dass wirkliche Kugeln in den Läufen der auf uns gerichteten Gewehre steckten und dass ein Abzug ein Abzug ist und ein Trigger ein Trigger und ein Finger nervös“ (S. 194).
Annäherung und Rückzug
Im Zuge der emotionalen Zuwendung zu Mary, die diese nur in kleinen Schüben und mit vielen Rückschritten zulässt, kommt es zu einer allmählichen Entfremdung des Ehepaars. Nach und nach fokussiert sich das Mädchen intuitiv mehr auf den von der Autorin hinsichtlich seiner Geschlechterrolle sehr differenziert erinnerten Hunter, was neben der Tatsache, dass Frau und Mann mittlerweile ausschließlich mit den Angelegenheiten der Adoption befasst sind, auch einen Teil zum Auseinanderleben des Ehepaars beitragen mag: „Ab sofort durfte Hunter Mary berühren. Hunter wurde Marys Ersatz-große-Schwester. Hunter. Und nur Hunter. Akka-Hunter. Ich stand daneben und schaute zu“ (S. 217). Betont sei aber erneut, dass die Ich-Erzählerin keine Ressentiments gegen Hunter hegt und ihre Entfremdung als einen gegenseitigen Vorgang zeigt.
Auch die übrigen Figuren der autobiographischen Erzählung werden selbst in ihren Nebenrollen präzise gezeichnet und bei der Bewältigung ihrer Lebensaufgaben und den damit verbundenen Nöten sehr plastisch vor dem Auge des Lesers: Heidi, die Vermittlerin, Ordensschwestern, weitere Kinder, deren Schicksal wesentlich ungünstiger verlaufen dürfte, als dasjenige Marys, Taxifahrer, Soldaten.
Alles in allem beeindruckt Ulrike Draesners zu lieben durch die sprachliche Brillanz, mit der sie verschiedenste Register zieht, die Eindringlichkeit und Schonungslosigkeit der Darstellung sowie die poetische Qualität, die sie dem menschlich so schwierigen Thema abgewinnt.