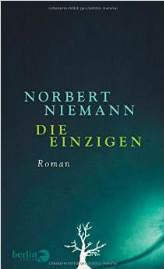Norbert Niemanns kämpferische Verteidigung der Kunst gegenüber der Macht des Marktes
Bekannt wurde der Schriftsteller und Essayist Norbert Niemann mit einer Reihe großer, komplexer Zeitromane. Vor Kurzem erhielt er für sein neues Werk Die Einzigen den Carl-Amery-Preis. Ganz im Zeichen dieser Auszeichnung, die politisch engagierte Literatur würdigt, ist Norbert Niemanns Dankesrede eine kämpferische Analyse der Bedrohung der Kunst durch den Siegeszug allgegenwärtiger Marktideologie. Von der FAZ publiziert, erregte sie sogleich breites Aufsehen. Sie erscheint bei uns ungekürzt.
*
Rede zur Verleihung des Carl-Amery-Preises
von Norbert Niemann
Vor einigen Jahren brachte das Nachtstudio des Bayerischen Rundfunks zum sechzigjährigen Jubiläum der Sendung eine Serie von Radioessays. Man suchte aus dem Archiv historische Aufnahmen von Autoren wie Theodor W. Adorno, Margarete Mitscherlich oder Josef Ratzinger zusammen und stellte ihnen jüngere Kollegen unter dem Titel Rede und Antwort als Gesprächspartner zur Seite. Ich wurde mit der Aufgabe betraut, eine Art Update zu Carl Amerys Beitrag über Das Dorf – Anachronismus, Zerstörung, Zukunft von 1978 zu verfassen. Mein Roman Willkommen neue Träume war soeben erschienen, der sich mit den Lebenswirklichkeiten in einem oberbayerischen Dorf des 21.Jahrhunderts beschäftigt, und so war ich gewissermaßen prädestiniert für diesen Dialog über die Zeiten hinweg. Schnell stellte ich fest, wie sehr Amerys Analysen mit meinen Beobachtungen übereinstimmten, und staunte, wie früh sich die Folgen einer ja nicht erst nach 1989 einsetzenden ökonomischen Globalisierung gerade in den ländlichen Regionen bereits abzeichneten. Was Amery 1978 als Tendenz formuliert hatte – die Verwandlung des Dorfs als landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaft in eine Mixtur aus Pendlerschlafstatt, Seniorenheim und Tourismuskulisse – war von der Realität inzwischen eingeholt und überholt. Denn auch die Kleinbauern, aus deren bedrohter Existenz Amery noch seine Zukunftsutopie einer ökologischen, auf Eigenhandel und Nachbarschaftlichkeit gründenden Agropolis entwickeln konnte, sind heute bis auf ein paar versprengte Bio-Höfe, die sich gerade so über Wasser halten, nahezu ausgestorben. In meinem Dorf etwa sind von den fünfundvierzig Bauern, die es vor fünfzig Jahren gab, heute gerade noch zwei übrig.
Carl Amery setzte damals die Zerstörung der ländlichen Strukturen in Europa unter dem Druck der globalen Futtermittel- und Saatgutkonzerne und des marktwirtschaftlichen Zwangs zur Monokultur gleich mit der Zerstörung gewachsener kultureller Lebensformen in den sogenannten Entwicklungsländern und prognostizierte ihren Kollaps. „Alles, was dem Dorf heute angeboten wird“, sagte er, „die industrielle Landwirtschaftberatung, das Netz der Konsum-Profitierer, die City-Verdiener, die sich als schicke Parasiten in seine Strukturen einnisten – all das vermag das Dorf nicht zu retten, sondern verstärkt seine Agonie.“ Dass in den Dörfern Oberbayerns der Kollaps ausgeblieben ist, stattdessen eine Art Vintage-Version von Tradition und Heimat entstehen konnte, die das existenzielle Bedürfnis ihrer Bewohner nach Identität scheinbar auffängt, hängt natürlich in erster Linie mit dem Sonderstatus der Region zusammen, die zu den reichsten Gegenden Deutschlands zählt. Für strukturschwache Gebiete wie den Bayerischen Wald, die Oberpfalz oder in ärmeren Bundesländern, erst recht in vielen europäischen Staaten erweist sich Amerys Vorhersage hingegen in vielen Aspekten als zutreffend: Die Dörfer veröden, die Jugend flieht, die Läden machen dicht, die Ärzte verschwinden.
Hinter dem Slogan „Laptop und Lederhose“ aus dem Jahr 1998 aber verbirgt sich eine subtilere Ursache dafür, dass die oberbayerische Provinz heute besser aussieht als andere und der Übergang vom Bauernland zur Suburbia von München so reibungslos funktionierte. Er hat mit zwei Ereignissen zu tun, die Amery in den siebziger Jahren nicht vorhersehen konnte: mit dem Siegeszug der Marktideologie nach dem Untergang des Kommunismus sowjetischer Prägung und mit der digitalen Revolution. Die von Roman Herzog und der CSU als vorbildlich gepriesene Entwicklung „vom Agrarland zum High-Tech-Staat" wäre unmöglich gewesen ohne die Unterstützung eines neuen Leitbilds und dessen Verbreitung über die Neuen Medien. Sein zentraler Gedanke ist so simpel, dass man ihn seit einem Vierteljahrhundert mit Wahrheit verwechselt und eine Zeitlang sogar glaubte, das Ende aller Ideologien ausrufen zu können: Die Marktwirtschaft sei die ewige Konstante in der Geschichte der Menschheit, ihre Gesetze des Wachstums und der Selbstregulierung mittels Konkurrenz die einzigen, die das Zusammenleben der Individuen und der Völker zu ihrem Wohl regelten. Auf dem Fundament dieses Credos fand statt, was als „Ökonomisierung der Gesamtgesellschaft“ inzwischen zum geflügelten Wort geworden ist. Sie hat alle Teilbereiche unseres Lebens aber nur deshalb in so rasantem Tempo erfassen können, weil sie die Methoden des Marktes als zentrales Gestaltungsprinzip auf unser berufliches und soziales Leben ausdehnt, vor allem aber in unserem Selbstbild verankert, und weil sie mit den neuen Informationstechnologien das propagandistische Equipment besitzt, es durchzusetzen. Dies gilt selbstredend auch für die Existenz- und Organisationsformen auf unseren schönen Dörfern, die längst nicht mehr den Idealen der Versorgungsgemeinschaft, sondern der Selbstvermarktung verpflichtet sind. In meinem Roman Willkommen neue Träume sind es dann auch die Interessen von Tourismus, Discounter-Firmen und einer Entourage von reichen „Aussteigern“ um eine alternde Filmdiva, die das Leben und die Konfliktlinien in der Gemeinde prägen.

(Thomas Kraft, Norbert Niemann)
Mit der Marktideologie jedenfalls ist ein neuer Identitätstypus entstanden, der den Anforderungen der durchökonomisierten Gesellschaft umfassend entspricht. Wir alle kennen diesen Typus: Er hat die Mechanismen des wirtschaftlichen Wettbewerbs verinnerlicht, die mittlerweile auch die Strukturen und Tiefenschichten unserer Arbeits- und Privatwelt erfasst haben, und wendet sie auf sich selbst an. Darin liegt die neue Qualität einer Herrschaftsform, die sich vom Kapitalismus früherer Zeiten grundlegend unterscheidet. Hierbei handelt es sich weniger um eine Bemächtigung von außen, als vielmehr um die Ingangsetzung eines selbstorganisatorischen Umbaus, gleichsam aus dem Inneren der Menschen selbst heraus. Die Ideologie vom totalen Markt sorgt dafür, dass der Einzelne, gleichgültig an welchem Platz in der Gesellschaft er steht, dessen Zwänge unter dem Deckmantel der Selbstoptimierung und Eigenverantwortlichkeit, des Teamspirits und der flachen Hierarchien, der Flexibilität und Kreativität als schicksalhaft unentrinnbar, als alternativlos erfährt. So gelingt es der neuen Macht, sich zu anonymisieren und hinter angeblichen Systemzwängen zu verbergen. Dabei operiert sie mit Techniken, die der Philosoph Michel Foucault Mikrophysik der Macht genannt hat und die uns aus der Werbung bestens vertraut sind: Ein künstlicher Horizont von Bedürfnissen und Sehnsüchten wird geschaffen, der – als Emanzipation und Befreiung inszeniert – nur durch Anpassung und Konkurrenz erreicht werden kann. Gerade die groteske Schizophrenie dieses konsumförmigen Bewusstseinsmodells macht es so schwer, die wirkenden Kräfte ideologischer Steuerung hinter den vordergründig liberal klingenden Botschaften wahrzunehmen. Weshalb die Trennlinie zwischen marktwirtschaftlicher Vereinnahmung und ursprünglicher Bestimmung heute mitten durch sämtliche gesellschaftlichen Institutionen verläuft – nicht zuletzt durch die des geistigen und kulturellen Lebens.
Auch hinter der heimatlichen Maske ländlicher Idylle hat sich der ökonomistische Identitätstypus ausgebreitet und alle anderen Identitätsformen an den Rand gedrängt. Auch in der Provinz funktionieren Kommunen und Betriebe, Behörden, Sozial- und Bildungseinrichtungen längst nach den halb leistungs- und wettbewerbsgesteuerten, halb gruppentherapeutischen Mustern der Selbstoptimierung und Selbstausbeutung. Das kennzeichnet den Unterschied zu Carl Amerys Analyse des Dorfes von 1978. Hinter einer Kulisse des schönen Scheins hat sich auch hier eine neue Klassengesellschaft herausgebildet, wo auf der einen Seite der ehemals breiten Mittelschicht die Winner stehen, die sich dem neuen Typus erfolgreich angepasst haben und ihren Status aus der Wagenburg ihres materiellen und kulturellen Besitzstands heraus verteidigen, und auf der anderen Seite die Loser, die sich dem Typus ebenfalls, aber erfolglos angepasst haben und dauerhaft im Ausnahmezustand ihrer prekären Verhältnisse gefangen bleiben. Und es ist allein der Insel-Status der wohlhabenden Nation, den Deutschland als einer der wenigen Profiteure der ökonomischen Globalisierung bislang noch einnimmt (gewissermaßen als Winner und Wagenburg-Verteidiger auf Staatenebene), der verhindert, dass die Kulisse brüchig wird und durchsichtig auf das, was sie kaschiert: eine auf Profit und Anpassung reduzierte Lebenswelt.
Der ideologische Charakter dieses gesamtgesellschaftlichen Umbaus während des vergangenen Vierteljahrhunderts ist aber zu einer ernsthaften Bedrohung der offenen Gesellschaft geworden. Gerade indem sie vorgibt, jenseits aller Ideologien zu stehen, hat die Marktideologie begonnen, die Demokratie von innen auszuhöhlen. Ideologien sind Weltanschauungen, die Anspruch auf absolute Wahrheit erheben, ihre Ansichten und Normen um jeden Preis durchsetzen und keinen Widerspruch zulassen. Erlangen sie Macht, entwickeln sie diktatorische Züge. Ich meine: All dies trifft zu auf Geist und Praxis des ökonomistischen Zugriffs auf unsere Lebenswelten. Nur die Techniken der Befestigung und Kontrolle der Macht haben sich geändert.
Womit ich allmählich zum Hauptpunkt meiner Rede komme.
Alle ideologischen Systeme versuchen ihre Herrschaft dadurch zu sichern, dass sie den kulturellen Raum besetzen. Die klassischen Formen des Zugriffs aufs geistige Leben einer Gesellschaft heißen Instrumentalisierung und Zensur. Die jeweilige Macht legt die Rolle des Denkens und der Künste fest, spannt sie in den Rahmen der Verherrlichung eines Herrschers oder der Verbreitung ihres Programms. Dies erreicht sie durch Beschränkung der Kultur auf Funktionen der Repräsentation oder durch verbindliche theoretische und ästhetische Vorschriften. Was die geforderten Kriterien nicht erfüllt, wird unterdrückt oder zerstört. In welchem Grad ein kultureller Freiraum im öffentlichen Leben existiert oder nicht existiert, daran lässt sich geradezu ablesen, wie offen eine Gesellschaft noch ist.
Meine Damen und Herren, Sie merken, worauf ich hinauswill: Nach meiner Beobachtung ist dieser kulturelle Freiraum in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr geschrumpft und in den letzten Jahren fast völlig in die Nischen abgedrängt worden. Und Sie ahnen auch, wen oder was ich dafür verantwortlich mache. Stellt sich die Frage, wie das möglich sein konnte, trotz eines Kulturbetriebs, der in der Bundesrepublik Deutschland – nicht zuletzt aus den Erfahrungen der Nazidiktatur schöpfend – zwar nicht aus dem Stand, aber immerhin in einem langwierigen Prozess, Strukturen aufbaute, die lange Zeit eine kritisch reflektierende Öffentlichkeit gewährleisteten. Ein unabhängiges Verlagswesen, eine dem freien Denken und dem künstlerischen Niveau verpflichtete Feuilletonlandschaft, ein dichtes Netz eigenständiger Buchhandlungen als Grundlage für ein sichtbares, in die Gesellschaft hineinwirkendes literarisches Leben zum Beispiel – das waren Errungenschaften, die eine Partizipation der Leserschaft an den zeitgenössischen Einlassungen zur gesellschaftlichen Entwicklung ermöglichten, worauf die noch junge Demokratie im Vergleich mit anderen westlichen Ländern zu Recht stolz sein konnte. Und in den anderen Künsten existierten vergleichbare Formationen.
Warum greifen sie heute nicht mehr, um die Kultur vor der Kommerzialisierung zu schützen? Denn mit der These, dass die Künste immer stärker ökonomischen Kriterien unterworfen sind, um überhaupt noch öffentlich wahrgenommen zu werden, dass sie dabei immer rigider in ihrer Substanz beschnitten, ihres kritischen Potentials beraubt werden, stehe ich ja keineswegs allein da. Erst im Dezember 2014 hat Okwui Enwezor, der Leiter des Münchner „Haus der Kunst“ und Kurator der diesjährigen Biennale in Venedig, in der SZ den gleichen Prozess für die Bildenden Künste beschrieben. Und wie wir alle wissen, rekrutiert das Musik-Business seine Popstarmarionetten längst nur noch im Casting-Show-Rampenlicht, wo junge Talente nach den Reißbrettvorgaben der Vermarktbarkeit selektiert werden – vom Schattendasein der Contemporary Music gar nicht erst zu reden. Ist das die finale Form kultureller Öffentlichkeit, die am Ende eines totalen Ökonomisierungsprozesses sämtlicher Kunstgattungen steht?
Die Idee zu meinem jüngsten Roman Die Einzigen, der entlang einer Paargeschichte vom Verhältnis zwischen Ökonomisierung und Kunst während des vergangenen Vierteljahrhunderts am Beispiel der Musik erzählt, verdankt sich einer Art Déjà-vu-Erlebnis: Während ich die Verwandlung des Literaturbetriebs zur Verkaufsbörse miterlebte, erinnerte ich mich, dass ich als junger Musiker und Mitglied einer experimentellen New-Wave-Band dieselbe Erfahrung in den achtziger Jahren schon einmal gemacht hatte. Damals flüchtete ich gewissermaßen in die Bastion der Literatur, die mir als uneinnehmbar erschien. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass nach „Entarteter Kunst“, nach „Sozialistischem Realismus“ Sprache, Reflexion, Kritik in diesem Land noch einmal zum Gegenstand von Lenkung und Bevormundung werden könnte. Und bei uns gibt es bekanntlich ja auch keine Polizeibehörden, Propagandaministerien oder Parteizentralen, die Zensur ausübten oder Künstler und Denker instrumentalisierten.
Aber, meine Damen und Herren: Unsere schöne neue Marktwirtschaft hat dergleichen gar nicht nötig. Das Prinzip der ökonomischen Verwertbarkeit erfasst das Zentrum des kulturellen Raums, dringt in die Steuerungsebene vor – und schon hat sie auch dort den essentiellen Teil von Herrschaftsmacht an sich gerissen, demokratische Strukturen unterlaufen – in diesem Fall die nach Immanuel Kant so wichtige Funktion des intersubjektiven Austauschs. Und warum auch sollte sie ausgerechnet vor den Foren des Geistes Halt machen, wo sie doch das Fundament für diese markthinderlichen demokratischen Strukturen bilden, deren Fortbestand bedingen? Wieso sollte sie gerade dort auf Einflussnahme verzichten, wo Zusammenhänge durchschaut, buchstäblich zur Sprache gebracht werden können, wo sich ein Potential zum Widerstand herausbilden könnte?
Die Einzigen erzählt sowohl die Geschichte der Absorption künstlerischer Konzepte durch die sogenannte Kreativwirtschaft, als auch die Geschichte einer zunehmenden Marginalisierung von Künstlern, die ihrer genuinen Aufgabe treu bleiben, für eine sich ständig verändernde Gegenwart immer wieder neue Zeichen, Klänge, Worte zu finden, um hinter die Verstellungen der abgenutzten oder missbrauchten Zeichen, Klänge, Worte zu kommen, mit denen wir gefüttert und vom Sehen, Hören, Denken abgehalten werden. Und obwohl es im Roman um Musik (und auf einer zweiten Ebene um Film) geht, sind darin die Entwicklungen im Literaturbetrieb durchaus mit gemeint, die in der Musikbranche eben nur ein paar Jahre früher eingesetzt haben. Denn was hier wie dort auf den ersten Blick als systemischer Automatismus erscheinen mag – als könnten ästhetische Reglementierungen von selbst aus den Institutionen der Kultur erwachsen – erweist sich bei genauerer Betrachtung als derselbe Prozess marktideologischer Überformung, wie er auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten gang und gäbe ist. Entscheidend ist erneut die Durchsetzung jenes neuen Identitätstypus, der bereit ist, sein Selbstbild und sein Handeln den ökonomistischen Spielregeln auszuliefern. Auch hier verläuft die Trennlinie mitten durch alle Instanzen – in den Verlagen, Literaturredaktionen und Buchverkaufseinrichtungen, unter den Autorinnen und Autoren selbst. Auch hier agieren an den Rändern allenfalls noch versprengte Häuflein, die als Relikt eines erst kürzlich verlorengegangenen kulturellen Selbstverständnisses die Sache der Literatur statt des Umsatzes vertreten.

(Laudator Tilman Spengler)
Der Umbau des Literaturbetriebs fand und findet auf zwei Ebenen statt. Nennen wir sie die Hardware-Ebene, als dessen strukturelle, und die Software-Ebene, als dessen programmatische Seite. Die Veränderungen im Buchgeschäft sind vielfach beschrieben, und ich erspare Ihnen die lange Liste der Missstände, die Ihnen allen vertraut sind. Den letzten Stand der Dinge hat Hannes Hintermeier vergangenen Monat in seinem FAZ-Bericht zur Londoner Buchmesse so zusammenfasst: „Eine in London kaum vernommene Schicksalsfrage der Branche wird sein, ob sie ihre Aufgabe auf einer rein ökonomischen Ebene verortet. Je mehr getreu dem Motto verlegt wird 'Gut ist, was sich verkauft', desto überflüssiger machen sich die Publikumsverlage als Inhaltslieferanten. Wenn diese vormals zentrale Aufgabe zugunsten einer Unterhaltungsmaschinerie in den Hintergrund gerät, wenn normative Prüfkriterien über Bord geworfen werden, weil man sich keine Haltung mehr gestattet, ändert sich das Geschäftsmodell.“
Über die Software aber, die Hintermeier in dem Wort Geschäftsmodell bereits zaghaft andeutet, muss ich aber doch ein paar Worte verlieren, da sie bisher kaum angemessen beachtet wird. Im Kern arbeitet sie mit einer schlichten Umkehrung des operativen Verlaufs: Sie will keine großartigen literarischen Werke entdecken und sie dann als Bücher verkaufen, sondern sie will Bücher verkaufen und füllt sie mit etwas, das sich gut verkaufen lässt. Das bedeutet, dass die normativen Prüfkriterien nicht nur über Bord geworfen, sondern durch andere ersetzt werden. Diese bilden sich durch eine Analyse der Konsumentenbedürfnisse heraus (das Vorhaben Amazons, mit dem Kindle das Leseverhalten der Kunden auszuspähen und algorithmisch auszuwerten, hat genau diesen Sinn). Die Frage, was verkauft sich aus welchem Grund besonders gut, hat so schon jetzt zu einem Katalog ästhetischer Vorschriften geführt, die im Literaturbetrieb von Vertretern des ökonomistischen Identitätstypus offensiv befördert werden. Unter dem Paradigma der Unterhaltsamkeit werden die Neuerscheinungen in den Literaturbeilagen halbjährlich auf exakt diese Vorschriften hin abgeklopft, nachdem sie zuvor in den Lektoraten entsprechend zurechtgestutzt worden sind. Was am Ende in den analogen und digitalen Schaufenstern der Buch-Discounter landet, funktioniert dann nach dem Modell der Groschenroman-Verlage, das heute allerdings auf die ganze Branche übergegriffen hat. (Womit im Übrigen nichts gegen den guten alten Groschenroman gesagt sein soll, solange er als solcher erkennbar bleibt.) Strukturell aber unterscheidet sich dieser Kommerzielle Realismus in nichts vom Sozialistischen Realismus oder einem anderen ideologisch verordneten Literaturprogramm. Er verdankt sich ausschließlich dem Diktat des Marktes. Die von diesem Diktat angeblich bewirkte Demokratisierung der Literaturlandschaft (wie erst kürzlich in einer großen überregionalen Tageszeitung zu lesen war) bedeutet in Wahrheit jedoch die Zementierung einer unterkomplexen literarischen Monokultur, durch deren profitorientiertes Scheuklappen-Raster künstlerisch bedeutende Werke allenfalls zufällig rutschen.
Dass diese Werke aber weiterhin existieren und von gesellschaftlichen Prozessen erzählen (etwa solchen, wie ich sie vorhin für die Entwicklung des ländlichen Raums skizziert habe), auch wenn sie in der Öffentlichkeit nur noch am Rande sichtbar werden, weiß ich. Denn ich habe sie gelesen. Als Autor ist mir das Privileg beschieden, im Austausch mit vielen Kollegen und Kolleginnen im In- und Ausland ständig neue Hinweise auf Werke zu bekommen, die sich ästhetisch auf der Höhe der Zeit bewegen. Und ich kann vermelden, die Entwicklungen in der internationalen Literatur sind so spannend wie seit langem nicht mehr. Nur bekommt das Lesepublikum leider nichts davon mit. Es ist nämlich zum Expertenwissen verkommen, was einmal Aufgabe des literarischen Diskurses war: künstlerische und gesellschaftliche Prozesse zusammenzudenken und so an einem von Machtinteressen unabhängigen Bild der Gegenwart mitzuarbeiten. Heute dagegen treibt die geistige Provinzialisierung, die sich zwangsläufig einstellt, wenn Diskurs und Gedächtnis als Referenzsysteme ausfallen, in einer Spiralbewegung den Prozess der Kommerzialisierung immer noch weiter voran.
Ich behaupte, ohne ihren geistigen und kulturellen Freiraum bleibt die offene demokratische Gesellschaft auf der Strecke und wird zum Trugbild. Dann existieren nur noch die von der Marktideologie beherrschte Realität auf der einen Seite – samt ihrem digitalen Netz, das sich immer enger um uns zusammenzieht – und auf der anderen Seite wir: als deren Marktplatz. Und ich meine das buchstäblich. Denn im Wettbewerb um die Platzierung von Bedürfnis- und Identitätsmustern sind unsere Gehirne, Nervenbahnen und Eingeweide zur Kampfzone der Macht geworden. Big-Data-Analysen wie sie von Google oder Facebook betrieben werden, um ihre Nutzer berechenbar zu machen, bestätigen das. Und die NSA kombiniert die großen Daten-Sammler, um ganze Bevölkerungen zu überwachen, wie wir spätestens seit Edward Snowdens Enthüllungen wissen.
Gäbe es noch ein intellektuelles Gedächtnis, würde man sich erinnern, dass Schriftsteller und Philosophen diese Entwicklung seit Jahrzehnten beschrieben und vor ihr gewarnt haben. Heute, da die Entwicklung fast vor ihrem Abschluss steht, muss die Frage nach Verantwortlichkeit und Widerstand neu gedacht werden. Im Kontext geistiger und künstlerischer Freiheit bedeutet dies eine Entscheidung zu treffen. Ist der neuen Herrschaftsform erst die Maske der Alternativlosigkeit entrissen, die ihr bislang Anonymität ermöglicht, stellt sie jeden Verleger und Verlagsmitarbeiter, jeden Buchverkäufer, Redakteur, Kritiker und Autor vor die Wahl, entweder für diese Freiheit trotz aller ökonomischen Zwänge einzustehen und sie mit den Mitteln des Wortes zurückzuerobern oder als Erfüllungsgehilfe ihrem Niedergang zu dienen und die Diktatur des Marktes mit all ihren demokratiezerstörenden, ja, totalitären Konsequenzen zu besiegeln. Da andererseits die marktkonformen Strukturen inzwischen den öffentlichen Raum dominieren, der für die Entfaltung des kulturellen Diskurses konstitutiv ist, steht auch die Politik in der Verantwortung darüber nachzudenken, wie sie die für eine Demokratie überlebensnotwendige Kultur des kritischen Denkens und unabhängigen Gestaltens erhalten will. Denn selbstverständlich ist sie das Herzstück der vielbeschworenen westlichen Werte – dieses Herz schlägt nur kaum noch.
So erscheint es auch Farouq in Teju Coles Roman Open City – einem wahren Meisterwerk der jüngsten Romankunst. Darin führt der in Nigeria aufgewachsene New Yorker Autor seinen Ich-Erzähler nach Brüssel, wo er den hochgebildeten Marokkaner in einem Internet-Café kennenlernt. Farouq sitzt dort an der Kasse, ein Buch über Walter Benjamins Geschichtsbegriff neben sich. Die beiden kommen ins Gespräch, reden über arabische und afrikanische Literatur, den Zwang, orientalische oder exotische Phantasien zu bedienen, um einen westlichen Verleger zu finden, über Differenz, Malcolm X und über Europa, als dem Traum ihrer Jugend. „Nicht irgendein Traum“, sagt Farouq, „sondern der Inbegriff aller Träume, der Traum von Gedankenfreiheit. Wir wollten alle hierher, in diesen Freiraum, um unseren Geist zu entfalten. Aber ich wurde enttäuscht. Europa sieht nur so aus, als wäre es frei. Der Traum war nur eine Erscheinung.“
Es ist an uns Europäern, den Traum zu retten, der immerhin stellen- und phasenweise bis vor kurzem noch Wirklichkeit für sich beanspruchen konnte.
Norbert Niemanns kämpferische Verteidigung der Kunst gegenüber der Macht des Marktes
Bekannt wurde der Schriftsteller und Essayist Norbert Niemann mit einer Reihe großer, komplexer Zeitromane. Vor Kurzem erhielt er für sein neues Werk Die Einzigen den Carl-Amery-Preis. Ganz im Zeichen dieser Auszeichnung, die politisch engagierte Literatur würdigt, ist Norbert Niemanns Dankesrede eine kämpferische Analyse der Bedrohung der Kunst durch den Siegeszug allgegenwärtiger Marktideologie. Von der FAZ publiziert, erregte sie sogleich breites Aufsehen. Sie erscheint bei uns ungekürzt.
*
Rede zur Verleihung des Carl-Amery-Preises
von Norbert Niemann
Vor einigen Jahren brachte das Nachtstudio des Bayerischen Rundfunks zum sechzigjährigen Jubiläum der Sendung eine Serie von Radioessays. Man suchte aus dem Archiv historische Aufnahmen von Autoren wie Theodor W. Adorno, Margarete Mitscherlich oder Josef Ratzinger zusammen und stellte ihnen jüngere Kollegen unter dem Titel Rede und Antwort als Gesprächspartner zur Seite. Ich wurde mit der Aufgabe betraut, eine Art Update zu Carl Amerys Beitrag über Das Dorf – Anachronismus, Zerstörung, Zukunft von 1978 zu verfassen. Mein Roman Willkommen neue Träume war soeben erschienen, der sich mit den Lebenswirklichkeiten in einem oberbayerischen Dorf des 21.Jahrhunderts beschäftigt, und so war ich gewissermaßen prädestiniert für diesen Dialog über die Zeiten hinweg. Schnell stellte ich fest, wie sehr Amerys Analysen mit meinen Beobachtungen übereinstimmten, und staunte, wie früh sich die Folgen einer ja nicht erst nach 1989 einsetzenden ökonomischen Globalisierung gerade in den ländlichen Regionen bereits abzeichneten. Was Amery 1978 als Tendenz formuliert hatte – die Verwandlung des Dorfs als landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaft in eine Mixtur aus Pendlerschlafstatt, Seniorenheim und Tourismuskulisse – war von der Realität inzwischen eingeholt und überholt. Denn auch die Kleinbauern, aus deren bedrohter Existenz Amery noch seine Zukunftsutopie einer ökologischen, auf Eigenhandel und Nachbarschaftlichkeit gründenden Agropolis entwickeln konnte, sind heute bis auf ein paar versprengte Bio-Höfe, die sich gerade so über Wasser halten, nahezu ausgestorben. In meinem Dorf etwa sind von den fünfundvierzig Bauern, die es vor fünfzig Jahren gab, heute gerade noch zwei übrig.
Carl Amery setzte damals die Zerstörung der ländlichen Strukturen in Europa unter dem Druck der globalen Futtermittel- und Saatgutkonzerne und des marktwirtschaftlichen Zwangs zur Monokultur gleich mit der Zerstörung gewachsener kultureller Lebensformen in den sogenannten Entwicklungsländern und prognostizierte ihren Kollaps. „Alles, was dem Dorf heute angeboten wird“, sagte er, „die industrielle Landwirtschaftberatung, das Netz der Konsum-Profitierer, die City-Verdiener, die sich als schicke Parasiten in seine Strukturen einnisten – all das vermag das Dorf nicht zu retten, sondern verstärkt seine Agonie.“ Dass in den Dörfern Oberbayerns der Kollaps ausgeblieben ist, stattdessen eine Art Vintage-Version von Tradition und Heimat entstehen konnte, die das existenzielle Bedürfnis ihrer Bewohner nach Identität scheinbar auffängt, hängt natürlich in erster Linie mit dem Sonderstatus der Region zusammen, die zu den reichsten Gegenden Deutschlands zählt. Für strukturschwache Gebiete wie den Bayerischen Wald, die Oberpfalz oder in ärmeren Bundesländern, erst recht in vielen europäischen Staaten erweist sich Amerys Vorhersage hingegen in vielen Aspekten als zutreffend: Die Dörfer veröden, die Jugend flieht, die Läden machen dicht, die Ärzte verschwinden.
Hinter dem Slogan „Laptop und Lederhose“ aus dem Jahr 1998 aber verbirgt sich eine subtilere Ursache dafür, dass die oberbayerische Provinz heute besser aussieht als andere und der Übergang vom Bauernland zur Suburbia von München so reibungslos funktionierte. Er hat mit zwei Ereignissen zu tun, die Amery in den siebziger Jahren nicht vorhersehen konnte: mit dem Siegeszug der Marktideologie nach dem Untergang des Kommunismus sowjetischer Prägung und mit der digitalen Revolution. Die von Roman Herzog und der CSU als vorbildlich gepriesene Entwicklung „vom Agrarland zum High-Tech-Staat" wäre unmöglich gewesen ohne die Unterstützung eines neuen Leitbilds und dessen Verbreitung über die Neuen Medien. Sein zentraler Gedanke ist so simpel, dass man ihn seit einem Vierteljahrhundert mit Wahrheit verwechselt und eine Zeitlang sogar glaubte, das Ende aller Ideologien ausrufen zu können: Die Marktwirtschaft sei die ewige Konstante in der Geschichte der Menschheit, ihre Gesetze des Wachstums und der Selbstregulierung mittels Konkurrenz die einzigen, die das Zusammenleben der Individuen und der Völker zu ihrem Wohl regelten. Auf dem Fundament dieses Credos fand statt, was als „Ökonomisierung der Gesamtgesellschaft“ inzwischen zum geflügelten Wort geworden ist. Sie hat alle Teilbereiche unseres Lebens aber nur deshalb in so rasantem Tempo erfassen können, weil sie die Methoden des Marktes als zentrales Gestaltungsprinzip auf unser berufliches und soziales Leben ausdehnt, vor allem aber in unserem Selbstbild verankert, und weil sie mit den neuen Informationstechnologien das propagandistische Equipment besitzt, es durchzusetzen. Dies gilt selbstredend auch für die Existenz- und Organisationsformen auf unseren schönen Dörfern, die längst nicht mehr den Idealen der Versorgungsgemeinschaft, sondern der Selbstvermarktung verpflichtet sind. In meinem Roman Willkommen neue Träume sind es dann auch die Interessen von Tourismus, Discounter-Firmen und einer Entourage von reichen „Aussteigern“ um eine alternde Filmdiva, die das Leben und die Konfliktlinien in der Gemeinde prägen.

(Thomas Kraft, Norbert Niemann)
Mit der Marktideologie jedenfalls ist ein neuer Identitätstypus entstanden, der den Anforderungen der durchökonomisierten Gesellschaft umfassend entspricht. Wir alle kennen diesen Typus: Er hat die Mechanismen des wirtschaftlichen Wettbewerbs verinnerlicht, die mittlerweile auch die Strukturen und Tiefenschichten unserer Arbeits- und Privatwelt erfasst haben, und wendet sie auf sich selbst an. Darin liegt die neue Qualität einer Herrschaftsform, die sich vom Kapitalismus früherer Zeiten grundlegend unterscheidet. Hierbei handelt es sich weniger um eine Bemächtigung von außen, als vielmehr um die Ingangsetzung eines selbstorganisatorischen Umbaus, gleichsam aus dem Inneren der Menschen selbst heraus. Die Ideologie vom totalen Markt sorgt dafür, dass der Einzelne, gleichgültig an welchem Platz in der Gesellschaft er steht, dessen Zwänge unter dem Deckmantel der Selbstoptimierung und Eigenverantwortlichkeit, des Teamspirits und der flachen Hierarchien, der Flexibilität und Kreativität als schicksalhaft unentrinnbar, als alternativlos erfährt. So gelingt es der neuen Macht, sich zu anonymisieren und hinter angeblichen Systemzwängen zu verbergen. Dabei operiert sie mit Techniken, die der Philosoph Michel Foucault Mikrophysik der Macht genannt hat und die uns aus der Werbung bestens vertraut sind: Ein künstlicher Horizont von Bedürfnissen und Sehnsüchten wird geschaffen, der – als Emanzipation und Befreiung inszeniert – nur durch Anpassung und Konkurrenz erreicht werden kann. Gerade die groteske Schizophrenie dieses konsumförmigen Bewusstseinsmodells macht es so schwer, die wirkenden Kräfte ideologischer Steuerung hinter den vordergründig liberal klingenden Botschaften wahrzunehmen. Weshalb die Trennlinie zwischen marktwirtschaftlicher Vereinnahmung und ursprünglicher Bestimmung heute mitten durch sämtliche gesellschaftlichen Institutionen verläuft – nicht zuletzt durch die des geistigen und kulturellen Lebens.
Auch hinter der heimatlichen Maske ländlicher Idylle hat sich der ökonomistische Identitätstypus ausgebreitet und alle anderen Identitätsformen an den Rand gedrängt. Auch in der Provinz funktionieren Kommunen und Betriebe, Behörden, Sozial- und Bildungseinrichtungen längst nach den halb leistungs- und wettbewerbsgesteuerten, halb gruppentherapeutischen Mustern der Selbstoptimierung und Selbstausbeutung. Das kennzeichnet den Unterschied zu Carl Amerys Analyse des Dorfes von 1978. Hinter einer Kulisse des schönen Scheins hat sich auch hier eine neue Klassengesellschaft herausgebildet, wo auf der einen Seite der ehemals breiten Mittelschicht die Winner stehen, die sich dem neuen Typus erfolgreich angepasst haben und ihren Status aus der Wagenburg ihres materiellen und kulturellen Besitzstands heraus verteidigen, und auf der anderen Seite die Loser, die sich dem Typus ebenfalls, aber erfolglos angepasst haben und dauerhaft im Ausnahmezustand ihrer prekären Verhältnisse gefangen bleiben. Und es ist allein der Insel-Status der wohlhabenden Nation, den Deutschland als einer der wenigen Profiteure der ökonomischen Globalisierung bislang noch einnimmt (gewissermaßen als Winner und Wagenburg-Verteidiger auf Staatenebene), der verhindert, dass die Kulisse brüchig wird und durchsichtig auf das, was sie kaschiert: eine auf Profit und Anpassung reduzierte Lebenswelt.
Der ideologische Charakter dieses gesamtgesellschaftlichen Umbaus während des vergangenen Vierteljahrhunderts ist aber zu einer ernsthaften Bedrohung der offenen Gesellschaft geworden. Gerade indem sie vorgibt, jenseits aller Ideologien zu stehen, hat die Marktideologie begonnen, die Demokratie von innen auszuhöhlen. Ideologien sind Weltanschauungen, die Anspruch auf absolute Wahrheit erheben, ihre Ansichten und Normen um jeden Preis durchsetzen und keinen Widerspruch zulassen. Erlangen sie Macht, entwickeln sie diktatorische Züge. Ich meine: All dies trifft zu auf Geist und Praxis des ökonomistischen Zugriffs auf unsere Lebenswelten. Nur die Techniken der Befestigung und Kontrolle der Macht haben sich geändert.
Womit ich allmählich zum Hauptpunkt meiner Rede komme.
Alle ideologischen Systeme versuchen ihre Herrschaft dadurch zu sichern, dass sie den kulturellen Raum besetzen. Die klassischen Formen des Zugriffs aufs geistige Leben einer Gesellschaft heißen Instrumentalisierung und Zensur. Die jeweilige Macht legt die Rolle des Denkens und der Künste fest, spannt sie in den Rahmen der Verherrlichung eines Herrschers oder der Verbreitung ihres Programms. Dies erreicht sie durch Beschränkung der Kultur auf Funktionen der Repräsentation oder durch verbindliche theoretische und ästhetische Vorschriften. Was die geforderten Kriterien nicht erfüllt, wird unterdrückt oder zerstört. In welchem Grad ein kultureller Freiraum im öffentlichen Leben existiert oder nicht existiert, daran lässt sich geradezu ablesen, wie offen eine Gesellschaft noch ist.
Meine Damen und Herren, Sie merken, worauf ich hinauswill: Nach meiner Beobachtung ist dieser kulturelle Freiraum in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr geschrumpft und in den letzten Jahren fast völlig in die Nischen abgedrängt worden. Und Sie ahnen auch, wen oder was ich dafür verantwortlich mache. Stellt sich die Frage, wie das möglich sein konnte, trotz eines Kulturbetriebs, der in der Bundesrepublik Deutschland – nicht zuletzt aus den Erfahrungen der Nazidiktatur schöpfend – zwar nicht aus dem Stand, aber immerhin in einem langwierigen Prozess, Strukturen aufbaute, die lange Zeit eine kritisch reflektierende Öffentlichkeit gewährleisteten. Ein unabhängiges Verlagswesen, eine dem freien Denken und dem künstlerischen Niveau verpflichtete Feuilletonlandschaft, ein dichtes Netz eigenständiger Buchhandlungen als Grundlage für ein sichtbares, in die Gesellschaft hineinwirkendes literarisches Leben zum Beispiel – das waren Errungenschaften, die eine Partizipation der Leserschaft an den zeitgenössischen Einlassungen zur gesellschaftlichen Entwicklung ermöglichten, worauf die noch junge Demokratie im Vergleich mit anderen westlichen Ländern zu Recht stolz sein konnte. Und in den anderen Künsten existierten vergleichbare Formationen.
Warum greifen sie heute nicht mehr, um die Kultur vor der Kommerzialisierung zu schützen? Denn mit der These, dass die Künste immer stärker ökonomischen Kriterien unterworfen sind, um überhaupt noch öffentlich wahrgenommen zu werden, dass sie dabei immer rigider in ihrer Substanz beschnitten, ihres kritischen Potentials beraubt werden, stehe ich ja keineswegs allein da. Erst im Dezember 2014 hat Okwui Enwezor, der Leiter des Münchner „Haus der Kunst“ und Kurator der diesjährigen Biennale in Venedig, in der SZ den gleichen Prozess für die Bildenden Künste beschrieben. Und wie wir alle wissen, rekrutiert das Musik-Business seine Popstarmarionetten längst nur noch im Casting-Show-Rampenlicht, wo junge Talente nach den Reißbrettvorgaben der Vermarktbarkeit selektiert werden – vom Schattendasein der Contemporary Music gar nicht erst zu reden. Ist das die finale Form kultureller Öffentlichkeit, die am Ende eines totalen Ökonomisierungsprozesses sämtlicher Kunstgattungen steht?
Die Idee zu meinem jüngsten Roman Die Einzigen, der entlang einer Paargeschichte vom Verhältnis zwischen Ökonomisierung und Kunst während des vergangenen Vierteljahrhunderts am Beispiel der Musik erzählt, verdankt sich einer Art Déjà-vu-Erlebnis: Während ich die Verwandlung des Literaturbetriebs zur Verkaufsbörse miterlebte, erinnerte ich mich, dass ich als junger Musiker und Mitglied einer experimentellen New-Wave-Band dieselbe Erfahrung in den achtziger Jahren schon einmal gemacht hatte. Damals flüchtete ich gewissermaßen in die Bastion der Literatur, die mir als uneinnehmbar erschien. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass nach „Entarteter Kunst“, nach „Sozialistischem Realismus“ Sprache, Reflexion, Kritik in diesem Land noch einmal zum Gegenstand von Lenkung und Bevormundung werden könnte. Und bei uns gibt es bekanntlich ja auch keine Polizeibehörden, Propagandaministerien oder Parteizentralen, die Zensur ausübten oder Künstler und Denker instrumentalisierten.
Aber, meine Damen und Herren: Unsere schöne neue Marktwirtschaft hat dergleichen gar nicht nötig. Das Prinzip der ökonomischen Verwertbarkeit erfasst das Zentrum des kulturellen Raums, dringt in die Steuerungsebene vor – und schon hat sie auch dort den essentiellen Teil von Herrschaftsmacht an sich gerissen, demokratische Strukturen unterlaufen – in diesem Fall die nach Immanuel Kant so wichtige Funktion des intersubjektiven Austauschs. Und warum auch sollte sie ausgerechnet vor den Foren des Geistes Halt machen, wo sie doch das Fundament für diese markthinderlichen demokratischen Strukturen bilden, deren Fortbestand bedingen? Wieso sollte sie gerade dort auf Einflussnahme verzichten, wo Zusammenhänge durchschaut, buchstäblich zur Sprache gebracht werden können, wo sich ein Potential zum Widerstand herausbilden könnte?
Die Einzigen erzählt sowohl die Geschichte der Absorption künstlerischer Konzepte durch die sogenannte Kreativwirtschaft, als auch die Geschichte einer zunehmenden Marginalisierung von Künstlern, die ihrer genuinen Aufgabe treu bleiben, für eine sich ständig verändernde Gegenwart immer wieder neue Zeichen, Klänge, Worte zu finden, um hinter die Verstellungen der abgenutzten oder missbrauchten Zeichen, Klänge, Worte zu kommen, mit denen wir gefüttert und vom Sehen, Hören, Denken abgehalten werden. Und obwohl es im Roman um Musik (und auf einer zweiten Ebene um Film) geht, sind darin die Entwicklungen im Literaturbetrieb durchaus mit gemeint, die in der Musikbranche eben nur ein paar Jahre früher eingesetzt haben. Denn was hier wie dort auf den ersten Blick als systemischer Automatismus erscheinen mag – als könnten ästhetische Reglementierungen von selbst aus den Institutionen der Kultur erwachsen – erweist sich bei genauerer Betrachtung als derselbe Prozess marktideologischer Überformung, wie er auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten gang und gäbe ist. Entscheidend ist erneut die Durchsetzung jenes neuen Identitätstypus, der bereit ist, sein Selbstbild und sein Handeln den ökonomistischen Spielregeln auszuliefern. Auch hier verläuft die Trennlinie mitten durch alle Instanzen – in den Verlagen, Literaturredaktionen und Buchverkaufseinrichtungen, unter den Autorinnen und Autoren selbst. Auch hier agieren an den Rändern allenfalls noch versprengte Häuflein, die als Relikt eines erst kürzlich verlorengegangenen kulturellen Selbstverständnisses die Sache der Literatur statt des Umsatzes vertreten.

(Laudator Tilman Spengler)
Der Umbau des Literaturbetriebs fand und findet auf zwei Ebenen statt. Nennen wir sie die Hardware-Ebene, als dessen strukturelle, und die Software-Ebene, als dessen programmatische Seite. Die Veränderungen im Buchgeschäft sind vielfach beschrieben, und ich erspare Ihnen die lange Liste der Missstände, die Ihnen allen vertraut sind. Den letzten Stand der Dinge hat Hannes Hintermeier vergangenen Monat in seinem FAZ-Bericht zur Londoner Buchmesse so zusammenfasst: „Eine in London kaum vernommene Schicksalsfrage der Branche wird sein, ob sie ihre Aufgabe auf einer rein ökonomischen Ebene verortet. Je mehr getreu dem Motto verlegt wird 'Gut ist, was sich verkauft', desto überflüssiger machen sich die Publikumsverlage als Inhaltslieferanten. Wenn diese vormals zentrale Aufgabe zugunsten einer Unterhaltungsmaschinerie in den Hintergrund gerät, wenn normative Prüfkriterien über Bord geworfen werden, weil man sich keine Haltung mehr gestattet, ändert sich das Geschäftsmodell.“
Über die Software aber, die Hintermeier in dem Wort Geschäftsmodell bereits zaghaft andeutet, muss ich aber doch ein paar Worte verlieren, da sie bisher kaum angemessen beachtet wird. Im Kern arbeitet sie mit einer schlichten Umkehrung des operativen Verlaufs: Sie will keine großartigen literarischen Werke entdecken und sie dann als Bücher verkaufen, sondern sie will Bücher verkaufen und füllt sie mit etwas, das sich gut verkaufen lässt. Das bedeutet, dass die normativen Prüfkriterien nicht nur über Bord geworfen, sondern durch andere ersetzt werden. Diese bilden sich durch eine Analyse der Konsumentenbedürfnisse heraus (das Vorhaben Amazons, mit dem Kindle das Leseverhalten der Kunden auszuspähen und algorithmisch auszuwerten, hat genau diesen Sinn). Die Frage, was verkauft sich aus welchem Grund besonders gut, hat so schon jetzt zu einem Katalog ästhetischer Vorschriften geführt, die im Literaturbetrieb von Vertretern des ökonomistischen Identitätstypus offensiv befördert werden. Unter dem Paradigma der Unterhaltsamkeit werden die Neuerscheinungen in den Literaturbeilagen halbjährlich auf exakt diese Vorschriften hin abgeklopft, nachdem sie zuvor in den Lektoraten entsprechend zurechtgestutzt worden sind. Was am Ende in den analogen und digitalen Schaufenstern der Buch-Discounter landet, funktioniert dann nach dem Modell der Groschenroman-Verlage, das heute allerdings auf die ganze Branche übergegriffen hat. (Womit im Übrigen nichts gegen den guten alten Groschenroman gesagt sein soll, solange er als solcher erkennbar bleibt.) Strukturell aber unterscheidet sich dieser Kommerzielle Realismus in nichts vom Sozialistischen Realismus oder einem anderen ideologisch verordneten Literaturprogramm. Er verdankt sich ausschließlich dem Diktat des Marktes. Die von diesem Diktat angeblich bewirkte Demokratisierung der Literaturlandschaft (wie erst kürzlich in einer großen überregionalen Tageszeitung zu lesen war) bedeutet in Wahrheit jedoch die Zementierung einer unterkomplexen literarischen Monokultur, durch deren profitorientiertes Scheuklappen-Raster künstlerisch bedeutende Werke allenfalls zufällig rutschen.
Dass diese Werke aber weiterhin existieren und von gesellschaftlichen Prozessen erzählen (etwa solchen, wie ich sie vorhin für die Entwicklung des ländlichen Raums skizziert habe), auch wenn sie in der Öffentlichkeit nur noch am Rande sichtbar werden, weiß ich. Denn ich habe sie gelesen. Als Autor ist mir das Privileg beschieden, im Austausch mit vielen Kollegen und Kolleginnen im In- und Ausland ständig neue Hinweise auf Werke zu bekommen, die sich ästhetisch auf der Höhe der Zeit bewegen. Und ich kann vermelden, die Entwicklungen in der internationalen Literatur sind so spannend wie seit langem nicht mehr. Nur bekommt das Lesepublikum leider nichts davon mit. Es ist nämlich zum Expertenwissen verkommen, was einmal Aufgabe des literarischen Diskurses war: künstlerische und gesellschaftliche Prozesse zusammenzudenken und so an einem von Machtinteressen unabhängigen Bild der Gegenwart mitzuarbeiten. Heute dagegen treibt die geistige Provinzialisierung, die sich zwangsläufig einstellt, wenn Diskurs und Gedächtnis als Referenzsysteme ausfallen, in einer Spiralbewegung den Prozess der Kommerzialisierung immer noch weiter voran.
Ich behaupte, ohne ihren geistigen und kulturellen Freiraum bleibt die offene demokratische Gesellschaft auf der Strecke und wird zum Trugbild. Dann existieren nur noch die von der Marktideologie beherrschte Realität auf der einen Seite – samt ihrem digitalen Netz, das sich immer enger um uns zusammenzieht – und auf der anderen Seite wir: als deren Marktplatz. Und ich meine das buchstäblich. Denn im Wettbewerb um die Platzierung von Bedürfnis- und Identitätsmustern sind unsere Gehirne, Nervenbahnen und Eingeweide zur Kampfzone der Macht geworden. Big-Data-Analysen wie sie von Google oder Facebook betrieben werden, um ihre Nutzer berechenbar zu machen, bestätigen das. Und die NSA kombiniert die großen Daten-Sammler, um ganze Bevölkerungen zu überwachen, wie wir spätestens seit Edward Snowdens Enthüllungen wissen.
Gäbe es noch ein intellektuelles Gedächtnis, würde man sich erinnern, dass Schriftsteller und Philosophen diese Entwicklung seit Jahrzehnten beschrieben und vor ihr gewarnt haben. Heute, da die Entwicklung fast vor ihrem Abschluss steht, muss die Frage nach Verantwortlichkeit und Widerstand neu gedacht werden. Im Kontext geistiger und künstlerischer Freiheit bedeutet dies eine Entscheidung zu treffen. Ist der neuen Herrschaftsform erst die Maske der Alternativlosigkeit entrissen, die ihr bislang Anonymität ermöglicht, stellt sie jeden Verleger und Verlagsmitarbeiter, jeden Buchverkäufer, Redakteur, Kritiker und Autor vor die Wahl, entweder für diese Freiheit trotz aller ökonomischen Zwänge einzustehen und sie mit den Mitteln des Wortes zurückzuerobern oder als Erfüllungsgehilfe ihrem Niedergang zu dienen und die Diktatur des Marktes mit all ihren demokratiezerstörenden, ja, totalitären Konsequenzen zu besiegeln. Da andererseits die marktkonformen Strukturen inzwischen den öffentlichen Raum dominieren, der für die Entfaltung des kulturellen Diskurses konstitutiv ist, steht auch die Politik in der Verantwortung darüber nachzudenken, wie sie die für eine Demokratie überlebensnotwendige Kultur des kritischen Denkens und unabhängigen Gestaltens erhalten will. Denn selbstverständlich ist sie das Herzstück der vielbeschworenen westlichen Werte – dieses Herz schlägt nur kaum noch.
So erscheint es auch Farouq in Teju Coles Roman Open City – einem wahren Meisterwerk der jüngsten Romankunst. Darin führt der in Nigeria aufgewachsene New Yorker Autor seinen Ich-Erzähler nach Brüssel, wo er den hochgebildeten Marokkaner in einem Internet-Café kennenlernt. Farouq sitzt dort an der Kasse, ein Buch über Walter Benjamins Geschichtsbegriff neben sich. Die beiden kommen ins Gespräch, reden über arabische und afrikanische Literatur, den Zwang, orientalische oder exotische Phantasien zu bedienen, um einen westlichen Verleger zu finden, über Differenz, Malcolm X und über Europa, als dem Traum ihrer Jugend. „Nicht irgendein Traum“, sagt Farouq, „sondern der Inbegriff aller Träume, der Traum von Gedankenfreiheit. Wir wollten alle hierher, in diesen Freiraum, um unseren Geist zu entfalten. Aber ich wurde enttäuscht. Europa sieht nur so aus, als wäre es frei. Der Traum war nur eine Erscheinung.“
Es ist an uns Europäern, den Traum zu retten, der immerhin stellen- und phasenweise bis vor kurzem noch Wirklichkeit für sich beanspruchen konnte.