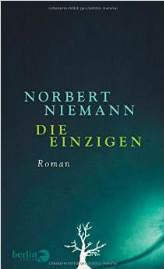Im Gespräch: der Schriftsteller Norbert Niemann
Bekannt wurde der Schriftsteller und Essayist Norbert Niemann mit einer Reihe großer, komplexer Zeitromane. In den Achtzigerjahren stand er auch als Musiker der New-Wave-Band Diebe der Nacht auf der Bühne, ein Thema, das nun in seinem neuen, hochgelobten Roman Die Einzigen (Berlin Verlag, 2014) wiederkehrt. Am kommenden Mittwoch, dem 20. Mai 2015, wird Norbert Niemann in München mit dem Carl-Amery-Preis ausgezeichnet. Die Laudatio hält Tilman Spengler. Mit uns sprach Niemann über seinen neuen Roman, über literarisches Engagement – und über Widerstand.
*
Literaturportal Bayern: In Ihrem Roman brodelt unter der relativ ruhigen Textoberfläche ein alter, fast epischer Kampf, jener zwischen Kunst und Leben – und das zu Zeiten scheinbar überall siegreicher Konsumideologie. Inwiefern beschäftigt Sie die Frage nach einer Ästhetik des Widerstands? Wie wehrhaft kann Literatur gegenüber dem ‚Angesagten‘ noch sein?
Norbert Niemann: Die Frage ist gar nicht leicht zu beantworten, weil sie den Kern meines Literaturbegriffs berührt. Widerständigkeit, Wehrhaftigkeit – das sind für mich Haltungen, die grundsätzlich und essentiell zur Literatur, zu allen Künsten gehören. Ohne sie wird aus jedem vermeintlichen Kunstwerk allenfalls so etwas wie ein kunstförmiges Produkt. Künstlerische Ästhetiken verändern sich deshalb, weil gesellschaftliche Realitäten sich verändern. In ihnen spiegeln sich diese Veränderungen. Ich habe den Impuls, Kunstwerke zu schaffen, immer so verstanden, dass die vorhandene Sprache, die vorhandenen Zeichensysteme nicht mehr ausreichen, um die je zeitgenössischen Lebenswirklichkeiten zu formulieren, dass diese Sprache, diese Zeichen besetzt sind, sich entleert haben, entleert worden sind, dass es in der Literatur darum geht, die Sprache immer wieder neu zu erfinden, statt nur nachzuahmen, was nicht mehr in der Lage ist, das Reale zu kommunizieren. Widerständigkeit meint also in erster Linie diesen existenziellen, genuin künstlerischen Zugriff für mich, der dann zwangsläufig auch ein politischer Zugriff wird, weil sich in dieser Besetzung und Entleerung von Zeichen und Sprache die jeweiligen Herrschaftsformen manifestieren.
Andererseits ruft „Ästhetik des Widerstands“ sofort diese spezifische Aura des gleichnamigen Werks von Peter Weiss auf, die in meinen Augen selbst inzwischen für einen doch reichlich historisch gewordenen Ansatz steht: Literarisches Erzählen als Geschichte des Klassenkampfs, der Arbeiterbewegung, als Kampf gegen den Faschismus usw. Er scheint mir unter den gegenwärtigen Bedingungen von Herrschaft und Ausbeutung im globalisierten und digitalisierten Ökonomismus nicht mehr recht zu greifen. Weil sich die Machtstrukturen massiv verändert haben. Weil die Ästhetisierung des Politischen Ausmaße angenommen hat, von denen sich nicht einmal Walter Benjamin hätte träumen lassen. Weil diese Politik der ästhetischen Zurichtung ganz direkt und schamlos offen in die Voraussetzungen für die Entstehung und Verbreitung von Kunst eingreift. Der Begriff im Sinn von Peter Weiss kann sogar dazu verführen, sich in alten bequemen Positionen einzurichten, das Nachdenken über die veränderte Ausgangslage einzustellen. Ich meine damit natürlich keineswegs, dass diese Ästhetik des Widerstands grundsätzlich obsolet geworden wäre. Im Gegenteil wird die Klassenfrage in atemberaubendem Tempo von Jahr zu Jahr aktueller. Aber ein Blick auf die Gegenwart, der sich verengt auf die Oberflächenbewegungen sozialer Spannungen im Zuge der heutigen Umverteilung von unten nach oben, schwebt in Gefahr blind zu sein für die Herrschaftsmechanismen, die unter dieser Oberfläche wirksam sind. Dazu gehören nun einmal wesentlich auch Fragen der ästhetischen Freiheit. Ob das, was als Widerstand gedacht ist, sich diesen Mechanismen überhaupt noch entgegenstellen kann, ob es sie nicht vielleicht sogar unbewusst bedient und verstärkt.
Der Erfolg des Ökonomismus wäre ohne die Digitalisierung ja gar nicht denkbar gewesen. Erst im Zusammenspiel mit der flächendeckenden medialen Omnipräsenz des Marktes ist der Wirtschaft und der Finanzindustrie diese Usurpation der politischen Macht gelungen, die wir in den letzten fünfundzwanzig Jahren miterlebt haben. Nicht zufällig spielt die sogenannte Kreativwirtschaft heute eine so bedeutende Rolle. Das Wort „Konsumideologie“ bringt fast für sich schon auf den Punkt, worauf ich hinauswill: Auf der einen Seite das unentrinnbare Netzwerk einer digitalen Online-Realität, das sich immer enger um uns zusammenzieht, auf der anderen Seite wir, deren Marktplatz. Ich meine das buchstäblich: Unsere Gehirne, unsere Nervenbahnen, Muskeln, Eingeweide sind zum Schauplatz eine Konkurrenzkampfs um die Platzierung von Bedürfnis- und Wirklichkeitsmustern geworden. Das Joint Venture zwischen NSA, Google, Facebook usw. belegt das unmissverständlich. Dass die Künste seit einigen Jahren immer stärker ökonomischen Kriterien unterworfen werden, um überhaupt noch öffentlich wahrgenommen zu werden, dass sie dabei immer rigider in ihrer Substanz beschnitten, ihres kritischen Potentials beraubt werden, ist ja nicht nur auf die Literatur beschränkt. Erst kürzlich hat Okwui Enwezor, der das Münchner Haus der Kunst leitet, in der SZ den gleichen Prozess für die Bildenden Künste beschrieben. Und das Pop-Business rekrutiert seine Popstarmarionetten ohnehin längst im Casting-Show-Rampenlicht, wo junge Talente nach den Reißbrettvorgaben der Vermarktbarkeit selektiert und zurechtgestutzt werden. Was unten herauskommt, hat dann naturgemäß kaum noch etwas mit Kunst zu tun.
Aus alldem ergibt sich, dass die Frage nicht lautet, ob Literatur noch wehrhaft gegenüber dem Angesagten ist oder sein kann, sondern dass Texte überhaupt nur dann beanspruchen können, Literatur zu sein, wenn es ihnen gelingt, diese Wehrhaftigkeit zu gestalten. Der Rest ist Kunsthandwerk, und wo er als Literatur verkauft wird, Betrug im Dienst des Profits. Die Frage lautet also vielmehr, wie und wo Literatur und Kunst überhaupt noch als Literatur und Kunst für ihr Publikum sichtbar werden können. Und das wiederum ist eine überaus politische Frage. Literatur und Kunst selbst sind ja nicht zerstörbar, sie sind immer da. Doch in welchem Grad sie in einer Gesellschaft auch präsent sind, daran lässt sich ablesen, wie offen diese Gesellschaft noch ist.
Wie schreibt man über Musik?
Eine gewisse Radikalität Ihres Ästhetikbegriffs besteht ja gerade darin, dass man bei diesem Roman zwischen Kunst und Künstlichkeit unterscheiden muss. Die Sprache jongliert nicht selbstverliebt, sondern wirkt diszipliniert. Zum Beispiel spielt Musik eine buchstäblich tragende Rolle – auch für die Metaebene – da wäre es doch sehr verlockend gewesen, selbst schreibend zu ‚musizieren‘. Doch dieser Lockung widersteht die Sprache. Wie war Ihre Konzeption, über Musik zu schreiben – ohnehin schon unglaublich schwer und noch dazu über eine zum Teil experimentelle Art, die es so für den Laien noch gar nicht gibt?
Das war das Schwierigste an diesem Roman, auch der Hauptgrund, warum es so viel Zeit in Anspruch genommen hat, ihn zu schreiben. Es gibt so gut wie keine Tradition für das, was ich versucht habe, nämlich das Musikerlebnis selbst sprachlich einzufangen. Man gelangt schnell an ein Ende damit, wenn man sich auf Adjektive und Substantivierungen für Klänge und Geräusche beschränkt, kommt übers Dröhnen und Brausen und Jaulen und Zwitschern und Zittern nicht hinaus. Das bleibt dann abstrakt wie eine Serie von Interpretationsanweisungen in einer Partitur, die erst den Interpreten braucht, um sinnlich nachvollziehbar zu werden. Deshalb wählen Schriftsteller, wenn sie über Musik schreiben, gewöhnlich den Umweg über die Musiktheorie, die Musikgeschichte, die Musikphilosophie. Thomas Manns Doktor Faustus ist das berühmteste Beispiel dafür (bekanntlich hat ihm Theodor W. Adorno dabei geholfen). Eine andere Methode ist es eben, „schreibend zu musizieren“, wie Sie gesagt haben, in Anlehnung an die viel geübte Praxis, schreibend zu malen. Dabei handelt es sich dann aber um etwas ganz anderes: denn die Musik ist gar nicht das Sujet, sondern man kopiert nur gewisse kompositorische Formen oder rhythmische Muster in die Form, den Klang der Sprache hinein. Wie gesagt, Musik entzieht sich den Wörtern, denn „Musik ist keine Sprache“, wie Marlene Krahl im Roman einmal sagt. Auch im Gehirn sind für Musik und Sprache ganz unterschiedliche Zentren zuständig. Man kann das bei Oliver Sacks in seinem Buch Musicophilia (deutsch: Der einarmige Pianist) nachlesen, das ich vor zwei Jahren in eine Bühnenfassung gebracht habe.
Was mich interessierte, war vielmehr eine Übersetzung von Musik in Sprache. Ich kannte bis vor kurzem nur ein historisches Beispiel dafür: Marcel Proust, der in der Recherche immer wieder dieser Sonate von Vintieul nahezukommen versucht, und zwar als purem Hörerlebnis. (Inzwischen, nach einer Lesung aus Die Einzigen, hat mich eine Zuhörerin noch auf einen andern Text gebracht: auf das Buch Heller als die Sonne des britischen Musikjournalisten Kodwo Eshun, der etwas Ähnliches versucht für die schwarze elektronische Musik seit Sun Ra, Miles Davis, Herbie Hancock, George Russell in den siebziger Jahren bis heute.) Ich musste erst einmal begreifen, dass ich für diesen Übersetzungsvorgang völlig in die Innenperspektive von Harry begeben muss, also der Figur, die der Musik ausgeliefert ist. Dabei stellte es sich als Vorteil heraus, dass Harry mit Marlenes Musik anfangs wenig anfangen kann, sich selbst erst im Laufe des Romans an ein Verständnis ihrer Kompositionen herantastet. Dass es ihm also ähnlich geht, wie den meisten Laien. Ich habe daher in erster Linie den Prozess von Harrys Annäherung an diese Musik abzubilden versucht, und das konnte nur gelingen, indem ich über das schrieb, was Harry gleichzeitig, während er zuhört, sieht, assoziiert, halluziniert und ganz physisch empfindet. Über den Roman verstreut, wählt Harry für diese sinnliche Annäherung verschiedene Umwege oder Ansätze: er hält sich an Marlenes Körperbewegungen, hat surreale Wahrnehmungen, entwickelt Bilderfolgen. Bei dem Kapitel über Chris Cunningham und Aphex Twin dreht er den Ton ab, um genauer hören zu können, was in seinem Innern ohnehin erklingt. Bei Marlenes Auftritt im La Fenice ist Harry wie taub, und die Musik stellt sich ihm nur über die „dramatische Handlung“ im Opernhaus zwischen Marlene und dem Publikum dar. Diese Herangehensweise bildete also den Schwerpunkt bei meiner sprachlichen Annäherung an die Musik, in die dann natürlich auch Elemente von Rhythmisierung und Lautmalerei, auch Musikhistorisches und Musikphilosophisches mit aufgenommen wurden, aber eben nur auf einer untergeordneten Ebene.
Die Hauptfigur Harry denkt ganz am Schluss nochmal an seine frühere Zeit zurück, als er und viele andere Künstler fest glaubten, die Gesellschaft verändern zu können, zumindest ihre Wahrnehmung. Halb amüsiert er sich dabei über die eigene Naivität, halb trauert er über den Verlust dieses Glaubens. Wie ist das bei Ihnen als Verfasser von ‚Zeitromanen‘, die ja durchaus einem engagierten Impetus entspringen? Muss man da im vielbeschworenen ‚Niedergang des Intellektuellen‘ nicht verzweifeln? Oder ist gerade der verlorene Posten eine Position neuer Möglichkeiten?
Natürlich bin ich da oft vollkommen fassungslos! Dass das in diesem Land, mit dieser Geschichte möglich ist! Als hätten die Generationen der Nachkriegsgesellschaft nicht aus gutem Grund alles dafür getan, dass ein offener kultureller, ästhetisch kritischer, künstlerisch engagierter Austausch im öffentlichen Leben stattfinden kann! Es ist mir unbegreiflich, wie leichtfertig und in wie kurzer Zeit dieses Erbe verspielt worden ist! Um sich dem Diktat des kommerziellen Erfolgs auszuliefern! Als mache es qualitativ einen Unterschied, ob der Markt oder eine Diktatur die ästhetischen Prämissen bestimmt! Als hätte man einfach den Sozialistischen Realismus durch einen Konsumistischen Realismus ersetzt! Aber wie in Okwui Enwezors Artikel passt auch hierher das schöne Antonio Gramsci-Zitat: „Pessimismus des Intellekts, Optimismus des Willens“. In gewissem Sinn agiert Kunst immer von einem verlorenen Posten aus, besser gesagt, von einem Posten, den es noch gar nicht gibt. Kunst IST immer eine Position neuer Möglichkeiten. Die Problem ist wie gesagt ein politisches: Ob die Gesellschaft noch offen genug ist, diese Positionen im öffentlichen Raum zuzulassen, bzw. wie wir es schaffen, diese Offenheit wieder einzufordern und zurückzuerobern. Die Bedingungen dafür sind derzeit natürlich denkbar schlecht. Aber die Leere, die der kommerzielle Status quo erzeugt hat und noch immer gnadenloser erzeugen wird, wird sich schließlich selbst erledigen. Die Frage ist nur, wie hoch der Preis sein wird, den wir dafür bezahlen müssen, bis es soweit ist. Und ob und wie man bis dahin als Künstler ökonomisch überlebt.
Wozu noch Literatur?
Sie sind auch Autor sehr vieler Essays, eine Textform, bei der man Reflexionen für gewöhnlich unmittelbarer formulieren kann als in der Literatur. Überspitzt gefragt: Warum eigentlich überhaupt noch Romane schreiben?
Aber die Literatur ist doch die höchste, weil die am tiefsten ihre Gegenwart durchdringende Form des Schreibens! Die ästhetischen Mittel und ihre permanente Erneuerung sind Werkzeuge eines Wissenssystems! Ihre Geschichte ein Wissensspeicher! Und der Roman als Kunstform ein seismographisches Instrument, um den sich verändernden Existenzbedingungen nachzuspüren, sie überhaupt erst ins Bewusstsein zu heben! Das gerade ist es ja, was der Markt mit seiner Verkürzung der literarischen Produktion zur Saisonware, mit seiner Top-oder-Flop-Mentalität kaputt gemacht hat! Wie Milan Kundera in Die Kunst des Romans schreibt, „besteht die einzige Raison d`être eines Romans darin, etwas zu entdecken, was allein der Roman entdecken kann. Ein Roman, der keinen bislang unbekannten Bereich der Existenz entdeckt, ist unmoralisch. Erkenntnis ist die einzige Moral des Romans.“ Der Roman kann das leisten, weil er eben mehr ist als unmittelbar formulierte Reflexion. Eben weil er – mit Robert Musil zu sprechen – eine Möglichkeitsform ist.
Wenn ich Essays schreibe, beziehe ich Standpunkte und vertrete dann meine Positionen. Ich kann den Essay literarisieren, also an erzählende Prosa heranführen, indem ich Ambivalenzen und Widersprüche zulasse, um der Enge und Einseitigkeit von Standpunkten und Positionen einigermaßen zu entkommen, wie Susan Sontag das gemacht hat. Aber beim Romanschreiben lasse ich diese Einseitigkeit von vornherein hinter mir. Der Raum des Fiktionalen ermöglicht mir den Entwurf ganzer, auch in sich widersprüchlicher Lebenswirklichkeiten, die sich wiederum an anderen Lebenswirklichkeiten reiben, mit ihnen kollidieren oder ineinanderfließen. Aus dem Prozess dieser Kollisionen und Vermischungen wächst vegetativ oder prozesshaft seine komplexe Architektur, die mich, wenn der Bau gelingt, tatsächlich zu neuen Erkenntnissen führen kann, und zwar in einem Bereich, der mir durch reine Reflexion nicht zugänglich wäre. Erst wenn der Roman fertig ist, weiß ich, was er zur Sprache bringt, was ich allmählich darin zur Sprache gebracht habe und vorher nicht hätte sagen oder denken können. Deshalb schreibe ich Romane.
Das Hauptfigurenpaar in Die Einzigen erlebt auf unterschiedliche Weise die klassische Dramakurve aus erfolgreichem Aufstieg und tiefem Fall. Am Ende wird zumindest die Möglichkeit angedeutet, dass die eigene Kunst in Zukunft den privaten Raum nicht mehr verlassen wird. Die Gretchenfrage: Wie halten Sie es mit der Kunst – würden Sie auch nur für das eigene Wohnzimmer schreiben?
Die Antwort ist eindeutig nein. Kunst ist ein Kommunikationsmedium, radikal formuliert: die einzige Kommunikationsform neben der Liebe, weil sie immerhin versucht zu einer Sprache zu kommen, oder zu Zeichen und Klängen, die als Zeichen und Klänge wahrgenommen werden können. (Und dass die Liebe eine Kunst ist, darüber hat nicht nur Stendhal ein berühmtes Buch verfasst, sondern zeigt, wie eng verwandt beide Sphären sind.) Kunst braucht Hallraum, so winzig auch immer er sein mag. Davon handelt der Schluss des Romans. Harry kann Marlene endlich hören, vielleicht hören. Das setzt einen echten Anfang, das ist ein Aufbruch. So viel Utopie war noch nie in meiner Prosa! Ich muss noch einmal daran erinnern, dass wir es hier mit einer fiktionalen Setzung zu tun haben, nicht mit einer These. Die Setzung besteht darin, dass Marlene mit ihrer Kunst an den Realitäten des Kunstgeschäfts zerschellt ist, vermutlich sogar mit Vorsatz zerschellt ist. Aber sie hört ja nicht auf damit, Künstlerin zu sein. Sie lehrt an der Uni ihre Musikphilosophie, sie begeistert eine wachsende Menge von Studenten für ihre ästhetischen Ansätze, sie bleibt neugierig auf zeitgenössische Strömungen, auf das, was die jungen Musiker machen, sie arbeitet im Stillen für sich an ihrem neuen Work in Progress, genau wie es früher schon getan hat. Alles ist offen, sendet gewissermaßen seine Schwingungen hinaus in die Zukunft.
Mit anderen Worten – Marlene ist im Begriff, selbst am Entstehen von Hallraum mitzuwirken. Dass auch das zu ihrem „Job“ gehören könnte, dass es gefährlich sein könnte, diesen Hallraum einem Apparat, einem System, einer Ideologie zu überlassen, ist vielleicht das, was ihre Erfahrungen sie gelehrt haben. Mit Harry schafft sie einen Neubeginn, so wie Harry umgekehrt mit ihr einen Neubeginn schafft. Er wird für sie womöglich für lange Zeit ihr einziger Hallraum bleiben. So wie sich dieser Hallraum für Gottfried Benn während der Nazizeit in einer einzigen Person, dem Bremer Großkaufmann F. W. Oelze verkörpert hat. Erst wo er ganz fehlt, beginnt das Verstummen, beginnt dieses „Die Mauern stehn / Sprachlos und kalt, im Winde / Klirren die Fahnen“, wie es bei Hölderlin heißt. Aber für Marlene besteht durchaus Aussicht, dass er sich wieder erweitert.
Zuletzt noch eine Frage zur Entstehung: Schreiben und Publikation des Romans waren ja keine ganz leichte Geburt. Trifft für Sie Thomas Bernhards Diktum zu, dass Wahres nur in Reibung mit großen Widerständen entstehen kann?
Kann gut sein. Ich glaube allerdings, nur in diesem Fall. Sagen wir so: Die Einzigen wären vielleicht ein kleines bisschen weniger radikal geworden ohne diese Reibungen, die gewissermaßen als hautnahe Recherche indirekt mit in den Roman eingeflossen sind. Gewöhnlich braucht es aber niemand, der einem Knüppel zwischen die Beine wirft, um diese Reibungen zu erzeugen, dazu reicht schon allein unsere Lebenswirklichkeit aus. Im Übrigen begleitete genauso viel, mindestens genauso viel Konstruktives und Ermutigendes das Entstehen und die Veröffentlichung dieses Romans. Ohne den Zuspruch und die Unterstützung vieler Schriftstellerkollegen und –freunde hätte ich die Niederschrift vielleicht wirklich nicht bis zum Ende durchgehalten. Was mir aber andererseits gezeigt hat, dass der Hallraum für meine künstlerische Arbeit vielleicht noch nicht ganz so zusammengestaucht ist, wie das bei Marlene der Fall ist. Wie ja auch unter anderem unser Interview zeigt, die Tatsache, dass wir es führen und es dann auf dem Literaturportal ins Netz gestellt wird.
(In Kooperation mit der autorenedition sarabande)
Im Gespräch: der Schriftsteller Norbert Niemann
Bekannt wurde der Schriftsteller und Essayist Norbert Niemann mit einer Reihe großer, komplexer Zeitromane. In den Achtzigerjahren stand er auch als Musiker der New-Wave-Band Diebe der Nacht auf der Bühne, ein Thema, das nun in seinem neuen, hochgelobten Roman Die Einzigen (Berlin Verlag, 2014) wiederkehrt. Am kommenden Mittwoch, dem 20. Mai 2015, wird Norbert Niemann in München mit dem Carl-Amery-Preis ausgezeichnet. Die Laudatio hält Tilman Spengler. Mit uns sprach Niemann über seinen neuen Roman, über literarisches Engagement – und über Widerstand.
*
Literaturportal Bayern: In Ihrem Roman brodelt unter der relativ ruhigen Textoberfläche ein alter, fast epischer Kampf, jener zwischen Kunst und Leben – und das zu Zeiten scheinbar überall siegreicher Konsumideologie. Inwiefern beschäftigt Sie die Frage nach einer Ästhetik des Widerstands? Wie wehrhaft kann Literatur gegenüber dem ‚Angesagten‘ noch sein?
Norbert Niemann: Die Frage ist gar nicht leicht zu beantworten, weil sie den Kern meines Literaturbegriffs berührt. Widerständigkeit, Wehrhaftigkeit – das sind für mich Haltungen, die grundsätzlich und essentiell zur Literatur, zu allen Künsten gehören. Ohne sie wird aus jedem vermeintlichen Kunstwerk allenfalls so etwas wie ein kunstförmiges Produkt. Künstlerische Ästhetiken verändern sich deshalb, weil gesellschaftliche Realitäten sich verändern. In ihnen spiegeln sich diese Veränderungen. Ich habe den Impuls, Kunstwerke zu schaffen, immer so verstanden, dass die vorhandene Sprache, die vorhandenen Zeichensysteme nicht mehr ausreichen, um die je zeitgenössischen Lebenswirklichkeiten zu formulieren, dass diese Sprache, diese Zeichen besetzt sind, sich entleert haben, entleert worden sind, dass es in der Literatur darum geht, die Sprache immer wieder neu zu erfinden, statt nur nachzuahmen, was nicht mehr in der Lage ist, das Reale zu kommunizieren. Widerständigkeit meint also in erster Linie diesen existenziellen, genuin künstlerischen Zugriff für mich, der dann zwangsläufig auch ein politischer Zugriff wird, weil sich in dieser Besetzung und Entleerung von Zeichen und Sprache die jeweiligen Herrschaftsformen manifestieren.
Andererseits ruft „Ästhetik des Widerstands“ sofort diese spezifische Aura des gleichnamigen Werks von Peter Weiss auf, die in meinen Augen selbst inzwischen für einen doch reichlich historisch gewordenen Ansatz steht: Literarisches Erzählen als Geschichte des Klassenkampfs, der Arbeiterbewegung, als Kampf gegen den Faschismus usw. Er scheint mir unter den gegenwärtigen Bedingungen von Herrschaft und Ausbeutung im globalisierten und digitalisierten Ökonomismus nicht mehr recht zu greifen. Weil sich die Machtstrukturen massiv verändert haben. Weil die Ästhetisierung des Politischen Ausmaße angenommen hat, von denen sich nicht einmal Walter Benjamin hätte träumen lassen. Weil diese Politik der ästhetischen Zurichtung ganz direkt und schamlos offen in die Voraussetzungen für die Entstehung und Verbreitung von Kunst eingreift. Der Begriff im Sinn von Peter Weiss kann sogar dazu verführen, sich in alten bequemen Positionen einzurichten, das Nachdenken über die veränderte Ausgangslage einzustellen. Ich meine damit natürlich keineswegs, dass diese Ästhetik des Widerstands grundsätzlich obsolet geworden wäre. Im Gegenteil wird die Klassenfrage in atemberaubendem Tempo von Jahr zu Jahr aktueller. Aber ein Blick auf die Gegenwart, der sich verengt auf die Oberflächenbewegungen sozialer Spannungen im Zuge der heutigen Umverteilung von unten nach oben, schwebt in Gefahr blind zu sein für die Herrschaftsmechanismen, die unter dieser Oberfläche wirksam sind. Dazu gehören nun einmal wesentlich auch Fragen der ästhetischen Freiheit. Ob das, was als Widerstand gedacht ist, sich diesen Mechanismen überhaupt noch entgegenstellen kann, ob es sie nicht vielleicht sogar unbewusst bedient und verstärkt.
Der Erfolg des Ökonomismus wäre ohne die Digitalisierung ja gar nicht denkbar gewesen. Erst im Zusammenspiel mit der flächendeckenden medialen Omnipräsenz des Marktes ist der Wirtschaft und der Finanzindustrie diese Usurpation der politischen Macht gelungen, die wir in den letzten fünfundzwanzig Jahren miterlebt haben. Nicht zufällig spielt die sogenannte Kreativwirtschaft heute eine so bedeutende Rolle. Das Wort „Konsumideologie“ bringt fast für sich schon auf den Punkt, worauf ich hinauswill: Auf der einen Seite das unentrinnbare Netzwerk einer digitalen Online-Realität, das sich immer enger um uns zusammenzieht, auf der anderen Seite wir, deren Marktplatz. Ich meine das buchstäblich: Unsere Gehirne, unsere Nervenbahnen, Muskeln, Eingeweide sind zum Schauplatz eine Konkurrenzkampfs um die Platzierung von Bedürfnis- und Wirklichkeitsmustern geworden. Das Joint Venture zwischen NSA, Google, Facebook usw. belegt das unmissverständlich. Dass die Künste seit einigen Jahren immer stärker ökonomischen Kriterien unterworfen werden, um überhaupt noch öffentlich wahrgenommen zu werden, dass sie dabei immer rigider in ihrer Substanz beschnitten, ihres kritischen Potentials beraubt werden, ist ja nicht nur auf die Literatur beschränkt. Erst kürzlich hat Okwui Enwezor, der das Münchner Haus der Kunst leitet, in der SZ den gleichen Prozess für die Bildenden Künste beschrieben. Und das Pop-Business rekrutiert seine Popstarmarionetten ohnehin längst im Casting-Show-Rampenlicht, wo junge Talente nach den Reißbrettvorgaben der Vermarktbarkeit selektiert und zurechtgestutzt werden. Was unten herauskommt, hat dann naturgemäß kaum noch etwas mit Kunst zu tun.
Aus alldem ergibt sich, dass die Frage nicht lautet, ob Literatur noch wehrhaft gegenüber dem Angesagten ist oder sein kann, sondern dass Texte überhaupt nur dann beanspruchen können, Literatur zu sein, wenn es ihnen gelingt, diese Wehrhaftigkeit zu gestalten. Der Rest ist Kunsthandwerk, und wo er als Literatur verkauft wird, Betrug im Dienst des Profits. Die Frage lautet also vielmehr, wie und wo Literatur und Kunst überhaupt noch als Literatur und Kunst für ihr Publikum sichtbar werden können. Und das wiederum ist eine überaus politische Frage. Literatur und Kunst selbst sind ja nicht zerstörbar, sie sind immer da. Doch in welchem Grad sie in einer Gesellschaft auch präsent sind, daran lässt sich ablesen, wie offen diese Gesellschaft noch ist.
Wie schreibt man über Musik?
Eine gewisse Radikalität Ihres Ästhetikbegriffs besteht ja gerade darin, dass man bei diesem Roman zwischen Kunst und Künstlichkeit unterscheiden muss. Die Sprache jongliert nicht selbstverliebt, sondern wirkt diszipliniert. Zum Beispiel spielt Musik eine buchstäblich tragende Rolle – auch für die Metaebene – da wäre es doch sehr verlockend gewesen, selbst schreibend zu ‚musizieren‘. Doch dieser Lockung widersteht die Sprache. Wie war Ihre Konzeption, über Musik zu schreiben – ohnehin schon unglaublich schwer und noch dazu über eine zum Teil experimentelle Art, die es so für den Laien noch gar nicht gibt?
Das war das Schwierigste an diesem Roman, auch der Hauptgrund, warum es so viel Zeit in Anspruch genommen hat, ihn zu schreiben. Es gibt so gut wie keine Tradition für das, was ich versucht habe, nämlich das Musikerlebnis selbst sprachlich einzufangen. Man gelangt schnell an ein Ende damit, wenn man sich auf Adjektive und Substantivierungen für Klänge und Geräusche beschränkt, kommt übers Dröhnen und Brausen und Jaulen und Zwitschern und Zittern nicht hinaus. Das bleibt dann abstrakt wie eine Serie von Interpretationsanweisungen in einer Partitur, die erst den Interpreten braucht, um sinnlich nachvollziehbar zu werden. Deshalb wählen Schriftsteller, wenn sie über Musik schreiben, gewöhnlich den Umweg über die Musiktheorie, die Musikgeschichte, die Musikphilosophie. Thomas Manns Doktor Faustus ist das berühmteste Beispiel dafür (bekanntlich hat ihm Theodor W. Adorno dabei geholfen). Eine andere Methode ist es eben, „schreibend zu musizieren“, wie Sie gesagt haben, in Anlehnung an die viel geübte Praxis, schreibend zu malen. Dabei handelt es sich dann aber um etwas ganz anderes: denn die Musik ist gar nicht das Sujet, sondern man kopiert nur gewisse kompositorische Formen oder rhythmische Muster in die Form, den Klang der Sprache hinein. Wie gesagt, Musik entzieht sich den Wörtern, denn „Musik ist keine Sprache“, wie Marlene Krahl im Roman einmal sagt. Auch im Gehirn sind für Musik und Sprache ganz unterschiedliche Zentren zuständig. Man kann das bei Oliver Sacks in seinem Buch Musicophilia (deutsch: Der einarmige Pianist) nachlesen, das ich vor zwei Jahren in eine Bühnenfassung gebracht habe.
Was mich interessierte, war vielmehr eine Übersetzung von Musik in Sprache. Ich kannte bis vor kurzem nur ein historisches Beispiel dafür: Marcel Proust, der in der Recherche immer wieder dieser Sonate von Vintieul nahezukommen versucht, und zwar als purem Hörerlebnis. (Inzwischen, nach einer Lesung aus Die Einzigen, hat mich eine Zuhörerin noch auf einen andern Text gebracht: auf das Buch Heller als die Sonne des britischen Musikjournalisten Kodwo Eshun, der etwas Ähnliches versucht für die schwarze elektronische Musik seit Sun Ra, Miles Davis, Herbie Hancock, George Russell in den siebziger Jahren bis heute.) Ich musste erst einmal begreifen, dass ich für diesen Übersetzungsvorgang völlig in die Innenperspektive von Harry begeben muss, also der Figur, die der Musik ausgeliefert ist. Dabei stellte es sich als Vorteil heraus, dass Harry mit Marlenes Musik anfangs wenig anfangen kann, sich selbst erst im Laufe des Romans an ein Verständnis ihrer Kompositionen herantastet. Dass es ihm also ähnlich geht, wie den meisten Laien. Ich habe daher in erster Linie den Prozess von Harrys Annäherung an diese Musik abzubilden versucht, und das konnte nur gelingen, indem ich über das schrieb, was Harry gleichzeitig, während er zuhört, sieht, assoziiert, halluziniert und ganz physisch empfindet. Über den Roman verstreut, wählt Harry für diese sinnliche Annäherung verschiedene Umwege oder Ansätze: er hält sich an Marlenes Körperbewegungen, hat surreale Wahrnehmungen, entwickelt Bilderfolgen. Bei dem Kapitel über Chris Cunningham und Aphex Twin dreht er den Ton ab, um genauer hören zu können, was in seinem Innern ohnehin erklingt. Bei Marlenes Auftritt im La Fenice ist Harry wie taub, und die Musik stellt sich ihm nur über die „dramatische Handlung“ im Opernhaus zwischen Marlene und dem Publikum dar. Diese Herangehensweise bildete also den Schwerpunkt bei meiner sprachlichen Annäherung an die Musik, in die dann natürlich auch Elemente von Rhythmisierung und Lautmalerei, auch Musikhistorisches und Musikphilosophisches mit aufgenommen wurden, aber eben nur auf einer untergeordneten Ebene.
Die Hauptfigur Harry denkt ganz am Schluss nochmal an seine frühere Zeit zurück, als er und viele andere Künstler fest glaubten, die Gesellschaft verändern zu können, zumindest ihre Wahrnehmung. Halb amüsiert er sich dabei über die eigene Naivität, halb trauert er über den Verlust dieses Glaubens. Wie ist das bei Ihnen als Verfasser von ‚Zeitromanen‘, die ja durchaus einem engagierten Impetus entspringen? Muss man da im vielbeschworenen ‚Niedergang des Intellektuellen‘ nicht verzweifeln? Oder ist gerade der verlorene Posten eine Position neuer Möglichkeiten?
Natürlich bin ich da oft vollkommen fassungslos! Dass das in diesem Land, mit dieser Geschichte möglich ist! Als hätten die Generationen der Nachkriegsgesellschaft nicht aus gutem Grund alles dafür getan, dass ein offener kultureller, ästhetisch kritischer, künstlerisch engagierter Austausch im öffentlichen Leben stattfinden kann! Es ist mir unbegreiflich, wie leichtfertig und in wie kurzer Zeit dieses Erbe verspielt worden ist! Um sich dem Diktat des kommerziellen Erfolgs auszuliefern! Als mache es qualitativ einen Unterschied, ob der Markt oder eine Diktatur die ästhetischen Prämissen bestimmt! Als hätte man einfach den Sozialistischen Realismus durch einen Konsumistischen Realismus ersetzt! Aber wie in Okwui Enwezors Artikel passt auch hierher das schöne Antonio Gramsci-Zitat: „Pessimismus des Intellekts, Optimismus des Willens“. In gewissem Sinn agiert Kunst immer von einem verlorenen Posten aus, besser gesagt, von einem Posten, den es noch gar nicht gibt. Kunst IST immer eine Position neuer Möglichkeiten. Die Problem ist wie gesagt ein politisches: Ob die Gesellschaft noch offen genug ist, diese Positionen im öffentlichen Raum zuzulassen, bzw. wie wir es schaffen, diese Offenheit wieder einzufordern und zurückzuerobern. Die Bedingungen dafür sind derzeit natürlich denkbar schlecht. Aber die Leere, die der kommerzielle Status quo erzeugt hat und noch immer gnadenloser erzeugen wird, wird sich schließlich selbst erledigen. Die Frage ist nur, wie hoch der Preis sein wird, den wir dafür bezahlen müssen, bis es soweit ist. Und ob und wie man bis dahin als Künstler ökonomisch überlebt.
Wozu noch Literatur?
Sie sind auch Autor sehr vieler Essays, eine Textform, bei der man Reflexionen für gewöhnlich unmittelbarer formulieren kann als in der Literatur. Überspitzt gefragt: Warum eigentlich überhaupt noch Romane schreiben?
Aber die Literatur ist doch die höchste, weil die am tiefsten ihre Gegenwart durchdringende Form des Schreibens! Die ästhetischen Mittel und ihre permanente Erneuerung sind Werkzeuge eines Wissenssystems! Ihre Geschichte ein Wissensspeicher! Und der Roman als Kunstform ein seismographisches Instrument, um den sich verändernden Existenzbedingungen nachzuspüren, sie überhaupt erst ins Bewusstsein zu heben! Das gerade ist es ja, was der Markt mit seiner Verkürzung der literarischen Produktion zur Saisonware, mit seiner Top-oder-Flop-Mentalität kaputt gemacht hat! Wie Milan Kundera in Die Kunst des Romans schreibt, „besteht die einzige Raison d`être eines Romans darin, etwas zu entdecken, was allein der Roman entdecken kann. Ein Roman, der keinen bislang unbekannten Bereich der Existenz entdeckt, ist unmoralisch. Erkenntnis ist die einzige Moral des Romans.“ Der Roman kann das leisten, weil er eben mehr ist als unmittelbar formulierte Reflexion. Eben weil er – mit Robert Musil zu sprechen – eine Möglichkeitsform ist.
Wenn ich Essays schreibe, beziehe ich Standpunkte und vertrete dann meine Positionen. Ich kann den Essay literarisieren, also an erzählende Prosa heranführen, indem ich Ambivalenzen und Widersprüche zulasse, um der Enge und Einseitigkeit von Standpunkten und Positionen einigermaßen zu entkommen, wie Susan Sontag das gemacht hat. Aber beim Romanschreiben lasse ich diese Einseitigkeit von vornherein hinter mir. Der Raum des Fiktionalen ermöglicht mir den Entwurf ganzer, auch in sich widersprüchlicher Lebenswirklichkeiten, die sich wiederum an anderen Lebenswirklichkeiten reiben, mit ihnen kollidieren oder ineinanderfließen. Aus dem Prozess dieser Kollisionen und Vermischungen wächst vegetativ oder prozesshaft seine komplexe Architektur, die mich, wenn der Bau gelingt, tatsächlich zu neuen Erkenntnissen führen kann, und zwar in einem Bereich, der mir durch reine Reflexion nicht zugänglich wäre. Erst wenn der Roman fertig ist, weiß ich, was er zur Sprache bringt, was ich allmählich darin zur Sprache gebracht habe und vorher nicht hätte sagen oder denken können. Deshalb schreibe ich Romane.
Das Hauptfigurenpaar in Die Einzigen erlebt auf unterschiedliche Weise die klassische Dramakurve aus erfolgreichem Aufstieg und tiefem Fall. Am Ende wird zumindest die Möglichkeit angedeutet, dass die eigene Kunst in Zukunft den privaten Raum nicht mehr verlassen wird. Die Gretchenfrage: Wie halten Sie es mit der Kunst – würden Sie auch nur für das eigene Wohnzimmer schreiben?
Die Antwort ist eindeutig nein. Kunst ist ein Kommunikationsmedium, radikal formuliert: die einzige Kommunikationsform neben der Liebe, weil sie immerhin versucht zu einer Sprache zu kommen, oder zu Zeichen und Klängen, die als Zeichen und Klänge wahrgenommen werden können. (Und dass die Liebe eine Kunst ist, darüber hat nicht nur Stendhal ein berühmtes Buch verfasst, sondern zeigt, wie eng verwandt beide Sphären sind.) Kunst braucht Hallraum, so winzig auch immer er sein mag. Davon handelt der Schluss des Romans. Harry kann Marlene endlich hören, vielleicht hören. Das setzt einen echten Anfang, das ist ein Aufbruch. So viel Utopie war noch nie in meiner Prosa! Ich muss noch einmal daran erinnern, dass wir es hier mit einer fiktionalen Setzung zu tun haben, nicht mit einer These. Die Setzung besteht darin, dass Marlene mit ihrer Kunst an den Realitäten des Kunstgeschäfts zerschellt ist, vermutlich sogar mit Vorsatz zerschellt ist. Aber sie hört ja nicht auf damit, Künstlerin zu sein. Sie lehrt an der Uni ihre Musikphilosophie, sie begeistert eine wachsende Menge von Studenten für ihre ästhetischen Ansätze, sie bleibt neugierig auf zeitgenössische Strömungen, auf das, was die jungen Musiker machen, sie arbeitet im Stillen für sich an ihrem neuen Work in Progress, genau wie es früher schon getan hat. Alles ist offen, sendet gewissermaßen seine Schwingungen hinaus in die Zukunft.
Mit anderen Worten – Marlene ist im Begriff, selbst am Entstehen von Hallraum mitzuwirken. Dass auch das zu ihrem „Job“ gehören könnte, dass es gefährlich sein könnte, diesen Hallraum einem Apparat, einem System, einer Ideologie zu überlassen, ist vielleicht das, was ihre Erfahrungen sie gelehrt haben. Mit Harry schafft sie einen Neubeginn, so wie Harry umgekehrt mit ihr einen Neubeginn schafft. Er wird für sie womöglich für lange Zeit ihr einziger Hallraum bleiben. So wie sich dieser Hallraum für Gottfried Benn während der Nazizeit in einer einzigen Person, dem Bremer Großkaufmann F. W. Oelze verkörpert hat. Erst wo er ganz fehlt, beginnt das Verstummen, beginnt dieses „Die Mauern stehn / Sprachlos und kalt, im Winde / Klirren die Fahnen“, wie es bei Hölderlin heißt. Aber für Marlene besteht durchaus Aussicht, dass er sich wieder erweitert.
Zuletzt noch eine Frage zur Entstehung: Schreiben und Publikation des Romans waren ja keine ganz leichte Geburt. Trifft für Sie Thomas Bernhards Diktum zu, dass Wahres nur in Reibung mit großen Widerständen entstehen kann?
Kann gut sein. Ich glaube allerdings, nur in diesem Fall. Sagen wir so: Die Einzigen wären vielleicht ein kleines bisschen weniger radikal geworden ohne diese Reibungen, die gewissermaßen als hautnahe Recherche indirekt mit in den Roman eingeflossen sind. Gewöhnlich braucht es aber niemand, der einem Knüppel zwischen die Beine wirft, um diese Reibungen zu erzeugen, dazu reicht schon allein unsere Lebenswirklichkeit aus. Im Übrigen begleitete genauso viel, mindestens genauso viel Konstruktives und Ermutigendes das Entstehen und die Veröffentlichung dieses Romans. Ohne den Zuspruch und die Unterstützung vieler Schriftstellerkollegen und –freunde hätte ich die Niederschrift vielleicht wirklich nicht bis zum Ende durchgehalten. Was mir aber andererseits gezeigt hat, dass der Hallraum für meine künstlerische Arbeit vielleicht noch nicht ganz so zusammengestaucht ist, wie das bei Marlene der Fall ist. Wie ja auch unter anderem unser Interview zeigt, die Tatsache, dass wir es führen und es dann auf dem Literaturportal ins Netz gestellt wird.
(In Kooperation mit der autorenedition sarabande)