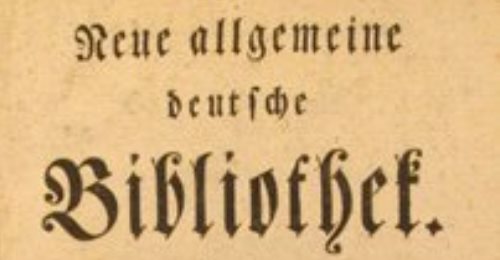Logen-Blog [471]: Des Autors Zanken und Kranken Zweiter Teil
Von der Staatsschelte geht's auf die Leser- und Rezensentenschelte: unvermittelt, meint der Leser, der doch auch gemeint ist. Ja, der Autor leidet an seinem Werk – und will es nicht ertragen, dass es verloren ginge: bei den Lesern, den Kritikern, ja schon in der Druckerei. Wozu denn die Plackerei, wenn dieses Buch auf dem Postwagen oder in der Druckerei so verdorben werden kann, dass das Publikum um das ganze Werk so gut wie gebracht ist. Wozu der ganze Schreib-Stress, wenn ein kritischer Brotherr und Kunstrichter-Ordengeneral seine Rezensenten mit ihren langen Zähnen sitzen hat, die meiner zarten Beata und ihrem Amanten Fleisch und Kleider abreißen und deren Stube jener Stube voll Spinnen gleicht, die ein gewisser Pariser hielt?
Jean Paul musste keine Sorge haben: das Werk war nicht ganz erfolglos, auch wenn der Herr von Knigge in der Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek von 1794 nicht so begeistert war, wie er es hätte sein sollen. Allein auch der zweite zeitgenössische Rezensent, dem's gefiel, kümmert sich recht eigentlich nicht um die zarte Beata und ihren Amanten – keiner von ihnen erläuterte die Handlung (nur Knigge ganz kurz den Schluss des Fragments), keiner von ihnen charakterisierte die Figuren, keiner von ihnen war willens oder in der Lage, die gar nicht so komplizierte Fabel dem werthen Leser mitzuteilen. Knigge empfahl am Ende seines Textes sogar, nicht allzu viel auf seine kritischen Einwände zu geben: der Autor solle sich nicht irre machen und die Fortsetzung folgen lassen.
Und der Sermon geht weiter, nun in einer Steigerung, die vom Fürsten über die Druckerei, dann den Kritiker, dann den Leser, der sich in einer merkwürdigen Beziehung zum Kritiker befindet (der Leser, der am meisten verlöre, wenn er mich nicht zu lesen bekäme; aber es ist diesem harten Menschen einerlei, was die ausstehen, die ihn ergötzen), wieder zu ihm selbst, dem Autor führt, der seine Quallebensbeschreibung mit biblischen Vokabeln würzt:
Hab' ich endlich meine Hand von diesen Nägeln des Kreuzes losgemacht: so ekelt mich das Leben selber an als ein so elendes langweiliges Ding von Monochord, dass jedem Angst werden muss, ders ausrechnet, wie oft er noch Atem holen und die Brust auf- und niederheben muss, bis sie erstarret, oder wie oft er sich bis zu seinem Tode noch auf den Stiefelknecht oder vor den Rasierspiegel werde heben müssen.
Der Satz klingt kompliziert, aber er sagt doch nur, dass er, der Autor, wenn er das Werk aus den Händen gegegeben hat, wieder auf sich selbst gestellt ist: in einer depressiven Verfassung, der es einerlei ist, ob er, der Autor, heute oder in zwanzig Jahren stirbt. Sieht so die Einsicht in die Sterblichkeit aus? So schwarz, so gleichgültig dem Leben gegenüber? Wo bleibt hier, fragt der Kritiker, die angebliche Geduld dem Leben gegenüber? Ist Jean Pauls Räsonieren nicht allzu nah an den bittersten Momenten des Ottomarschen Bewusstseins dran?
Man versteht's, wenn man den Film Und täglich grüßt das Murmeltier gesehen (Groundhog Day) und verstanden hat. Die Wiederkehr des Ewiggleichen-Immerselben in einem unterschiedslosen Raum der Zeit ist so stupide, dass sie bei intelligenteren Naturen leicht zu Depressionen führen könnte.
Ich betrachte oft die größte Armseligkeit im ganzen Leben, welche die wäre, wenn einer alle in dasselbe zerstreuet umhergesäete Rasuren, Frisuren, Ankleidungen, Sedes hintereinander abtun müsste.
Nein, Sterben ist nicht die Alternative, die sich einem Menschen, der liebt, auftun sollte:
Der dunkelste Nachtgedanke, der sich über meine etwa noch grünenden Prospekte lagert, ist der, dass der Tod in diesem nächtlichen Leben, wo das Dasein und die Freunde wie weit abgeteilte Lichter im finstern Bergwerk gehen, mir meine teure Geliebten aus den ohnmächtigen Händen ziehe und auf immer in verschüttete Särge einsperre, zu denen kein Sterblicher, sondern bloß die größte und unsichtbarste Hand den Schlüssel hat....
Am Ende bleiben doch die Liebe und die Freundschaft, die über allen Triumphen der zermalmenden Zeit und der Erkaltung der Sinne das Leben lebenswert machen: manchmal über Gräber hinweg[1], bisweilen im kostbarsten Gefühl: einmal geliebt zu haben und wiedergeliebt worden zu sein:
Hast du mir denn nicht schon so viel weggerissen? Würd' ich von Kummer oder von Eitelkeit des Lebens reden, wenn der bunte Jugend-Kreis noch nicht zerstückt, wenn das Farbenband der Freundschaft, das die Erde und ihren Schmelz noch an den Menschen heftet, noch nicht voneinander gesägt wäre bis auf ein oder zwei Fäden? – O du, den ich jetzo aus einer weiten Entfernung weinen höre, du bist nicht unglücklich, an dessen Brust ein geliebtes Herz erkaltet ist, sondern du bists, der ists, der an das verwesende denkt, wenn er sich über die Liebe des lebendigen Freundes freuen will, und der in der seligsten Umarmung sich fragt: „Wie lange werden wir einander noch fühlen?“...
Dieses alles tragende Gefühl aber vermag kein Kunstrichter-Ordengeneral und kein Leser, ja: kein Mensch zu zerstören. Ich bin sicher, dass Jean Paul dies wusste.
[1] Richard Wagner an Franz Liszt.
Logen-Blog [471]: Des Autors Zanken und Kranken Zweiter Teil
Von der Staatsschelte geht's auf die Leser- und Rezensentenschelte: unvermittelt, meint der Leser, der doch auch gemeint ist. Ja, der Autor leidet an seinem Werk – und will es nicht ertragen, dass es verloren ginge: bei den Lesern, den Kritikern, ja schon in der Druckerei. Wozu denn die Plackerei, wenn dieses Buch auf dem Postwagen oder in der Druckerei so verdorben werden kann, dass das Publikum um das ganze Werk so gut wie gebracht ist. Wozu der ganze Schreib-Stress, wenn ein kritischer Brotherr und Kunstrichter-Ordengeneral seine Rezensenten mit ihren langen Zähnen sitzen hat, die meiner zarten Beata und ihrem Amanten Fleisch und Kleider abreißen und deren Stube jener Stube voll Spinnen gleicht, die ein gewisser Pariser hielt?
Jean Paul musste keine Sorge haben: das Werk war nicht ganz erfolglos, auch wenn der Herr von Knigge in der Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek von 1794 nicht so begeistert war, wie er es hätte sein sollen. Allein auch der zweite zeitgenössische Rezensent, dem's gefiel, kümmert sich recht eigentlich nicht um die zarte Beata und ihren Amanten – keiner von ihnen erläuterte die Handlung (nur Knigge ganz kurz den Schluss des Fragments), keiner von ihnen charakterisierte die Figuren, keiner von ihnen war willens oder in der Lage, die gar nicht so komplizierte Fabel dem werthen Leser mitzuteilen. Knigge empfahl am Ende seines Textes sogar, nicht allzu viel auf seine kritischen Einwände zu geben: der Autor solle sich nicht irre machen und die Fortsetzung folgen lassen.
Und der Sermon geht weiter, nun in einer Steigerung, die vom Fürsten über die Druckerei, dann den Kritiker, dann den Leser, der sich in einer merkwürdigen Beziehung zum Kritiker befindet (der Leser, der am meisten verlöre, wenn er mich nicht zu lesen bekäme; aber es ist diesem harten Menschen einerlei, was die ausstehen, die ihn ergötzen), wieder zu ihm selbst, dem Autor führt, der seine Quallebensbeschreibung mit biblischen Vokabeln würzt:
Hab' ich endlich meine Hand von diesen Nägeln des Kreuzes losgemacht: so ekelt mich das Leben selber an als ein so elendes langweiliges Ding von Monochord, dass jedem Angst werden muss, ders ausrechnet, wie oft er noch Atem holen und die Brust auf- und niederheben muss, bis sie erstarret, oder wie oft er sich bis zu seinem Tode noch auf den Stiefelknecht oder vor den Rasierspiegel werde heben müssen.
Der Satz klingt kompliziert, aber er sagt doch nur, dass er, der Autor, wenn er das Werk aus den Händen gegegeben hat, wieder auf sich selbst gestellt ist: in einer depressiven Verfassung, der es einerlei ist, ob er, der Autor, heute oder in zwanzig Jahren stirbt. Sieht so die Einsicht in die Sterblichkeit aus? So schwarz, so gleichgültig dem Leben gegenüber? Wo bleibt hier, fragt der Kritiker, die angebliche Geduld dem Leben gegenüber? Ist Jean Pauls Räsonieren nicht allzu nah an den bittersten Momenten des Ottomarschen Bewusstseins dran?
Man versteht's, wenn man den Film Und täglich grüßt das Murmeltier gesehen (Groundhog Day) und verstanden hat. Die Wiederkehr des Ewiggleichen-Immerselben in einem unterschiedslosen Raum der Zeit ist so stupide, dass sie bei intelligenteren Naturen leicht zu Depressionen führen könnte.
Ich betrachte oft die größte Armseligkeit im ganzen Leben, welche die wäre, wenn einer alle in dasselbe zerstreuet umhergesäete Rasuren, Frisuren, Ankleidungen, Sedes hintereinander abtun müsste.
Nein, Sterben ist nicht die Alternative, die sich einem Menschen, der liebt, auftun sollte:
Der dunkelste Nachtgedanke, der sich über meine etwa noch grünenden Prospekte lagert, ist der, dass der Tod in diesem nächtlichen Leben, wo das Dasein und die Freunde wie weit abgeteilte Lichter im finstern Bergwerk gehen, mir meine teure Geliebten aus den ohnmächtigen Händen ziehe und auf immer in verschüttete Särge einsperre, zu denen kein Sterblicher, sondern bloß die größte und unsichtbarste Hand den Schlüssel hat....
Am Ende bleiben doch die Liebe und die Freundschaft, die über allen Triumphen der zermalmenden Zeit und der Erkaltung der Sinne das Leben lebenswert machen: manchmal über Gräber hinweg[1], bisweilen im kostbarsten Gefühl: einmal geliebt zu haben und wiedergeliebt worden zu sein:
Hast du mir denn nicht schon so viel weggerissen? Würd' ich von Kummer oder von Eitelkeit des Lebens reden, wenn der bunte Jugend-Kreis noch nicht zerstückt, wenn das Farbenband der Freundschaft, das die Erde und ihren Schmelz noch an den Menschen heftet, noch nicht voneinander gesägt wäre bis auf ein oder zwei Fäden? – O du, den ich jetzo aus einer weiten Entfernung weinen höre, du bist nicht unglücklich, an dessen Brust ein geliebtes Herz erkaltet ist, sondern du bists, der ists, der an das verwesende denkt, wenn er sich über die Liebe des lebendigen Freundes freuen will, und der in der seligsten Umarmung sich fragt: „Wie lange werden wir einander noch fühlen?“...
Dieses alles tragende Gefühl aber vermag kein Kunstrichter-Ordengeneral und kein Leser, ja: kein Mensch zu zerstören. Ich bin sicher, dass Jean Paul dies wusste.
[1] Richard Wagner an Franz Liszt.