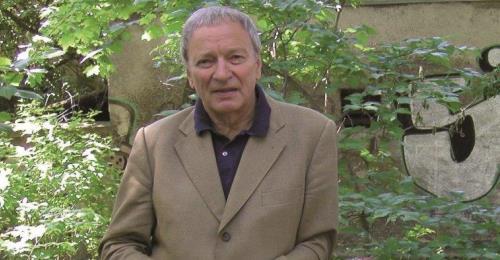Zum 85. Geburtstag von Uwe Timm
Seit über 50 Jahren ist Uwe Timm mit seinen Romanen, Essays und Kinderbüchern ein wichtiger Gestalter der deutschen Gegenwartsliteratur. Sein Werk nimmt stets Bezug auf unsere Zeitgeschichte und Gegenwart. Zu Timms 85. Geburtstag schreibt sein langjähriger Lektor und kommender Biograf Prof. Dr. Martin Hielscher für das Literaturportal Bayern einen kenntnisreichen, Orientierung gebenden Beitrag zu einem unserer wichtigsten Autoren.
*
Zu seinen frühesten Erinnerungen gehören zwei Bilder, riesige Fackeln links und rechts der Straße und in der Luft schwebende kleine Flämmchen, Bilder, die erst viele Jahre später im Erzählen, im familiären Erzählen und im nachforschenden Aufschreiben, das nicht glätten oder beschönigen will, ihre Erklärung finden. Es sind Erinnerungen an den Hamburger Feuersturm, die „Operation Gomorrha“ genannten Bombenangriffe britischer und amerikanischer Verbände auf die Stadt im Sommer 1943. Die Wohnung der Familie Timm wird am 25. Juli 1943 zerstört, der Vater und die Schwester können noch ein paar Gegenstände aus dem dritten Stock retten, bevor das Haus einstürzt, die Mutter wartet mit dem dreijährigen Sohn unten auf der Straße. Das Kind liegt, zugedeckt mit nassen Handtüchern, im Kinderwagen und wird, links und rechts die brennenden Bäume – das sind die Fackeln – durch die Osterstraße geschoben. Die Flämmchen in der Luft – es sind die aus den brennenden Häusern gerissenen Gardinenfetzen. Noch eine frühe Erinnerung: Der Dreijährige kommt aus dem Garten in die Küche, man deutet auf den Besenschrank, hinter dem ein blonder Schopf zu erkennen ist: Weißt du, wer das ist? Dann wird der kleine Uwe hochgehoben und jubelnd herumgeschwenkt – es ist die einzige eigene Erinnerung an den 16 Jahre älteren Bruder Karl-Heinz, der am 16.10.1943 in einem Lazarett in der Ukraine an seinen schweren Kriegsverletzungen stirbt.
Jahrzehnte später wird Uwe Timm in einem Buch über seine Familie und den Bruder diese frühen, einst unbegriffenen Erinnerungsbilder aufgreifen und zugleich der Frage nachgehen, warum der Bruder sich freiwillig zum Dienst in der Waffen-SS gemeldet hatte. Woher kommt der Vernichtungswille, der Militarismus und Empathieverlust der Deutschen und warum konnte Uwe Timm – wie Teile seiner Generation – eine ganz andere Haltung einnehmen? Schon früh, angeregt durch Kollegen und Vorgesetzte während seiner Lehrzeit als Kürschner in seiner Geburtsstadt Hamburg, wird Timm auf die Verwerfungen und Katastrophen der jüngsten Vergangenheit, den Krieg und den Nationalsozialismus und seine Ursachen, aufmerksam gemacht, aber auch auf die große Literatur. Seit einem Erweckungserlebnis in der Schule ein glühender Leser, beginnt er nun auch, Salinger und Dostojewski, Kafka und Benn für sich zu entdecken und erklärt, wofür ihn die Kürschnerkollegen verspotten, er wolle Schriftsteller werden.
Aufklärerisches Anliegen
Und so ist Uwe Timm seit seinem ersten Roman Heißer Sommer von 1974 in seinem inzwischen umfangreichen Werk einer über vielfältige und verschlungene Wege doch erkennbaren literarischen Spur gefolgt, die den Bedeutungs- und Erfahrungsraum der Kindheit zu einem gesellschaftlichen Raum erweitert – und damit zum Bewusstsein von Zeitgenossenschaft. Was einem in die Wiege gelegt ist, erweist sich als geschichtlich codiert. Der seit seinem Erscheinen immer lieferbar gebliebene Heißer Sommer ist nicht nur der kanonische Roman über die deutsche Studentenbewegung und die Entwicklung seiner Hauptfigur Ullrich Krause hin zu einem engagierten Bürger, übrigens von einer bemerkenswerten Frische, ja Aktualität. Und er ist nicht bloß ein Zeit- und Gesellschaftsroman, was man zu Recht über alle von Timms Romanen sagen kann, die eine Form episch-poetischer Geschichtsschreibung darstellen. Heißer Sommer ist auch eine Liebesgeschichte, ein Roman über das Geschichtenerzählen, das Begehren und den Widerstand. Es sind diese Elemente, die man auch im weiteren Werk Timms immer wieder antreffen kann.
Timm ist ein Autor des In-der-Welt-Seins, der das Erzählen, Ängste und Begehren, Wünsche und Schrecken, das Gefürchtete und das Utopische in der Erzählbarkeit und Lesbarkeit der Welt ansiedelt und dort auch findet, nicht in einer Art Weltinnenraum.
Der erzählerische Raum ist offen für das Magische, Märchenhafte, Mythische, aber, das ist das Aufklärerische, Politische an Timms Werken, es kommt nicht aus einem numinosen Irgendwo, es kommt aus dem Echoraum, aus der Knochenkammer, aus den Paradiesgärten der Geschichte und der literarischen Tradition, ja des geschriebenen Wortes überhaupt. Und das menschliche Wünschen und Begehren, der Wunsch nach Selbstfindung und Bezug, nach Würde sowie die Notwendigkeit des Widerstands drängen zur Sprache, zum Sprechen, zum Erzählen, zur Geschichte (im Sinne von Story) und Anekdote. Das kollektive, immer schon emotional aufgeladene, nicht selten humoristische Erzählen des Alltags, die auch subversive Produktivität des Mündlichen sind eine der Quellen von Timms Schreiben.
Er ist also ein Chronist der deutschen Geschichte und Mentalität, insbesondere im 20. Jahrhundert, ein Chronist der Bundesrepublik und ihrer Vorgeschichte, etwa im Nationalsozialismus, im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust, und ihres Nachwirkens und der neuen Realitäten der Bonner und Berliner Republik. Dabei hat Timm mit seinem zweiten Roman Morenga (1978) zudem ein in der deutschsprachigen Literatur seltenes Beispiel für einen postkolonialen Roman geschaffen. Dieser begibt sich zurück in die deutsche Kolonialgeschichte in „Deutsch-Südwest“ im Süden Afrikas und lässt zugleich in seiner hybriden Form als Mischung von Entwicklungs- und Dokumentarroman den Ort des Fremden und Anderen sozusagen leer und füllt ihn höchstens stellvertretend mit drei langen Exkursen, die streng genommen von Zugochsen erzählt werden. Ein Element, das ihm übrigens ein Freund und literarischer Weggefährte, der Schriftsteller und Psychiater Heinar Kipphardt, unbedingt hatte ausreden wollen.
Uwe Timm ist ein Autor der Städte, mehr als der Provinz, wenn auch durchaus einer der Landschaft und wenn es die der Wolken ist. Der urbane Raum etwa Hamburgs, Münchens, Berlins oder Roms ist wiederum einer der Vielfalt der Lebensformen und Begegnungen, der Zeichen, Sprachen, Spuren und auch Gräber und Ruinen.
Geheimnisvolles Beziehungsgeflecht
In Uwe Timms großem Werk, Romanen wie Der Mann auf dem Hochrad, Kopfjäger, der Berliner Trilogie Johannisnacht, Rot und Halbschatten, Romanen wie Vogelweide und Ikarien, Novellen wie der Entdeckung der Currywurst und Freitisch, Erzählungen, Essays wie Der Verrückte in den Dünen, Vorlesungen und Kinderbüchern wie dem besonders erfolgreichen Rennschwein Rudi Rüssel werden die Themen und Motive, die man schon in seinen Anfängen, zu denen auch Gedichte gehören, kennengelernt hat, auf immer neue Weise entfaltet und weitergetrieben. Eigen und gewissermaßen unvorhersehbar bilden die Werke ein geheimnisvolles Beziehungsgeflecht und antworten aufeinander.
Ein seit dem auf einen zweijährigen Aufenthalt zurückgehenden Rom-Buch von 1989 „Vogel, friss die Feige nicht“ (jetzt Römische Aufzeichnungen) sich immer stärker artikulierendes autobiografisches Moment tritt hinzu, das sich gerade auch in kürzeren Texten, Reden, Vorträgen und Essays zusätzlich niederschlägt, wie etwa in seinem Essay über Grimms Märchen „Der Lichtspalt unter der Zimmertür“. Besonders starke Beachtung fanden und finden die autobiografischen Werke Am Beispiel meines Bruders (auf das oben Bezug genommen wurde), Der Freund und der Fremde und jüngst der Band Alle meine Geister, der zeitlich die Lücke zwischen dem Bruder-Buch und dem Benno Ohnesorg-Band Der Freund und der Fremde schließt. Denn Timm holte nach dem erfolgreichen Abschluss der Kürschnerlehre und der Sanierung des elterlichen Pelzgeschäfts in Hamburg („Pelze Timm“) das Abitur auf dem Braunschweig-Kolleg nach, wo er den Dekorateur Benno Ohnesorg, der zarte Gedichte schrieb, kennenlernte. Auch Timms Engagement in der Studentenbewegung und einige Jahre in der DKP hatte, wie seine lebenslange Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Voraussetzungen, eine persönliche Vorgeschichte. Die Erschießung Benno Ohnesorgs am 2. Juni 1967 in Berlin am Rande der Anti-Schah-Demonstration war nicht nur das tragische Fanal für die deutsche Studentenbewegung. Es war für Uwe Timm der Verlust eines engen Freundes, mit dem er zum ersten Mal über sein Schreiben sprechen und sich über die eigenen Texte austauschen konnte.
Uwe Timms Werk, in annähernd 20 Sprachen übersetzt, ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt etwa mit dem Heinrich-Böll-Preis und der Carl-Zuckmayer-Medaille, dem Premio Napoli und dem Premio Mondello, dem Kulturellen Ehrenpreis der Landeshauptstadt München, dem Schillerpreis der Stadt Mannheim und dem Lessing-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg.
Belesener, vielseitig gebildeter Schriftsteller
Timm, am 30. März 1940 in Hamburg geboren, studierte nach seiner Lehre, der Entschuldung des väterlichen Pelzgeschäfts, das er infolge des plötzlichen Todes des Vaters 1958 übernahm, und dem nachgeholten Abitur Germanistik und Philosophie in München und Paris. Er wurde mit einer Arbeit über Albert Camus promoviert, lebt in München und ist oft in Berlin, wo die Timms eine Wohnung haben. Er ist seit 1969 mit der Autorin und Übersetzerin Dagmar Ploetz verheiratet und hat vier Kinder (weshalb es genau vier Kinderbücher von Timm gibt.) Er hat Drehbücher geschrieben, Literaturseminare geleitet, eine Gastprofessur in Argentinien übernommen, sein Werk ist in Deutschland Schullektüre und an vielen Universitäten im In- und Ausland Seminar- und Prüfungsstoff. Immer mehr wissenschaftliche Arbeiten werden darüber geschrieben, und Timm ist gelegentlich Gast von Politikern wie Horst Köhler und Frank-Walter Steinmeier auf Reisen nach Afrika und Lateinamerika gewesen.
Timm ist ein sehr belesener, vielseitig gebildeter Schriftsteller. Shakespeare, Goethe, Hölderlin, Thomas Mann, Ingeborg Bachmann, aber auch García Márquez und die Märchen der Brüder Grimm ebenso wie die Odyssee und die Bibel haben ihre Spuren in seinem Werk hinterlassen – und nicht zuletzt Walther von der Vogelweide, dessen Name auch den Titel eines Timm-Romans schmückt, in dem das Motiv der „Geister“, das dem aktuellen autobiografischen Buch nun ebenfalls den Titel verleiht, besonders zum Tragen kommt.
Vogelweide, 2013 erschienen, ist eine Liebesgeschichte, ein Gesellschafts- und Zeitroman, ein Roman über das Begehren, das Erzählen und den Abschied. Der Roman spielt in der Erzählgegenwart auf einer Vogelinsel in der Elbe vor Hamburg, die Timm aus seiner Kindheit kennt und auf der die Hauptfigur Eschenbach, nachdem ihm sein Leben auseinandergebrochen ist, für eine Zeitlang den Dienst eines Vogelwarts verrichtet. Es ist die Geschichte von Paaren in der Gegenwart, von Karrieren und ihrem Scheitern, von einem lawinenartigen Bankrott und von einer noch lawinenartigeren Liebe, der Liebe zur anderweitig verheirateten Anna, die Eschenbach Jahre nach dem Ende ihrer stürmischen und fatalen Liebesgeschichte noch einmal auf der Insel besuchen wird, auch dies womöglich ein noch tieferer Abschied. Man ahnt die Anverwandlung von Goethes Wahlverwandtschaften, das Echo von Walther von der Vogelweides Liedern, von Shakespeares Sturm, angesiedelt auf Scharhörn, auf der ein Prospero der Gegenwart Besuch von allerlei Geistern der Vergangenheit erhält.
Der Traum vom Schreiben
In dem aktuellen Buch Alle meine Geister kehrt man mit Uwe Timm zurück zu seinen Anfängen, zu dem Zeitraum zwischen 1955 und 1960 in Hamburg, der Zeit von Timms Kürschnerlehre in Erich Levermanns Betrieb mit seinen sechzig Angestellten in der Hamburger Innenstadt. Auf zauberische Weise erzählt dieses Buch von Willkomm und Abschied zugleich, von Ende und Anfang. Denn es ist auf der einen Seite die Geschichte einer allmählichen Initiation – in das Handwerk, das Lesen und auch schon das Schreiben, in die Liebe und den Jazz, in gesellschaftliche Rollen und Verhältnisse, auch in den Umgang mit der NS-Zeit – und es ist ein Buch des Abschieds, zunächst und vor allem von einem Jahrhunderte alten Handwerk, ja einer Kunst, dem Handwerk des Kürschners, das inzwischen fast ausgestorben ist und durchaus auch etwas mit Timms Schreiben zu tun hat.
Wir erleben den jungen, oftmals verträumt wirkenden, zunächst eher schüchternen und doch auf rätselhafte Weise sehr entschlossenen Lehrling Timm bei seinem ganz eigenen, nicht durch den üblichen Schulkanon gesteuerten, erratischen Bildungsgang, vorangetrieben durch die Empfehlungen, mitunter die Begeisterung der anderen Lehrlinge, Gesellen und Meister, mitunter von Freunden und des Vaters. Und wir erfahren von der lebensverändernden Kraft des Lesens, als Initiationsroman ist dies eine zarte, berührende Coming-of-Age-Geschichte. Aber es ist auch ein Buch der Erinnerung, der Geister, ein Requiem nicht nur auf ein Handwerk. Wir erhalten ein dichtes Porträt der Nachkriegsgesellschaft, anhand des Kürschnerbetriebs, seines Personals, der Hierarchie, Regeln und des Arbeitsalltags, der im Handwerk eine geheimnisvolle Beziehung zum Erzählen besitzt, anhand der Stadt Hamburg und Ausflügen zur Ostsee, bis der Abschied von Hamburg mit dem Wechsel auf das Braunschweig-Kolleg dieser Zeit ein Ende setzt. Einer Zeit, die auch markiert ist vom plötzlichen Tod des Vaters. Der Eintritt in das elterliche Unternehmen nach dem überraschenden Tod des Vaters ist eine Feuerprobe, die Timm mit Bravour meistert, eine Zeit, in der er gutes Geld verdient, um doch am Ende seinem Traum zu folgen, dem Traum Schriftsteller werden zu wollen. Und wir erhalten erinnerte und wieder aufgefrischte Leseeindrücke von Timms Lektüren, von Lehrjahren der Gefühle, die erst im Lesen vor allem doch großer Werke – Romane, Erzählungen und Gedichte – Worte für sich finden und manchmal als Empfindungen überhaupt erst durch dieses Lesen kenntlich werden. Es ist der Zauber des Anfangs, der Erweckung, des Aufbruchs – auch in der Liebe – der dieses Buch der Erinnerung und des Abschieds auf eine kluge, kunstvolle und zarte Weise auch zu einem schönen Einstieg in das Werk Timms macht, für diejenigen, die es vielleicht erst jetzt entdecken.
Zum 85. Geburtstag von Uwe Timm
Seit über 50 Jahren ist Uwe Timm mit seinen Romanen, Essays und Kinderbüchern ein wichtiger Gestalter der deutschen Gegenwartsliteratur. Sein Werk nimmt stets Bezug auf unsere Zeitgeschichte und Gegenwart. Zu Timms 85. Geburtstag schreibt sein langjähriger Lektor und kommender Biograf Prof. Dr. Martin Hielscher für das Literaturportal Bayern einen kenntnisreichen, Orientierung gebenden Beitrag zu einem unserer wichtigsten Autoren.
*
Zu seinen frühesten Erinnerungen gehören zwei Bilder, riesige Fackeln links und rechts der Straße und in der Luft schwebende kleine Flämmchen, Bilder, die erst viele Jahre später im Erzählen, im familiären Erzählen und im nachforschenden Aufschreiben, das nicht glätten oder beschönigen will, ihre Erklärung finden. Es sind Erinnerungen an den Hamburger Feuersturm, die „Operation Gomorrha“ genannten Bombenangriffe britischer und amerikanischer Verbände auf die Stadt im Sommer 1943. Die Wohnung der Familie Timm wird am 25. Juli 1943 zerstört, der Vater und die Schwester können noch ein paar Gegenstände aus dem dritten Stock retten, bevor das Haus einstürzt, die Mutter wartet mit dem dreijährigen Sohn unten auf der Straße. Das Kind liegt, zugedeckt mit nassen Handtüchern, im Kinderwagen und wird, links und rechts die brennenden Bäume – das sind die Fackeln – durch die Osterstraße geschoben. Die Flämmchen in der Luft – es sind die aus den brennenden Häusern gerissenen Gardinenfetzen. Noch eine frühe Erinnerung: Der Dreijährige kommt aus dem Garten in die Küche, man deutet auf den Besenschrank, hinter dem ein blonder Schopf zu erkennen ist: Weißt du, wer das ist? Dann wird der kleine Uwe hochgehoben und jubelnd herumgeschwenkt – es ist die einzige eigene Erinnerung an den 16 Jahre älteren Bruder Karl-Heinz, der am 16.10.1943 in einem Lazarett in der Ukraine an seinen schweren Kriegsverletzungen stirbt.
Jahrzehnte später wird Uwe Timm in einem Buch über seine Familie und den Bruder diese frühen, einst unbegriffenen Erinnerungsbilder aufgreifen und zugleich der Frage nachgehen, warum der Bruder sich freiwillig zum Dienst in der Waffen-SS gemeldet hatte. Woher kommt der Vernichtungswille, der Militarismus und Empathieverlust der Deutschen und warum konnte Uwe Timm – wie Teile seiner Generation – eine ganz andere Haltung einnehmen? Schon früh, angeregt durch Kollegen und Vorgesetzte während seiner Lehrzeit als Kürschner in seiner Geburtsstadt Hamburg, wird Timm auf die Verwerfungen und Katastrophen der jüngsten Vergangenheit, den Krieg und den Nationalsozialismus und seine Ursachen, aufmerksam gemacht, aber auch auf die große Literatur. Seit einem Erweckungserlebnis in der Schule ein glühender Leser, beginnt er nun auch, Salinger und Dostojewski, Kafka und Benn für sich zu entdecken und erklärt, wofür ihn die Kürschnerkollegen verspotten, er wolle Schriftsteller werden.
Aufklärerisches Anliegen
Und so ist Uwe Timm seit seinem ersten Roman Heißer Sommer von 1974 in seinem inzwischen umfangreichen Werk einer über vielfältige und verschlungene Wege doch erkennbaren literarischen Spur gefolgt, die den Bedeutungs- und Erfahrungsraum der Kindheit zu einem gesellschaftlichen Raum erweitert – und damit zum Bewusstsein von Zeitgenossenschaft. Was einem in die Wiege gelegt ist, erweist sich als geschichtlich codiert. Der seit seinem Erscheinen immer lieferbar gebliebene Heißer Sommer ist nicht nur der kanonische Roman über die deutsche Studentenbewegung und die Entwicklung seiner Hauptfigur Ullrich Krause hin zu einem engagierten Bürger, übrigens von einer bemerkenswerten Frische, ja Aktualität. Und er ist nicht bloß ein Zeit- und Gesellschaftsroman, was man zu Recht über alle von Timms Romanen sagen kann, die eine Form episch-poetischer Geschichtsschreibung darstellen. Heißer Sommer ist auch eine Liebesgeschichte, ein Roman über das Geschichtenerzählen, das Begehren und den Widerstand. Es sind diese Elemente, die man auch im weiteren Werk Timms immer wieder antreffen kann.
Timm ist ein Autor des In-der-Welt-Seins, der das Erzählen, Ängste und Begehren, Wünsche und Schrecken, das Gefürchtete und das Utopische in der Erzählbarkeit und Lesbarkeit der Welt ansiedelt und dort auch findet, nicht in einer Art Weltinnenraum.
Der erzählerische Raum ist offen für das Magische, Märchenhafte, Mythische, aber, das ist das Aufklärerische, Politische an Timms Werken, es kommt nicht aus einem numinosen Irgendwo, es kommt aus dem Echoraum, aus der Knochenkammer, aus den Paradiesgärten der Geschichte und der literarischen Tradition, ja des geschriebenen Wortes überhaupt. Und das menschliche Wünschen und Begehren, der Wunsch nach Selbstfindung und Bezug, nach Würde sowie die Notwendigkeit des Widerstands drängen zur Sprache, zum Sprechen, zum Erzählen, zur Geschichte (im Sinne von Story) und Anekdote. Das kollektive, immer schon emotional aufgeladene, nicht selten humoristische Erzählen des Alltags, die auch subversive Produktivität des Mündlichen sind eine der Quellen von Timms Schreiben.
Er ist also ein Chronist der deutschen Geschichte und Mentalität, insbesondere im 20. Jahrhundert, ein Chronist der Bundesrepublik und ihrer Vorgeschichte, etwa im Nationalsozialismus, im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust, und ihres Nachwirkens und der neuen Realitäten der Bonner und Berliner Republik. Dabei hat Timm mit seinem zweiten Roman Morenga (1978) zudem ein in der deutschsprachigen Literatur seltenes Beispiel für einen postkolonialen Roman geschaffen. Dieser begibt sich zurück in die deutsche Kolonialgeschichte in „Deutsch-Südwest“ im Süden Afrikas und lässt zugleich in seiner hybriden Form als Mischung von Entwicklungs- und Dokumentarroman den Ort des Fremden und Anderen sozusagen leer und füllt ihn höchstens stellvertretend mit drei langen Exkursen, die streng genommen von Zugochsen erzählt werden. Ein Element, das ihm übrigens ein Freund und literarischer Weggefährte, der Schriftsteller und Psychiater Heinar Kipphardt, unbedingt hatte ausreden wollen.
Uwe Timm ist ein Autor der Städte, mehr als der Provinz, wenn auch durchaus einer der Landschaft und wenn es die der Wolken ist. Der urbane Raum etwa Hamburgs, Münchens, Berlins oder Roms ist wiederum einer der Vielfalt der Lebensformen und Begegnungen, der Zeichen, Sprachen, Spuren und auch Gräber und Ruinen.
Geheimnisvolles Beziehungsgeflecht
In Uwe Timms großem Werk, Romanen wie Der Mann auf dem Hochrad, Kopfjäger, der Berliner Trilogie Johannisnacht, Rot und Halbschatten, Romanen wie Vogelweide und Ikarien, Novellen wie der Entdeckung der Currywurst und Freitisch, Erzählungen, Essays wie Der Verrückte in den Dünen, Vorlesungen und Kinderbüchern wie dem besonders erfolgreichen Rennschwein Rudi Rüssel werden die Themen und Motive, die man schon in seinen Anfängen, zu denen auch Gedichte gehören, kennengelernt hat, auf immer neue Weise entfaltet und weitergetrieben. Eigen und gewissermaßen unvorhersehbar bilden die Werke ein geheimnisvolles Beziehungsgeflecht und antworten aufeinander.
Ein seit dem auf einen zweijährigen Aufenthalt zurückgehenden Rom-Buch von 1989 „Vogel, friss die Feige nicht“ (jetzt Römische Aufzeichnungen) sich immer stärker artikulierendes autobiografisches Moment tritt hinzu, das sich gerade auch in kürzeren Texten, Reden, Vorträgen und Essays zusätzlich niederschlägt, wie etwa in seinem Essay über Grimms Märchen „Der Lichtspalt unter der Zimmertür“. Besonders starke Beachtung fanden und finden die autobiografischen Werke Am Beispiel meines Bruders (auf das oben Bezug genommen wurde), Der Freund und der Fremde und jüngst der Band Alle meine Geister, der zeitlich die Lücke zwischen dem Bruder-Buch und dem Benno Ohnesorg-Band Der Freund und der Fremde schließt. Denn Timm holte nach dem erfolgreichen Abschluss der Kürschnerlehre und der Sanierung des elterlichen Pelzgeschäfts in Hamburg („Pelze Timm“) das Abitur auf dem Braunschweig-Kolleg nach, wo er den Dekorateur Benno Ohnesorg, der zarte Gedichte schrieb, kennenlernte. Auch Timms Engagement in der Studentenbewegung und einige Jahre in der DKP hatte, wie seine lebenslange Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Voraussetzungen, eine persönliche Vorgeschichte. Die Erschießung Benno Ohnesorgs am 2. Juni 1967 in Berlin am Rande der Anti-Schah-Demonstration war nicht nur das tragische Fanal für die deutsche Studentenbewegung. Es war für Uwe Timm der Verlust eines engen Freundes, mit dem er zum ersten Mal über sein Schreiben sprechen und sich über die eigenen Texte austauschen konnte.
Uwe Timms Werk, in annähernd 20 Sprachen übersetzt, ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt etwa mit dem Heinrich-Böll-Preis und der Carl-Zuckmayer-Medaille, dem Premio Napoli und dem Premio Mondello, dem Kulturellen Ehrenpreis der Landeshauptstadt München, dem Schillerpreis der Stadt Mannheim und dem Lessing-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg.
Belesener, vielseitig gebildeter Schriftsteller
Timm, am 30. März 1940 in Hamburg geboren, studierte nach seiner Lehre, der Entschuldung des väterlichen Pelzgeschäfts, das er infolge des plötzlichen Todes des Vaters 1958 übernahm, und dem nachgeholten Abitur Germanistik und Philosophie in München und Paris. Er wurde mit einer Arbeit über Albert Camus promoviert, lebt in München und ist oft in Berlin, wo die Timms eine Wohnung haben. Er ist seit 1969 mit der Autorin und Übersetzerin Dagmar Ploetz verheiratet und hat vier Kinder (weshalb es genau vier Kinderbücher von Timm gibt.) Er hat Drehbücher geschrieben, Literaturseminare geleitet, eine Gastprofessur in Argentinien übernommen, sein Werk ist in Deutschland Schullektüre und an vielen Universitäten im In- und Ausland Seminar- und Prüfungsstoff. Immer mehr wissenschaftliche Arbeiten werden darüber geschrieben, und Timm ist gelegentlich Gast von Politikern wie Horst Köhler und Frank-Walter Steinmeier auf Reisen nach Afrika und Lateinamerika gewesen.
Timm ist ein sehr belesener, vielseitig gebildeter Schriftsteller. Shakespeare, Goethe, Hölderlin, Thomas Mann, Ingeborg Bachmann, aber auch García Márquez und die Märchen der Brüder Grimm ebenso wie die Odyssee und die Bibel haben ihre Spuren in seinem Werk hinterlassen – und nicht zuletzt Walther von der Vogelweide, dessen Name auch den Titel eines Timm-Romans schmückt, in dem das Motiv der „Geister“, das dem aktuellen autobiografischen Buch nun ebenfalls den Titel verleiht, besonders zum Tragen kommt.
Vogelweide, 2013 erschienen, ist eine Liebesgeschichte, ein Gesellschafts- und Zeitroman, ein Roman über das Begehren, das Erzählen und den Abschied. Der Roman spielt in der Erzählgegenwart auf einer Vogelinsel in der Elbe vor Hamburg, die Timm aus seiner Kindheit kennt und auf der die Hauptfigur Eschenbach, nachdem ihm sein Leben auseinandergebrochen ist, für eine Zeitlang den Dienst eines Vogelwarts verrichtet. Es ist die Geschichte von Paaren in der Gegenwart, von Karrieren und ihrem Scheitern, von einem lawinenartigen Bankrott und von einer noch lawinenartigeren Liebe, der Liebe zur anderweitig verheirateten Anna, die Eschenbach Jahre nach dem Ende ihrer stürmischen und fatalen Liebesgeschichte noch einmal auf der Insel besuchen wird, auch dies womöglich ein noch tieferer Abschied. Man ahnt die Anverwandlung von Goethes Wahlverwandtschaften, das Echo von Walther von der Vogelweides Liedern, von Shakespeares Sturm, angesiedelt auf Scharhörn, auf der ein Prospero der Gegenwart Besuch von allerlei Geistern der Vergangenheit erhält.
Der Traum vom Schreiben
In dem aktuellen Buch Alle meine Geister kehrt man mit Uwe Timm zurück zu seinen Anfängen, zu dem Zeitraum zwischen 1955 und 1960 in Hamburg, der Zeit von Timms Kürschnerlehre in Erich Levermanns Betrieb mit seinen sechzig Angestellten in der Hamburger Innenstadt. Auf zauberische Weise erzählt dieses Buch von Willkomm und Abschied zugleich, von Ende und Anfang. Denn es ist auf der einen Seite die Geschichte einer allmählichen Initiation – in das Handwerk, das Lesen und auch schon das Schreiben, in die Liebe und den Jazz, in gesellschaftliche Rollen und Verhältnisse, auch in den Umgang mit der NS-Zeit – und es ist ein Buch des Abschieds, zunächst und vor allem von einem Jahrhunderte alten Handwerk, ja einer Kunst, dem Handwerk des Kürschners, das inzwischen fast ausgestorben ist und durchaus auch etwas mit Timms Schreiben zu tun hat.
Wir erleben den jungen, oftmals verträumt wirkenden, zunächst eher schüchternen und doch auf rätselhafte Weise sehr entschlossenen Lehrling Timm bei seinem ganz eigenen, nicht durch den üblichen Schulkanon gesteuerten, erratischen Bildungsgang, vorangetrieben durch die Empfehlungen, mitunter die Begeisterung der anderen Lehrlinge, Gesellen und Meister, mitunter von Freunden und des Vaters. Und wir erfahren von der lebensverändernden Kraft des Lesens, als Initiationsroman ist dies eine zarte, berührende Coming-of-Age-Geschichte. Aber es ist auch ein Buch der Erinnerung, der Geister, ein Requiem nicht nur auf ein Handwerk. Wir erhalten ein dichtes Porträt der Nachkriegsgesellschaft, anhand des Kürschnerbetriebs, seines Personals, der Hierarchie, Regeln und des Arbeitsalltags, der im Handwerk eine geheimnisvolle Beziehung zum Erzählen besitzt, anhand der Stadt Hamburg und Ausflügen zur Ostsee, bis der Abschied von Hamburg mit dem Wechsel auf das Braunschweig-Kolleg dieser Zeit ein Ende setzt. Einer Zeit, die auch markiert ist vom plötzlichen Tod des Vaters. Der Eintritt in das elterliche Unternehmen nach dem überraschenden Tod des Vaters ist eine Feuerprobe, die Timm mit Bravour meistert, eine Zeit, in der er gutes Geld verdient, um doch am Ende seinem Traum zu folgen, dem Traum Schriftsteller werden zu wollen. Und wir erhalten erinnerte und wieder aufgefrischte Leseeindrücke von Timms Lektüren, von Lehrjahren der Gefühle, die erst im Lesen vor allem doch großer Werke – Romane, Erzählungen und Gedichte – Worte für sich finden und manchmal als Empfindungen überhaupt erst durch dieses Lesen kenntlich werden. Es ist der Zauber des Anfangs, der Erweckung, des Aufbruchs – auch in der Liebe – der dieses Buch der Erinnerung und des Abschieds auf eine kluge, kunstvolle und zarte Weise auch zu einem schönen Einstieg in das Werk Timms macht, für diejenigen, die es vielleicht erst jetzt entdecken.