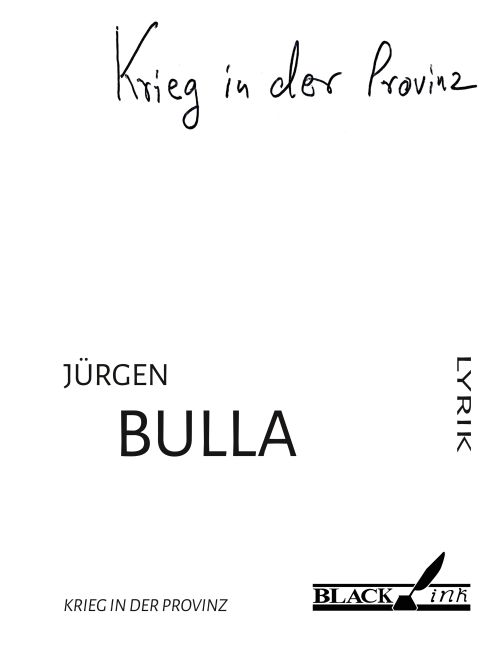Rezension zu Jürgen Bullas Lyrikband „Krieg in der Provinz“
Der Münchner Lyriker Jürgen Bulla ist in der zeitgenössischen Lyrikszene längst etabliert und hat eine deutlich erkennbare poetische Handschrift entwickelt. Florian Birnmeyer hat seinen jüngsten Lyrikband Krieg in der Provinz (Black Ink 2023) für das Literaturportal Bayern gelesen.
*
Man liest auf dem weißen Cover Krieg in der Provinz in schwarzen, geschwungenen, schmalen Lettern. Ein Reizwort, das die Assoziationen in Bewegung setzt. Weltpolitische Brüche, gesellschaftliche Risse, das große Chaos, das sich in den kleinsten Lebensräumen abbildet. Bulla zeichnet ein Bild davon, wie sich die Konflikte unserer Zeit bis in die hintersten Winkel der Provinz drängen. Dabei benutzt er häufig das Stilmittel des Enjambements, das in seinem Gedichtband omnipräsent ist und kombiniert positiv konnotierte Begriffe mit negativen, die zusammen ein spannungsreiches Tableau der Assoziationen ergeben.
So trägt bereits das dritte Gedicht den Titel Dorfbild oder once upon a time in America und weckt Erinnerungen an Sergio Leones epischen Gangsterfilm Es war einmal in Amerika (1984), in dem Robert De Niro und James Woods zwei jüdische Gangster in New York verkörpern. Doch bei Bulla ist es kein Gangster, der die Szenerie beherrscht, sondern ein „alternde[r] Filou mit immer schlechteren / Zähnen“, dessen abgenutzte Erscheinung ihn an die Filmfiguren Leones erinnert. Szenenhaft, verdichtet, mit dem feinen Gespür für atmosphärische Brüche entfaltet Bulla seine Miniaturen.
Eine durchdrungene, kontaminierte Welt
Es sind oft zunächst unscheinbare Impressionen, die sich auf den zweiten Blick als latente Unruheherde entpuppen. In Vor dem Gewitter heißt es: „Die Sprenger haben sich / nicht mehr im Griff, der Himmel mischt / giftige Farben.“ Die dörfliche Idylle – sie existiert nur noch in der Vorstellung. Was sich tatsächlich auftut, ist eine durchdrungene, kontaminierte Welt. Ein Ort, an dem das Virus keine Ausnahme macht, sondern sich in die Alltagssprache einschreibt.
Corona zieht sich wie ein leiser, aber drängender Schatten durch den Band. Eine Epoche, eingefroren in Momentaufnahmen, gefiltert durch poetische Schärfe. In Frühlingslockdown schreibt Bulla:
Oh, diese Zwanziger, anders als
vor hundert Jahren durchs wunde
Amüsement der Boulevards, der
2020er-Lockdown: auf sich allein
gestellt die eigenen Wackelbeine
bei ihrem unfreiwilligen Charleston
stolpern gegen die eigenen vier
Wände, Hausrat und Weisestenrat
bevorzugt Virologen [...]
Weitere Gedichte heißen Corona-Epiphanie und Vacination I: Realise I’m Going Home. Bulla spielt mit der Rhetorik der Pandemiejahre, mit den Sprachbildern, die sich tief ins kollektive Gedächtnis gebrannt haben. Die Maßnahmen, waren sie notwendig? Das Sicherheitsdispositiv, war es überzogen? Die Antwort bleibt in der Schwebe. Lyrik stellt keine Antworten bereit, sie eröffnet Räume für Fragen.
Doch natürlich ist der Gedichtband nicht monothematisch auf Corona fixiert. Vielmehr reißt er zahlreiche kleinere und größere Themen an, denen es allen gemein ist, dass sie gesellschaftlich relevant sind. Vor allem die Gedichte zu Beginn des Bandes bleiben in Erinnerung, so wie das erste Poem des Bandes, Vertagter Morgen, in dem Naturbilder mit spirituellen Begriffen collagiert werden und zusammen ein idyllisches Nachtbild ergeben:
Du trittst zurück,
und als hinge irgendetwas von dir ab,
stößt der Wind ins Fenster, das Bild
deiner Liebe tanzt im Raum, Silbenhauch
aus unerhörter Nähe. Dann reglose
Stille. Die Nacht vertagt den Atem
auf die Dämmerung
Zu diesem Moment der Idylle und des liebevoll-nächtlichen Einklangs sehnt man sich im Rest des Bandes zurück, wenn Naturbilder immer auch mit negativen Bildern verklammert und kombiniert werden, sodass sie ihre Unschuld verlieren. Eine Unschuld, die die Lyrik in der Moderne längst verloren hat. Und es ist gut so, denn wir leben in einer Zeit, in der es fatal wäre, den Leserinnen und Lesern vorzugaukeln, dass Lyrik eine heile Welt transportieren könnte, die es in der Realität nicht mehr gibt.
Die Risse in der Realität
Stattdessen schreibt Bulla von dieser Realität, sei es anhand eines Gewitter, wenn er sich über die „geheuchelte[...] / Niedlichkeit“ von Eichhörnchen beklagt und den Wind zur „Luftpost für die Eingeweihten“ erklärt oder anhand von XIV dreizeiligen dörflichen Gesellschaftsstudien, in denen Gerüchte, Gehörtes, Aufgeschnapptes sich mit Markennamen dörflichen Lebens und ländlich-häuslicher Betulichkeit vermengen. Doch so harmlos wie es scheint, ist das Gedicht Dorfbilder aus der großen Stadt gar nicht, wenn wir dort lesen:
XIV
alles verbrannte das
ihn an seine Eltern
denken ließ
XII
Oder eben Fasching
die Hausbälle passé
der Typ von der SS-
XIII
Leibstandarte [...]
Bulla selbst kommt aus der Stadt. In Als wir in den Bergen waren schreibt er: „Die Wälder meiner Kindheit / waren Wüsten aus Beton. Aber / an den Wochenenden / fuhren wir ins Blaue [...]“. Man könnte nun meinen, bei Bulla ginge es immer nur um die Schattenseiten des Lebens, und tatsächlich schleicht sich dies oft in seine Lyrik hinein. Doch da sind auch die Naturgedichte, die Gedichte über seinen Vater, die sehr sensibel das Alter und Altern beschreiben – das sensibelste Gedicht über das Altern, das ich je gelesen habe –, die Gedichte über den Urlaub und die Kinder. In Elegie auf den Vater heißt es:
Noch einmal hob sich deine Haut
unter der Berührung. Das Tasten
nach den Altersflecken, kaum zu
spüren die Erhebungen und doch
ein Glanzpunkt, den jede markiert.
Bulla schafft es, die Feinheiten gesellschaftlicher Erschütterungen mit sprachlicher Präzision sichtbar zu machen. Seine Lyrik spürt den Rissen in der Realität nach, den Unwuchten und Bruchstellen, die nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind. Und vielleicht ist es genau das, was gute Lyrik ausmacht: aufzudecken, ohne zu moralisieren.
Ein Band, der nachhallt.
![]() Krieg in der Provinz im Black Ink Verlag
Krieg in der Provinz im Black Ink Verlag
Rezension zu Jürgen Bullas Lyrikband „Krieg in der Provinz“
Der Münchner Lyriker Jürgen Bulla ist in der zeitgenössischen Lyrikszene längst etabliert und hat eine deutlich erkennbare poetische Handschrift entwickelt. Florian Birnmeyer hat seinen jüngsten Lyrikband Krieg in der Provinz (Black Ink 2023) für das Literaturportal Bayern gelesen.
*
Man liest auf dem weißen Cover Krieg in der Provinz in schwarzen, geschwungenen, schmalen Lettern. Ein Reizwort, das die Assoziationen in Bewegung setzt. Weltpolitische Brüche, gesellschaftliche Risse, das große Chaos, das sich in den kleinsten Lebensräumen abbildet. Bulla zeichnet ein Bild davon, wie sich die Konflikte unserer Zeit bis in die hintersten Winkel der Provinz drängen. Dabei benutzt er häufig das Stilmittel des Enjambements, das in seinem Gedichtband omnipräsent ist und kombiniert positiv konnotierte Begriffe mit negativen, die zusammen ein spannungsreiches Tableau der Assoziationen ergeben.
So trägt bereits das dritte Gedicht den Titel Dorfbild oder once upon a time in America und weckt Erinnerungen an Sergio Leones epischen Gangsterfilm Es war einmal in Amerika (1984), in dem Robert De Niro und James Woods zwei jüdische Gangster in New York verkörpern. Doch bei Bulla ist es kein Gangster, der die Szenerie beherrscht, sondern ein „alternde[r] Filou mit immer schlechteren / Zähnen“, dessen abgenutzte Erscheinung ihn an die Filmfiguren Leones erinnert. Szenenhaft, verdichtet, mit dem feinen Gespür für atmosphärische Brüche entfaltet Bulla seine Miniaturen.
Eine durchdrungene, kontaminierte Welt
Es sind oft zunächst unscheinbare Impressionen, die sich auf den zweiten Blick als latente Unruheherde entpuppen. In Vor dem Gewitter heißt es: „Die Sprenger haben sich / nicht mehr im Griff, der Himmel mischt / giftige Farben.“ Die dörfliche Idylle – sie existiert nur noch in der Vorstellung. Was sich tatsächlich auftut, ist eine durchdrungene, kontaminierte Welt. Ein Ort, an dem das Virus keine Ausnahme macht, sondern sich in die Alltagssprache einschreibt.
Corona zieht sich wie ein leiser, aber drängender Schatten durch den Band. Eine Epoche, eingefroren in Momentaufnahmen, gefiltert durch poetische Schärfe. In Frühlingslockdown schreibt Bulla:
Oh, diese Zwanziger, anders als
vor hundert Jahren durchs wunde
Amüsement der Boulevards, der
2020er-Lockdown: auf sich allein
gestellt die eigenen Wackelbeine
bei ihrem unfreiwilligen Charleston
stolpern gegen die eigenen vier
Wände, Hausrat und Weisestenrat
bevorzugt Virologen [...]
Weitere Gedichte heißen Corona-Epiphanie und Vacination I: Realise I’m Going Home. Bulla spielt mit der Rhetorik der Pandemiejahre, mit den Sprachbildern, die sich tief ins kollektive Gedächtnis gebrannt haben. Die Maßnahmen, waren sie notwendig? Das Sicherheitsdispositiv, war es überzogen? Die Antwort bleibt in der Schwebe. Lyrik stellt keine Antworten bereit, sie eröffnet Räume für Fragen.
Doch natürlich ist der Gedichtband nicht monothematisch auf Corona fixiert. Vielmehr reißt er zahlreiche kleinere und größere Themen an, denen es allen gemein ist, dass sie gesellschaftlich relevant sind. Vor allem die Gedichte zu Beginn des Bandes bleiben in Erinnerung, so wie das erste Poem des Bandes, Vertagter Morgen, in dem Naturbilder mit spirituellen Begriffen collagiert werden und zusammen ein idyllisches Nachtbild ergeben:
Du trittst zurück,
und als hinge irgendetwas von dir ab,
stößt der Wind ins Fenster, das Bild
deiner Liebe tanzt im Raum, Silbenhauch
aus unerhörter Nähe. Dann reglose
Stille. Die Nacht vertagt den Atem
auf die Dämmerung
Zu diesem Moment der Idylle und des liebevoll-nächtlichen Einklangs sehnt man sich im Rest des Bandes zurück, wenn Naturbilder immer auch mit negativen Bildern verklammert und kombiniert werden, sodass sie ihre Unschuld verlieren. Eine Unschuld, die die Lyrik in der Moderne längst verloren hat. Und es ist gut so, denn wir leben in einer Zeit, in der es fatal wäre, den Leserinnen und Lesern vorzugaukeln, dass Lyrik eine heile Welt transportieren könnte, die es in der Realität nicht mehr gibt.
Die Risse in der Realität
Stattdessen schreibt Bulla von dieser Realität, sei es anhand eines Gewitter, wenn er sich über die „geheuchelte[...] / Niedlichkeit“ von Eichhörnchen beklagt und den Wind zur „Luftpost für die Eingeweihten“ erklärt oder anhand von XIV dreizeiligen dörflichen Gesellschaftsstudien, in denen Gerüchte, Gehörtes, Aufgeschnapptes sich mit Markennamen dörflichen Lebens und ländlich-häuslicher Betulichkeit vermengen. Doch so harmlos wie es scheint, ist das Gedicht Dorfbilder aus der großen Stadt gar nicht, wenn wir dort lesen:
XIV
alles verbrannte das
ihn an seine Eltern
denken ließ
XII
Oder eben Fasching
die Hausbälle passé
der Typ von der SS-
XIII
Leibstandarte [...]
Bulla selbst kommt aus der Stadt. In Als wir in den Bergen waren schreibt er: „Die Wälder meiner Kindheit / waren Wüsten aus Beton. Aber / an den Wochenenden / fuhren wir ins Blaue [...]“. Man könnte nun meinen, bei Bulla ginge es immer nur um die Schattenseiten des Lebens, und tatsächlich schleicht sich dies oft in seine Lyrik hinein. Doch da sind auch die Naturgedichte, die Gedichte über seinen Vater, die sehr sensibel das Alter und Altern beschreiben – das sensibelste Gedicht über das Altern, das ich je gelesen habe –, die Gedichte über den Urlaub und die Kinder. In Elegie auf den Vater heißt es:
Noch einmal hob sich deine Haut
unter der Berührung. Das Tasten
nach den Altersflecken, kaum zu
spüren die Erhebungen und doch
ein Glanzpunkt, den jede markiert.
Bulla schafft es, die Feinheiten gesellschaftlicher Erschütterungen mit sprachlicher Präzision sichtbar zu machen. Seine Lyrik spürt den Rissen in der Realität nach, den Unwuchten und Bruchstellen, die nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind. Und vielleicht ist es genau das, was gute Lyrik ausmacht: aufzudecken, ohne zu moralisieren.
Ein Band, der nachhallt.