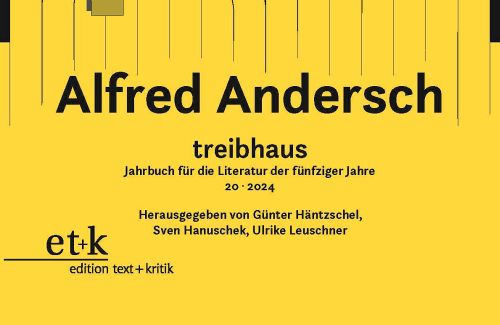Ein Sammelband über Alfred Andersch rührt an grundsätzlichen Fragen von Demokratie und Engagement
Seit 2005 bringt die edition text + kritik unter dem Titel treibhaus ein Jahrbuch für die Literatur der fünfziger Jahre heraus. Wie der Titel vermuten lässt, hatten die ersten beiden Bände Wolfgang Koeppen zum Schwerpunkt. Die meisten folgenden Jahrgänge widmeten sich mit Wolfgang Hildesheimer und Wolfdietrich Schnurre nur zweimal einzelnen Autoren; meist waren die Bände thematisch ausgerichtet. Der wiederum einer Einzelpersönlichkeit gewidmete Jahrgang 2024 rückt Alfred Andersch in den Fokus. Gerald Fiebig stellt die Eindrücke seiner Lektüre – anlässlich zu Andersch' 111. Geburtstag am 04. Februar – vor.
*
In mehreren Beiträgen des Bandes ist erkennbar, dass in der Andersch-Forschung immer noch die Debatte nachwirkt, die W.G. Sebald vor rund 30 Jahren mit seinem Essay über Andersch entfacht hatte. Sebalds Aufsatz übte scharfe moralische Kritik daran, dass Andersch sich während der NS-Zeit von seiner nach den Kategorien der Nürnberger Gesetze 'halbjüdischen' ersten Ehefrau Angelika scheiden ließ und ihr so den (gleichwohl prekären) Schutz durch einen 'arischen' Ehepartner entzog. Dass Angelika (und die Tochter Susanne) den Nationalsozialismus dennoch überlebten und Andersch mit ihnen auch nach 1945 in Kontakt stand, ist einer der biografischen Aspekte, die sich aus dem umfangreichsten Teil des Bandes erhellen: den Briefen Anderschs aus den Jahren 1945 bis 1949 an seine Geliebte und spätere zweite Ehefrau Gisela Groneuer, die hier erstmals veröffentlicht werden.
Ein Ruhmesblatt wird trotzdem nicht daraus, das ist nicht nur Sebald aufgefallen. In ihrem biografisch kontextualisierenden Essay zu ihrer (mit sehr informativen Anmerkungen zu Personen und Bezügen versehenen) Edition der Briefe schreibt Ulrike Leuschner: „Ruth Klüger leitet aus diesem moralischen Versagen eine 'Wiedergutmachungsphantasie' ab, die Andersch zum jüdischen Personal seines erzählerischen Werks, insbesondere zur Titelfigur seines Romans Efraim (1967) veranlasst habe.“ (Dass Andersch bei der Zeichnung dieser Figuren auch antisemitisch codierte Klischees unterlaufen, ist für Sebald der Punkt, wo sich die moralischen Defizite der Person Andersch mit den künstlerischen Defiziten des Autors Andersch überschneiden.)
Eine Art Gründungsakt
Ebenfalls erstmals veröffentlicht findet sich Anderschs letzter Feldpostbrief an Gisela Groneuer aus Italien, bevor er aus der Wehrmacht in amerikanische Kriegsgefangenschaft desertiert. Die Desertion ist in doppelter Hinsicht eine Art Gründungsakt der öffentlichen Figur Alfred Andersch: Anderschs anschließende Re-education im amerikanischen Camp Getty qualifiziert ihn zum einen als Zeitungsjournalist (u.a. als Assistent von Erich Kästner bei der Neuen Zeitung in München) und später Radioredakteur im besetzten Nachkriegsdeutschland. Zum anderen wird die Desertion Thema seines autofiktionalen „Berichts“ Die Kirschen der Freiheit, mit dem er sich 1952 als literarischer Autor etabliert und seine deutschen Zeitgenossen durchaus provoziert. Dass Anderschs „Davonlaufen. Eine Form des Widerstands“ war – entgegen der skeptischen Bewertung bei Sebald – , attestiert ihm Carlo Greppi bereits im Titel seines Aufsatzes. Interessant ist Greppis Beitrag aber vor allem wegen der historischen Kontextualisierung, die er bietet. Gestützt auf Forschungen zur italienischen Resistenza, zeigt Greppi u.a. auf, dass es auch deutsche Deserteure gab, die sich dem bewaffneten Widerstand in Italien anschlossen. „Die deutschen Partisanen [...]“, so Greppi, „waren zweifellos eine Minderheit, möglicherweise auch eine kleine Minderheit verglichen mit den Millionen, die in den Streitkräften mobilisiert wurden. Aber in welchem Land war die Widerstandsbewegung das nicht?“
Die Kirschen der Freiheit ist von Anderschs literarischen Texten wohl derjenige, der in den Beiträgen des treibhauses am häufigsten erwähnt wird. Eine kenntnisreiche Einzelanalyse widmet Sven Hanuschek hingegen der Erzählung Diana mit Flötenspieler von 1954, die als eine der „gelungensten“ von Alfred Andersch bezeichnet wurde. Die auf einem historischen Vorbild basierende Gräfin Diane auf ihrer Hallig, die – in räumlicher ebenso wie geistiger Distanz zum Geschehen auf dem nazistischen Festland – im Krieg einen abgestürzten britischen Kampfpiloten beherbergt, „hat nicht weniger als eine Wunschbiografie in schwierigen Zeiten gelebt, geeignet für ein Sich-weg-Träumen. Dass eine weibliche Biografie in den frühen fünfziger Jahren als eine solche Projektionsfläche fungieren kann, ist ungewöhnlich genug“, so Hanuschek.
Die schweigende Mitwisserschaft einer ganzen Gesellschaft
Auch vor diesem Hintergrund männlicher Dominanz begeistert und verblüfft Axel Dunkers Aufsatz „Alfred Anderschs Sansibar oder der letzte Grund und der 'Euthanasie'-Diskurs der 1950er Jahre“ vor allem mit dem Hinweis auf eine heute leider so gut wie völlig vergessene Autorin: Maria Mathi. Ihr Roman Wenn nur der Sperber nicht kommt erschien 1955, „nachdem etwa 50 Verlage das Buch abgelehnt hatten“. Die Autorin aus dem hessischen Hadamar legt in dem Buch Zeugnis davon ab, dass in ihrem Wohnort alle von den Krankenmorden in der dortigen Tötungsanstalt samt Krematorium Bescheid wissen konnten. „Die ersten, die man dort vergaste und verbrannte, waren die jüdischen Insassen der Krankenanstalten. Mathi zeigt hier sehr genau den Zusammenhang zwischen den Euthanasie-Morden und der Shoah, die Aktion T 4 war Bestandteil des Holocaust“, so Dunker. Die zitierten Stellen aus Wenn nur der Sperber nicht kommt erschüttern und beeindrucken durch die drastische Konkretheit, mit der sie das grauenvolle Geschehen schildern, und den abgründigen Sarkasmus, mit der sie die schweigende Mitwisserschaft einer ganzen Gesellschaft benennen:
„Dass Maria Mathis Roman vergessen ist, dass ihr Name in fast keinem Literaturlexikon mehr auftaucht, ist Ausdruck davon, dass man auch in den 1950er Jahren noch nicht wirklich wissen wollte“, stellt Dunker fest.
Dieser zweifellos zutreffende Befund erinnert an den Fall von Christian Geisslers Romandebüt Anfrage, das bei seinem Erscheinen 1960 zwar für Furore sorgte, dessen Fragen nach der Verstrickung einer ganzen Gesellschaft in den Genozid an den Jüdinnen und Juden aber zu unbequem für die postfaschistische Bundesrepublik waren, als dass das Buch einen Platz im Kanon der Nachkriegsliteratur gefunden hätte, der etwa dem von Anderschs Werken vergleichbar wäre. Nebenbei drängt sich die Frage auf, wann sich erstmals ein monografischer treibhaus-Band einer Autorin der fünfziger Jahre widmen wird.
Die Stunde Null zwischen Tatsache und Fiktion
Die weiteren Beiträge des Bandes umkreisen in unterschiedlicher Perspektive ein Phänomen, das Clemens Fuhrbach in seinem Aufsatz „Der schwermütige Luxus des Nachdenkens in der Literatur. Resonanzen der 'Stunde Null' bei Alfred Andersch und Heinrich Böll“ wie folgt beschreibt: „Die 'Stunde Null' bleibt für die Menschen im Deutschland der Nachkriegszeit gleichermaßen eine historische Tatsache und eine gelebte Fiktion. In der Realität wurde schnell klar, dass weder in der Sprache noch in der Politik ein Neuanfang erreicht werden konnte.“
Die „gelebte Fiktion“, also die Behauptung (im Fall Anderschs immerhin durch den Akt der Desertion gedeckt, im Fall der allermeisten Deutschen eben nur Behauptung), man habe sich durch einen Willensakt von der Verantwortung für den Nationalsozialismus ab-, jedoch der Demokratie zugewandt, formuliert Andersch 1946 in der von ihm mit Hans Werner Richter noch im Kriegsgefangenenlager (und später dann in München) herausgegebenen Zeitschrift Der Ruf ganz im Sinne der bis mindestens Mitte der 1990er in Deutschland vorherrschenden Selbstentlastungs-Ideologie: „Andersch unterscheidet die Verantwortlichkeit der Taten der Wehrmacht von den Verbrechen der Terrororganisationen des NS-Staates: 'Die Kämpfer von Stalingrad […] sind unschuldig an den Verbrechen von Dachau und Buchenwald.' Seine Aussagen sind nicht ohne Kritik geblieben. Die Studie von Urs Widmer hat aufgezeigt, dass die Sprache in der Nachkriegszeit von einem echten 'Kahlschlag' weit entfernt war. Eine erneuerte Form der 'Schizophrenie' hat Hans-Dieter Schäfer in Das gespaltene Bewußtsein beschrieben und die Frage aufgeworfen, ob die 'Stunde Null' nicht eigentlich eine 'Erfindung' sei, die sich aus alten Denkstrukturen ableitet.“ Die Gruppe 47, der Andersch von Anfang an nahe steht, verkörpert diesen Anspruch auf einen quasi geschichtslosen Neubeginn ex nihilo und „hielt stets peinlich Abstand zu den Vertretern sowohl der inneren als auch der äußeren Emigration“ (Franz Schwarzbauer), wohl um Fragen nach Mitverantwortung für das NS-Regime erst gar nicht aufkommen zu lassen. Franz Schwarzbauers Aufsatz über Alfred Anderschs Verhältnis zu Ernst Jünger zeigt die Unhaltbarkeit dieser Konstruktion am konkreten biografischen Fall: Jünger, den Andersch durchaus als Vertreter einer 'widerständigen' inneren Emigration sehen wollte, war für ihn Zeit seines Lebens ein wichtiger literarischer Referenzpunkt. Andersch war 19 Jahre alt, als der Nationalsozialismus an die Macht kam – viele Rollenvorbilder von der stilistischen Qualität Jüngers waren dann in Deutschland für einen Leser mit eigenen literarischen Ambitionen nicht mehr zu haben. In dem Beharren darauf, in Jünger einen Vertreter eines ästhetischen 'Widerstands' zu sehen statt einen Wegbereiter und mindestens Mitläufer des Nationalsozialismus, scheint Andersch aber immer auch sein eigenes Verhalten unter der Diktatur mitzuverhandeln.
Ein wichtiger Beitrag zur Demokratisierung
Anderschs Kontakte mit Carl Schmitt, der ihm – so heißt es in einer zitierten Quelle – als „brillantester Kopf der faschistischen Intellektuellen“ galt, sind Thema des Aufsatzes „Positionsbestimmungen – Alfred Andersch, Carl Schmitt und Walter Warnach“. „Ausgangspunkt für das kommunikative Beziehungsdreieck ist das Gespräch über Geschichtsphilosophie, das Walter Warnach auf Anregung von Alfred Andersch mit Carl Schmitt führte und das am 19. Juni 1951 im Mitternachtsstudio des Hessischen Rundfunks gesendet wurde.“
Anderschs Arbeit als Radioredakteur ist auch Thema der Studie „Der Getty Spirit im Äther – Alfred Anderschs Engagement für einen demokratischen Rundfunk“ von Norman Ächtler. Dass Andersch auch einem kompromittierten Autor wie Schmitt eine radiophone Bühne bot – aber beispielsweise auch Theodor W. Adorno oder einer zweiten, kaum bekannten Inszenierung des genreprägenden Hörspiels Träume von Günter Eich – , wird plausibel aus dem von Ächtler rekonstruierten Konzept, das Andersch für den Rundfunk als Einübung in demokratische Haltungen wie Pluralismus und das Aushalten von Differenzen hatte: „Ganz konkret in seiner Redaktionspraxis niederschlagen sollte sich der 'Geist der Unvoreingenommenheit' und des freien Meinungsaustausches, den er in Camp Getty aufgesogen hatte: 'Ein Höchstmaß an Verständigung in einem Höchstmaß von Gesprächsmöglichkeiten zu erreichen', beschreibt er das pädagogische Grundprinzip des 'Getty Spirits'.“
Anderschs Ethos ist damit paradigmatisch für das Konzept der Westalliierten, einen staatsfernen, nicht zentralisierten Rundfunk in Deutschland zu etablieren, um eine erneute Instrumentalisierung des Massenmediums durch eine autoritäre Regierung zu verhindern. Diese „Programmatik einer demokratischen Medienöffentlichkeit, die einen größtmöglichen Pluralismus mit dem Auftrag der Bildung eines in fortschrittlichem Sinne kritischen Bewusstseins zu verbinden suchte“, hat in der Tat einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung der Bundesrepublik geleistet. Genau darin dürfte der Grund zu sehen sein, dass demokratiefeindliche Parteien heute die Schwächung bzw. Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Programm ausrufen.
Bezeichnenderweise war die Staatsferne des Rundfunks bereits der Adenauer-Regierung hochgradig unbequem, wie Ächtler am Beispiel des NWDR aufzeigt, für den auch Andersch tätig war: „Wie man inzwischen weiß, schreckte die Bundesregierung nicht einmal vor der illegalen geheimdienstlichen Infiltration des Senders zurück, um 'einen Rundfunksender in Misskredit zu bringen, der das Demokratisierungsgebot der britischen Deutschlandpolitik ernst nahm.' Die Anstalt wurde 1955 zugunsten von WDR und NDR liquidiert, der politisch nicht konforme Intendant Ernst Schnabel zum Rücktritt genötigt.“
Mit Adenauers Plänen zur Errichtung eines Staatsfernsehens Ende der 1950er sah Andersch die Demokratie in Westdeutschland dann vollends so gefährdet, dass ihm eine Emigration ins Ausland als Gebot der Stunde erschien: 1958 zog er in die Schweiz um, wo er bis an sein Lebensende blieb. Bereits früher artikulierte sich diese Sorge in Anderschs Briefwechsel (1953 bis 1962) mit dem bereits seit 1953 in Italien lebenden Komponisten Hans Werner Henze, den Lorenzo Bonosi in seinem Beitrag analysiert: „In Henze findet Andersch somit einen weiteren Gesprächspartner für das eigene Unbehagen, das er zu Beginn der 1950er Jahre verspürte und 1958 zu seinem Entschluss führen sollte, Deutschland zu verlassen.“
Ein Anlass für diese Sorge waren u.a. die heftigen Reaktionen von konservativ-katholischer Seite – inklusive Strafanzeigen – auf die Publikation von Arno Schmidts Seelandschaft mit Pocahontas in der ersten Ausgabe der von Andersch herausgegebenen Zeitschrift Texte und Zeichen, der Diego León-Villagrá einen Beitrag widmet. „Es ist unglaublich, wie sich der faschistische Flügel des Katholizismus daran entlarvt hat!“ schreibt Andersch an Schmidt, welcher wiederum alle seine Texte an seine in New York lebende Schwester schickt, weil er eine neuerliche Bücherverbrennung fürchtet: „I have lived to see books burned in my time; the Nazis did so by millions […]. As I am afraid, I am just the type, new Nazis would be glad of to burn the books, I should be greatly satisfied, to know the whole stuff in safety.“
Das Machtvakuum überließe die Deutungshoheit nur noch einmal den falschen Personen
Als Fazit ist festzuhalten: Der treibhaus-Band über Alfred Andersch bietet in seinen Dokumenten und Analysen ein facettenreiches, anschauliches Bild der Literaturlandschaft der Nachkriegsjahre und nicht zuletzt faszinierende Einblicke in das heute nahezu untergegangene Genre der Briefprosa – speziell die geistreichen, polemischen Briefzitate von Hans Werner Henze sind ein echtes intellektuelles Vergnügen.
Deutlich erkennbar wird Anderschs enorm einflussreiche Rolle als „eine[r] der wichtigsten Netzwerker der Literatur- und Medienszene der 1940er und 1950er Jahre“ (Norman Ächtler), deren Bedeutung für die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur und der bundesdeutschen Gesellschaft möglicherweise höher anzusetzen ist als die von Anderschs eigenen literarischen Werken.
Und etliche der Fragen, die Anderschs Biografie und Werk gerade in ihren unauflöslich ambivalenten Aspekten aufwerfen, haben angesichts der aktuellen politischen Situation in Deutschland leider eine Aktualität gewonnen, die weit über philologische Fragestellungen hinausgeht: Wie verhält man sich angesichts der drohenden Abschaffung der Demokratie? Emigrieren oder Widerstand leisten? Und wie kann dieser Widerstand aussehen?
Andersch, so Angelika Reinthal, habe nach seiner Entlassung aus der KZ-Haft 1933 versucht, aus der Geschichte zu emigrieren, aber, so zitiert sie Ursula Reinhold, „[d]iesen konsequenten Rückzug aus der Geschichte nahm Andersch aus späterer Sicht mit tiefer Bestürzung wahr.“ Da die 'Stunde Null', das Zurücksetzen auf einen Zustand vor dem eigenen moralischen Versagen, niemals wirklich möglich ist, sondern man immer vorwärts leben muss, bleibt die Erkenntnis, „dass man die Zukunft nicht durch ein neues Schweigen in der Literatur gestalten kann“, so Clemens Fuhrbach. Es lässt sich ergänzen: nicht nur in der Literatur, sondern in jedem Lebensbereich. Denn, so Fuhrbach weiter: „Das Machtvakuum, das damit entstünde, überließe die Deutungshoheit über die Kultur und über die Gesellschaft nur noch einmal den falschen Personen“, also denen, die heute – erneut! – die Demokratie zugunsten einer 'Volksgemeinschaft' abzuschaffen trachten.
Günter Häntzschel / Sven Hanuschek / Ulrike Leuschner: treibhaus. Jahrbuch für die Literatur der fünfziger Jahre. Band 20: Alfred Andersch. edition text + kritik, München 2024, 398 Seiten, 39 Euro.
Ein Sammelband über Alfred Andersch rührt an grundsätzlichen Fragen von Demokratie und Engagement
Seit 2005 bringt die edition text + kritik unter dem Titel treibhaus ein Jahrbuch für die Literatur der fünfziger Jahre heraus. Wie der Titel vermuten lässt, hatten die ersten beiden Bände Wolfgang Koeppen zum Schwerpunkt. Die meisten folgenden Jahrgänge widmeten sich mit Wolfgang Hildesheimer und Wolfdietrich Schnurre nur zweimal einzelnen Autoren; meist waren die Bände thematisch ausgerichtet. Der wiederum einer Einzelpersönlichkeit gewidmete Jahrgang 2024 rückt Alfred Andersch in den Fokus. Gerald Fiebig stellt die Eindrücke seiner Lektüre – anlässlich zu Andersch' 111. Geburtstag am 04. Februar – vor.
*
In mehreren Beiträgen des Bandes ist erkennbar, dass in der Andersch-Forschung immer noch die Debatte nachwirkt, die W.G. Sebald vor rund 30 Jahren mit seinem Essay über Andersch entfacht hatte. Sebalds Aufsatz übte scharfe moralische Kritik daran, dass Andersch sich während der NS-Zeit von seiner nach den Kategorien der Nürnberger Gesetze 'halbjüdischen' ersten Ehefrau Angelika scheiden ließ und ihr so den (gleichwohl prekären) Schutz durch einen 'arischen' Ehepartner entzog. Dass Angelika (und die Tochter Susanne) den Nationalsozialismus dennoch überlebten und Andersch mit ihnen auch nach 1945 in Kontakt stand, ist einer der biografischen Aspekte, die sich aus dem umfangreichsten Teil des Bandes erhellen: den Briefen Anderschs aus den Jahren 1945 bis 1949 an seine Geliebte und spätere zweite Ehefrau Gisela Groneuer, die hier erstmals veröffentlicht werden.
Ein Ruhmesblatt wird trotzdem nicht daraus, das ist nicht nur Sebald aufgefallen. In ihrem biografisch kontextualisierenden Essay zu ihrer (mit sehr informativen Anmerkungen zu Personen und Bezügen versehenen) Edition der Briefe schreibt Ulrike Leuschner: „Ruth Klüger leitet aus diesem moralischen Versagen eine 'Wiedergutmachungsphantasie' ab, die Andersch zum jüdischen Personal seines erzählerischen Werks, insbesondere zur Titelfigur seines Romans Efraim (1967) veranlasst habe.“ (Dass Andersch bei der Zeichnung dieser Figuren auch antisemitisch codierte Klischees unterlaufen, ist für Sebald der Punkt, wo sich die moralischen Defizite der Person Andersch mit den künstlerischen Defiziten des Autors Andersch überschneiden.)
Eine Art Gründungsakt
Ebenfalls erstmals veröffentlicht findet sich Anderschs letzter Feldpostbrief an Gisela Groneuer aus Italien, bevor er aus der Wehrmacht in amerikanische Kriegsgefangenschaft desertiert. Die Desertion ist in doppelter Hinsicht eine Art Gründungsakt der öffentlichen Figur Alfred Andersch: Anderschs anschließende Re-education im amerikanischen Camp Getty qualifiziert ihn zum einen als Zeitungsjournalist (u.a. als Assistent von Erich Kästner bei der Neuen Zeitung in München) und später Radioredakteur im besetzten Nachkriegsdeutschland. Zum anderen wird die Desertion Thema seines autofiktionalen „Berichts“ Die Kirschen der Freiheit, mit dem er sich 1952 als literarischer Autor etabliert und seine deutschen Zeitgenossen durchaus provoziert. Dass Anderschs „Davonlaufen. Eine Form des Widerstands“ war – entgegen der skeptischen Bewertung bei Sebald – , attestiert ihm Carlo Greppi bereits im Titel seines Aufsatzes. Interessant ist Greppis Beitrag aber vor allem wegen der historischen Kontextualisierung, die er bietet. Gestützt auf Forschungen zur italienischen Resistenza, zeigt Greppi u.a. auf, dass es auch deutsche Deserteure gab, die sich dem bewaffneten Widerstand in Italien anschlossen. „Die deutschen Partisanen [...]“, so Greppi, „waren zweifellos eine Minderheit, möglicherweise auch eine kleine Minderheit verglichen mit den Millionen, die in den Streitkräften mobilisiert wurden. Aber in welchem Land war die Widerstandsbewegung das nicht?“
Die Kirschen der Freiheit ist von Anderschs literarischen Texten wohl derjenige, der in den Beiträgen des treibhauses am häufigsten erwähnt wird. Eine kenntnisreiche Einzelanalyse widmet Sven Hanuschek hingegen der Erzählung Diana mit Flötenspieler von 1954, die als eine der „gelungensten“ von Alfred Andersch bezeichnet wurde. Die auf einem historischen Vorbild basierende Gräfin Diane auf ihrer Hallig, die – in räumlicher ebenso wie geistiger Distanz zum Geschehen auf dem nazistischen Festland – im Krieg einen abgestürzten britischen Kampfpiloten beherbergt, „hat nicht weniger als eine Wunschbiografie in schwierigen Zeiten gelebt, geeignet für ein Sich-weg-Träumen. Dass eine weibliche Biografie in den frühen fünfziger Jahren als eine solche Projektionsfläche fungieren kann, ist ungewöhnlich genug“, so Hanuschek.
Die schweigende Mitwisserschaft einer ganzen Gesellschaft
Auch vor diesem Hintergrund männlicher Dominanz begeistert und verblüfft Axel Dunkers Aufsatz „Alfred Anderschs Sansibar oder der letzte Grund und der 'Euthanasie'-Diskurs der 1950er Jahre“ vor allem mit dem Hinweis auf eine heute leider so gut wie völlig vergessene Autorin: Maria Mathi. Ihr Roman Wenn nur der Sperber nicht kommt erschien 1955, „nachdem etwa 50 Verlage das Buch abgelehnt hatten“. Die Autorin aus dem hessischen Hadamar legt in dem Buch Zeugnis davon ab, dass in ihrem Wohnort alle von den Krankenmorden in der dortigen Tötungsanstalt samt Krematorium Bescheid wissen konnten. „Die ersten, die man dort vergaste und verbrannte, waren die jüdischen Insassen der Krankenanstalten. Mathi zeigt hier sehr genau den Zusammenhang zwischen den Euthanasie-Morden und der Shoah, die Aktion T 4 war Bestandteil des Holocaust“, so Dunker. Die zitierten Stellen aus Wenn nur der Sperber nicht kommt erschüttern und beeindrucken durch die drastische Konkretheit, mit der sie das grauenvolle Geschehen schildern, und den abgründigen Sarkasmus, mit der sie die schweigende Mitwisserschaft einer ganzen Gesellschaft benennen:
„Dass Maria Mathis Roman vergessen ist, dass ihr Name in fast keinem Literaturlexikon mehr auftaucht, ist Ausdruck davon, dass man auch in den 1950er Jahren noch nicht wirklich wissen wollte“, stellt Dunker fest.
Dieser zweifellos zutreffende Befund erinnert an den Fall von Christian Geisslers Romandebüt Anfrage, das bei seinem Erscheinen 1960 zwar für Furore sorgte, dessen Fragen nach der Verstrickung einer ganzen Gesellschaft in den Genozid an den Jüdinnen und Juden aber zu unbequem für die postfaschistische Bundesrepublik waren, als dass das Buch einen Platz im Kanon der Nachkriegsliteratur gefunden hätte, der etwa dem von Anderschs Werken vergleichbar wäre. Nebenbei drängt sich die Frage auf, wann sich erstmals ein monografischer treibhaus-Band einer Autorin der fünfziger Jahre widmen wird.
Die Stunde Null zwischen Tatsache und Fiktion
Die weiteren Beiträge des Bandes umkreisen in unterschiedlicher Perspektive ein Phänomen, das Clemens Fuhrbach in seinem Aufsatz „Der schwermütige Luxus des Nachdenkens in der Literatur. Resonanzen der 'Stunde Null' bei Alfred Andersch und Heinrich Böll“ wie folgt beschreibt: „Die 'Stunde Null' bleibt für die Menschen im Deutschland der Nachkriegszeit gleichermaßen eine historische Tatsache und eine gelebte Fiktion. In der Realität wurde schnell klar, dass weder in der Sprache noch in der Politik ein Neuanfang erreicht werden konnte.“
Die „gelebte Fiktion“, also die Behauptung (im Fall Anderschs immerhin durch den Akt der Desertion gedeckt, im Fall der allermeisten Deutschen eben nur Behauptung), man habe sich durch einen Willensakt von der Verantwortung für den Nationalsozialismus ab-, jedoch der Demokratie zugewandt, formuliert Andersch 1946 in der von ihm mit Hans Werner Richter noch im Kriegsgefangenenlager (und später dann in München) herausgegebenen Zeitschrift Der Ruf ganz im Sinne der bis mindestens Mitte der 1990er in Deutschland vorherrschenden Selbstentlastungs-Ideologie: „Andersch unterscheidet die Verantwortlichkeit der Taten der Wehrmacht von den Verbrechen der Terrororganisationen des NS-Staates: 'Die Kämpfer von Stalingrad […] sind unschuldig an den Verbrechen von Dachau und Buchenwald.' Seine Aussagen sind nicht ohne Kritik geblieben. Die Studie von Urs Widmer hat aufgezeigt, dass die Sprache in der Nachkriegszeit von einem echten 'Kahlschlag' weit entfernt war. Eine erneuerte Form der 'Schizophrenie' hat Hans-Dieter Schäfer in Das gespaltene Bewußtsein beschrieben und die Frage aufgeworfen, ob die 'Stunde Null' nicht eigentlich eine 'Erfindung' sei, die sich aus alten Denkstrukturen ableitet.“ Die Gruppe 47, der Andersch von Anfang an nahe steht, verkörpert diesen Anspruch auf einen quasi geschichtslosen Neubeginn ex nihilo und „hielt stets peinlich Abstand zu den Vertretern sowohl der inneren als auch der äußeren Emigration“ (Franz Schwarzbauer), wohl um Fragen nach Mitverantwortung für das NS-Regime erst gar nicht aufkommen zu lassen. Franz Schwarzbauers Aufsatz über Alfred Anderschs Verhältnis zu Ernst Jünger zeigt die Unhaltbarkeit dieser Konstruktion am konkreten biografischen Fall: Jünger, den Andersch durchaus als Vertreter einer 'widerständigen' inneren Emigration sehen wollte, war für ihn Zeit seines Lebens ein wichtiger literarischer Referenzpunkt. Andersch war 19 Jahre alt, als der Nationalsozialismus an die Macht kam – viele Rollenvorbilder von der stilistischen Qualität Jüngers waren dann in Deutschland für einen Leser mit eigenen literarischen Ambitionen nicht mehr zu haben. In dem Beharren darauf, in Jünger einen Vertreter eines ästhetischen 'Widerstands' zu sehen statt einen Wegbereiter und mindestens Mitläufer des Nationalsozialismus, scheint Andersch aber immer auch sein eigenes Verhalten unter der Diktatur mitzuverhandeln.
Ein wichtiger Beitrag zur Demokratisierung
Anderschs Kontakte mit Carl Schmitt, der ihm – so heißt es in einer zitierten Quelle – als „brillantester Kopf der faschistischen Intellektuellen“ galt, sind Thema des Aufsatzes „Positionsbestimmungen – Alfred Andersch, Carl Schmitt und Walter Warnach“. „Ausgangspunkt für das kommunikative Beziehungsdreieck ist das Gespräch über Geschichtsphilosophie, das Walter Warnach auf Anregung von Alfred Andersch mit Carl Schmitt führte und das am 19. Juni 1951 im Mitternachtsstudio des Hessischen Rundfunks gesendet wurde.“
Anderschs Arbeit als Radioredakteur ist auch Thema der Studie „Der Getty Spirit im Äther – Alfred Anderschs Engagement für einen demokratischen Rundfunk“ von Norman Ächtler. Dass Andersch auch einem kompromittierten Autor wie Schmitt eine radiophone Bühne bot – aber beispielsweise auch Theodor W. Adorno oder einer zweiten, kaum bekannten Inszenierung des genreprägenden Hörspiels Träume von Günter Eich – , wird plausibel aus dem von Ächtler rekonstruierten Konzept, das Andersch für den Rundfunk als Einübung in demokratische Haltungen wie Pluralismus und das Aushalten von Differenzen hatte: „Ganz konkret in seiner Redaktionspraxis niederschlagen sollte sich der 'Geist der Unvoreingenommenheit' und des freien Meinungsaustausches, den er in Camp Getty aufgesogen hatte: 'Ein Höchstmaß an Verständigung in einem Höchstmaß von Gesprächsmöglichkeiten zu erreichen', beschreibt er das pädagogische Grundprinzip des 'Getty Spirits'.“
Anderschs Ethos ist damit paradigmatisch für das Konzept der Westalliierten, einen staatsfernen, nicht zentralisierten Rundfunk in Deutschland zu etablieren, um eine erneute Instrumentalisierung des Massenmediums durch eine autoritäre Regierung zu verhindern. Diese „Programmatik einer demokratischen Medienöffentlichkeit, die einen größtmöglichen Pluralismus mit dem Auftrag der Bildung eines in fortschrittlichem Sinne kritischen Bewusstseins zu verbinden suchte“, hat in der Tat einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung der Bundesrepublik geleistet. Genau darin dürfte der Grund zu sehen sein, dass demokratiefeindliche Parteien heute die Schwächung bzw. Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Programm ausrufen.
Bezeichnenderweise war die Staatsferne des Rundfunks bereits der Adenauer-Regierung hochgradig unbequem, wie Ächtler am Beispiel des NWDR aufzeigt, für den auch Andersch tätig war: „Wie man inzwischen weiß, schreckte die Bundesregierung nicht einmal vor der illegalen geheimdienstlichen Infiltration des Senders zurück, um 'einen Rundfunksender in Misskredit zu bringen, der das Demokratisierungsgebot der britischen Deutschlandpolitik ernst nahm.' Die Anstalt wurde 1955 zugunsten von WDR und NDR liquidiert, der politisch nicht konforme Intendant Ernst Schnabel zum Rücktritt genötigt.“
Mit Adenauers Plänen zur Errichtung eines Staatsfernsehens Ende der 1950er sah Andersch die Demokratie in Westdeutschland dann vollends so gefährdet, dass ihm eine Emigration ins Ausland als Gebot der Stunde erschien: 1958 zog er in die Schweiz um, wo er bis an sein Lebensende blieb. Bereits früher artikulierte sich diese Sorge in Anderschs Briefwechsel (1953 bis 1962) mit dem bereits seit 1953 in Italien lebenden Komponisten Hans Werner Henze, den Lorenzo Bonosi in seinem Beitrag analysiert: „In Henze findet Andersch somit einen weiteren Gesprächspartner für das eigene Unbehagen, das er zu Beginn der 1950er Jahre verspürte und 1958 zu seinem Entschluss führen sollte, Deutschland zu verlassen.“
Ein Anlass für diese Sorge waren u.a. die heftigen Reaktionen von konservativ-katholischer Seite – inklusive Strafanzeigen – auf die Publikation von Arno Schmidts Seelandschaft mit Pocahontas in der ersten Ausgabe der von Andersch herausgegebenen Zeitschrift Texte und Zeichen, der Diego León-Villagrá einen Beitrag widmet. „Es ist unglaublich, wie sich der faschistische Flügel des Katholizismus daran entlarvt hat!“ schreibt Andersch an Schmidt, welcher wiederum alle seine Texte an seine in New York lebende Schwester schickt, weil er eine neuerliche Bücherverbrennung fürchtet: „I have lived to see books burned in my time; the Nazis did so by millions […]. As I am afraid, I am just the type, new Nazis would be glad of to burn the books, I should be greatly satisfied, to know the whole stuff in safety.“
Das Machtvakuum überließe die Deutungshoheit nur noch einmal den falschen Personen
Als Fazit ist festzuhalten: Der treibhaus-Band über Alfred Andersch bietet in seinen Dokumenten und Analysen ein facettenreiches, anschauliches Bild der Literaturlandschaft der Nachkriegsjahre und nicht zuletzt faszinierende Einblicke in das heute nahezu untergegangene Genre der Briefprosa – speziell die geistreichen, polemischen Briefzitate von Hans Werner Henze sind ein echtes intellektuelles Vergnügen.
Deutlich erkennbar wird Anderschs enorm einflussreiche Rolle als „eine[r] der wichtigsten Netzwerker der Literatur- und Medienszene der 1940er und 1950er Jahre“ (Norman Ächtler), deren Bedeutung für die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur und der bundesdeutschen Gesellschaft möglicherweise höher anzusetzen ist als die von Anderschs eigenen literarischen Werken.
Und etliche der Fragen, die Anderschs Biografie und Werk gerade in ihren unauflöslich ambivalenten Aspekten aufwerfen, haben angesichts der aktuellen politischen Situation in Deutschland leider eine Aktualität gewonnen, die weit über philologische Fragestellungen hinausgeht: Wie verhält man sich angesichts der drohenden Abschaffung der Demokratie? Emigrieren oder Widerstand leisten? Und wie kann dieser Widerstand aussehen?
Andersch, so Angelika Reinthal, habe nach seiner Entlassung aus der KZ-Haft 1933 versucht, aus der Geschichte zu emigrieren, aber, so zitiert sie Ursula Reinhold, „[d]iesen konsequenten Rückzug aus der Geschichte nahm Andersch aus späterer Sicht mit tiefer Bestürzung wahr.“ Da die 'Stunde Null', das Zurücksetzen auf einen Zustand vor dem eigenen moralischen Versagen, niemals wirklich möglich ist, sondern man immer vorwärts leben muss, bleibt die Erkenntnis, „dass man die Zukunft nicht durch ein neues Schweigen in der Literatur gestalten kann“, so Clemens Fuhrbach. Es lässt sich ergänzen: nicht nur in der Literatur, sondern in jedem Lebensbereich. Denn, so Fuhrbach weiter: „Das Machtvakuum, das damit entstünde, überließe die Deutungshoheit über die Kultur und über die Gesellschaft nur noch einmal den falschen Personen“, also denen, die heute – erneut! – die Demokratie zugunsten einer 'Volksgemeinschaft' abzuschaffen trachten.
Günter Häntzschel / Sven Hanuschek / Ulrike Leuschner: treibhaus. Jahrbuch für die Literatur der fünfziger Jahre. Band 20: Alfred Andersch. edition text + kritik, München 2024, 398 Seiten, 39 Euro.