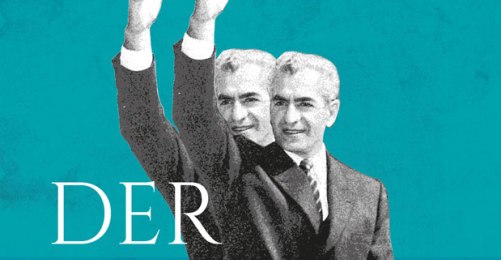Kultur trotz Corona: „Der falsche Schah“. Romanauszug von Leonhard F. Seidl
Leonhard F. Seidl (* 1976 in München) lebt als freier Schriftsteller, Journalist und Dozent für Kreatives Schreiben in Fürth. Er ist Vorsitzender des Schriftsteller*innen-Verbandes (VS), Mittelfranken und Mitglied im PEN. Mit dem Roman Mutterkorn (Kulturmaschinen, 2011) debütierte er, darauf folgten die Kriminalromane Genagelt (Emons, 2014), Viecher (Emons, 2015) und Fronten (Nautilus, 2017). Leonhard F. Seidl erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, u.a. ein Stipendium der Stiftung Literatur (2019) sowie das Literaturstipendium des Mittelalterlichen Kriminalmuseums Rothenburg o.d.T. und Turmschreiber in Abenberg (2020). Im Dezember 2020 erschien sein Schelmenroman Der falsche Schah (Volk Verlag).
Mit dem folgenden Auszug aus diesem zunächst unveröffentlichten Roman beteiligt sich Leonhard F. Seidl an ![]() „Kultur trotz Corona“, einem Projekt des Literaturportals Bayern zur Unterstützung bayerischer Literaturschaffender. Alle bisherigen Beiträge der Reihe finden Sie HIER.
„Kultur trotz Corona“, einem Projekt des Literaturportals Bayern zur Unterstützung bayerischer Literaturschaffender. Alle bisherigen Beiträge der Reihe finden Sie HIER.
*
Die Nazen sind zurück!
Voraussetzungen, die eine zwingende Schlussfolgerung zulassen, nennt man, wie jeder Mittelschüler in und außer Dienst gerne bestätigen wird, Prämissen. Die folgende wahre Geschichte hat der Prämissen zwei. Erstens: Kunst und Wirklichkeit sind in der Lage, die seltsamsten chemischen Verbindungen einzugehen. Zweitens: Die Rothenburger sind lustig.
An einem grauseligen Sonntag, dem 26. November 1950, ist in Rothenburg wieder was passiert. Und damit meine ich jetzt nicht die bayerischen Landtagswahlen, bei denen die Schwarzen das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte kassiert und die Roten die relative Mehrheit in Bayern eingefahren haben. Der König und die Anna sind gerade vom Wählen aus dem Rathaus gekommen und die Treppen runtergestiegen. In ihrer Mitten die zehnjährige Tochter Aurelia, die Wollmütze auf dem Kopf.
Da hört die Anna ein Dröhnen, das ihr unheimlich bekannt vorkommt, und ihr zieht‘s die Eingeweide zusammen. Ein Kübelwagen biegt aus der Hafengasse auf den Marktplatz. Gefolgt von einem Opel Blitz Mannschaftswagen, vollbesetzt mit finster dreinschauenden Wehrmachtssoldaten mit geschultertem Karabiner. Die Anna stolpert die Stufen herunter, bohrt ihre Fingernägel so fest in dem König seine Hand, dass er am liebsten laut losschreien tät. Tut er aber nicht, sondern funktioniert nur und führt die Anna und seine Tochter so ruhig wie möglich über den Marktplatz und um die Ecke vom Goldenen Lamm. Durchs enge, schattige Lammwirtsgässchen huschen sie auf die andere Seite vom Gasthof, mit dem goldenen Lamm über dem Eingang.
Da poltert auf einmal einer von oben: „Mir misse alli die Fahne naushenge!“
Und wie sie schauen, wo die Stimme herkommt, da sehen sie den roten Schädel vom Jessl, vom Wirt. Es folgt seine Hand mit der Fahne, die einmal „mehr als der Tod“ war. Und die rollt der jetzt vor den Augen vom König, der Anna und der Aurelia zum Fenster naus. Ohne sie vorher abzuklopfen, weshalb die Spinnweben wie wild fliegen, Teufelshaare heißen die Leute sie. Wenn das der Adi gesehen hätt ...
Die Fahne weht also wie ehedem im Wind. In Richtung des fahlbraunen Hauses, Kappelenplatz 3, schräg gegenüber. In der Wand ein eingelassenes Sprücherl in Frakturschrift:
Dieses mein Haus
Und mein Vaterland
Behalts o Gott in
Deiner Hand.
Die drei schleichen vorsichtig über den Kapellenplatz zum Seelenbrunnen, ohne ein Wort zu wechseln, biegen in die schmucklose Stollengasse ein, die erst wieder nach und nach aufgebaut worden ist und darum keinerlei Fachwerk zu vermelden hat. Und auch die Aurelia, die von klein auf ein Gefühl dafür gehabt hat, wann man reden und wann man sich lieber auf die Zunge beißen soll, ist stad. Im Pfeifersgässchen gehen sie an einem Schutthaufen vorbei und an den bleichen Häusern. Recht haben die Amis gehabt!, denkt der König in seiner Wut über die Wiederkehr der Verbrecher.
Am Markusturm vorbei huschen sie über die Rödergasse. Aber so, dass es keinem von den Nazis auffällt. Wobei sie seit dem Jessl oben am Fenster keinen mehr gesehen haben. Aber wer weiß, ob die hinkende Frau mit dem Korb nicht einer ist oder der Jugendliche in seiner Lederhosen? Betont konfidenziell biegen sie in den Alten Stadtgraben ein. Die Anna flüstert: „Wo willst eigentlich hin?“ Aber der König kommt gar nicht dazu zu antworten, sondern reibt sich die Augen, weil er glaubt, er sieht nicht recht. Und die Anna kriegt eine Gänsehaut.
Überall Leut, die wie im Krieg ihr Hab und Gut auf quietschenden Holzkarren schieben. Pappkartons schleppen. Dazwischen Wehrmachtssoldaten mit verbundenen Schädeln und Krücken. Vor einem Waffen-SS-Mann mit Augenklappe zuckt die Anna merklich zusammen.
Irgendwie schaffen sie's bis zum Ende vom alten Stadtgraben. Ohne aufgehalten zu werden. Gehen lieber nicht in die bucklige Goldene Ringgasse, weil‘s zu auffällig wär. Der Anna ihre zitternden Knie haben sich gerade wieder a weng beruhigt. Da schießt der Siebert Ludwig aus der Oberen Schmiedgasse, rum ums Eck. Schmettert lauthals: „Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen!“ Marschiert den Berg runter. Flankiert von Fachwerkhäusern. Mit einem Stock im Arsch.
Sie ignorieren ihn einfach und gehen weiter bergab zum Plönlein. An der Oberen Schmiedgasse 5 muss der König unweigerlich daran denken, wie der Lehrer Götz die Lina Ehrmann gedemütigt und geschlagen hat. Und das soll jetzt alles wieder von vorn anfangen?
Sie schauen, dass sie weiterkommen. Der König denkt ans Exil: Amerika, Südamerika, aber alle drei können s' kein Spanisch. Außerdem kann's passieren, dass sie dort wieder Nazis treffen, grad in Argentinien. Dann geht's am Hotel Goldener Hirsch vorbei, am Sieberstor, natürlich ordentlich auf dem Gehweg daneben, ins Spitalviertel. Sie schnaufen erleichtert aus, weil sie fünf Minuten lang keinen mehr von den Nazen gesehen haben. Der König wär erleichtert gewesen, wenn er mit seiner Anna und der total verstörten Aurelia schon – wie heute – beim Ruckesser den Durchbruch durch die Stadtmauer hätt nehmen oder auf die überdachte Stadtmauer steigen können. Weil, gefühlter Überblick. Aber damals war die ja zerstört vom Krieg und sie mussten noch ein bisserl weitergehn, rechts am Stacheldraht vorbei und dann über eine provisorische Leiter endlich rauf auf die Mauer, wo die Aurelia gestolpert ist, sich einen Spreißel eingezogen und zum Weinen angefangen hat.
Auf der Mauer laufen sie parallel zur Spitalgasse, um aus der Stadt raus und von den Nazen wegzukommen. Wohin, überlegt der König jetzt nicht weiter. Nur einzelne Schutthaufen erzählen noch vom Krieg. Und das soll jetzt wieder alles von vorn anfangen?, denkt der König noch einmal, weil er‘s einfach nicht glauben kann.
Er schaut auf die Fachwerkhäuser, die sich ihre Dächer wie bemooste Mützen über die Ohren ziehen als würden sie wieder einmal nicht hören wollen, was draußen vor sich geht. Er schaut in die Gärten der Rothenburger, in ihre Wohn- und Schlafzimmer, wo vereinzelt Kerzen brennen. Auf den Apfelbaum ohne Laub, die Rosen ohne Blätter. Dahinter spitzt das aufsteigende Taubertal auf, das den König in dem Moment nicht im Geringsten beruhigt.
Wie die Anna den Erich, den späteren Bürgermeister Dr. Lauterbach, in seinem Garten auf dem Rasen knien sieht, bleibt sie dermaßen abrupt stehen, dass der König in sie hineinrennt und sich das Kinn an ihrem harten Hinterkopf anhaut. Der Lauterbach schaufelt mit seinen Pratzen wie ein Maulwurf in der braunen Erde, dass sie nur so durch die Luft fliegt. Die Hose ist ihm runtergerutscht, dass die Anna sieht, was kein Mensch sehen will; weshalb sie der Aurelia die verweinten Augen zuhält. Dem Lauterbach ist das egal, weil er hofft, sein Parteibuch wiederzufinden, dass er vergraben hat, nachdem ihn die Amis unter Hausarrest gestellt haben. Mit einem freudigen „Heil Hitler!“ begrüßt er das Parteibuch dann auch und reckt es dem grauen Himmel mit ausgestrecktem Arm entgegen. Dann erst fällt ihm auf, dass es dem Adi ganz schön ähnlich schaut. Nachdem der verbrutzelt, zehnmal vergraben, wieder ausgegraben worden und zu guter Letzt von der Schweinebrücke als Asche in einen kleinen Nebenfluss der Elbe gekippt worden ist; die armen Fische.
Weil die Anna und der König das Trauerspiel vom Erich nicht mehr sehen wollen und die Aurelia es nicht sehen soll, hasten sie weiter auf der Burgmauer entlang. Aber die Flucht hilft ihnen nur insofern, als dass sie jetzt statt der Falte vom Erich die brutalen Krampfadern von der Margot anschauen müssen. Die hat nämlich, wie sie gehört hat – wobei, gehört hat sie nimmer viel, weil ihre acht Kinder enorm viel geplärrt haben, sondern eigentlich nur noch das, was sie hat hören wollen – also, wie sie gehört hat, dass die Nazen in der Stadt sind, hat sie die Holzleiter aus der Schupfa geholt. Die hat sie an die Eiche gelehnt, die jetzt einfach nur noch ein Baum war, und ist raufgeklettert. Dann hat sie das Vogelhäuserl durchsucht, gefunden, was sie gesucht hat, wenn auch verschissen, verklebt, verkrustet, voller Äste und Gras. Mit Silberpolitur hat sie’s anschließend geschrubbt, obwohl es ein goldenes Mutterkreuz war. Und es sich als „sichtbares Zeichen des Dankes des Deutschen Volkes an kinderreiche Mütter“ wieder stolz an die ausgezuzelte Brust geheftet. Die Aurelia hat‘s tatsächlich gewürgt bei dem Anblick.
Die graue, eckige Spitalkirche mit dem Turm mit Zeltdach sieht der König mit der Anna vor ihm und der Aurelia an der Hand nur zerstückelt zwischen den Schlitzen der Bretter. Dann versperren die Flanken der Dächer die Sicht, kommen immer näher, es wird enger, der König glaubt, hinter sich donnernde Schritte von Stiefeln und Schnaufen von der SS zu hören.
Kurz bevor sie am Ende der Stadtmauer zum Spitaltor kommen, zeigt die Aurelia stumm auf eine Taube, die unten, mausdreckerltot, in einer windschiefen, dunklen Regenrinne klebt. Die anderen Tauben gurren kopfzuckelnd und putzfidel um sie herum. Der König geht voran ins Dunkel, die Holztreppen hinunter. Das Licht zerstückelt von den Gitterstäben vor dem Fenster.
Am nächsten Tag hat sich die Aufregung in der Anna und im König wieder ein bisserl gelegt. Beim Jessl, dem Lauterbach, der Liesl und dem Siebert dagegen nicht. Die haben ganz schön das Arschflattern bekommen.
Trotzdem haben der König und die Anna sich am nächsten Tag gestritten wie noch nie in ihrem Leben. Die Anna hat getobt, weil sie überhaupt nicht eingesehen hat, dass der König unbedingt ein Waffen-SS-Mann werden wollt.
Es ist ihr einfach nicht in ihren gescheiten Kopf gegangen.
„Anna, was meinst, wie die sich ärgern!“, hat der König nach Stunden versöhnlich argumentiert.
„Hmm ...“, hat sie nur gemacht.
„Ich mach's nur, wenn du dabei bist.“
Es hat noch ein bisserl gedauert, aber sie war dann tatsächlich dabei. Und wenn du dir jetzt den Film „Entscheidung vor Morgengrauen“ anschaust, dann siehst du die Anna und den König im Hotel Goldener Hirsch tanzen. Der König in einer frisch gebügelten Waffen-SS-Uniform, in der Wirtsstube des Staudt'schen Hauses. Wie sie eine unbändige Freud haben, während die junge Hildegard Knef dem ebenso jungen Oskar Werner schöne Augen macht.
Was für ein Glück war das für den König: das zweite Mal vor der Kamera! Die quasi festhält, wie sie den Nazen wieder einmal eines auswischen.
Den Film haben sie sich natürlich auch ein Jahr später im Rothenburger Kino angeschaut. Was sie nicht gewusst haben, war, was da am Anfang des Films stehen würd: „Dieser Film wurde von französischen, deutschen und amerikanischen Künstlern ausgeführt, in einem leidenschaftlichen Bemühen um gerechte und unverfälschte Darstellung.“ Was ihnen auch gelungen ist.
Am ersten Drehtag ist nämlich ein alter, kränklicher Herr vor Schreck im Omnibus sitzen geblieben, wie er die Nazen gesehen hat. Er hat vor Schreck nicht aussteigen können. Er stammte aus der Gegend. Er war das gewesen, was man heutzutag einen „Gegner des Dritten Reiches“ nennt. Er hatte das seinerzeit gelegentlich zum Ausdruck gebracht und infolgedessen mit der SS Bekanntschaft machen müssen.
Nun saß er also, bleich wie der Tod, in der Ecke, unfähig, sich zu rühren, stumm, entsetzt, ein Bild des Jammers. Wie ihn dann der Regisseur beruhigen wollt und gesagt hat: „Nehmen Sie's doch nicht so tragisch. Wir drehen einen zeitnahen Film, wissen Sie. Es sind harmlose Leut aus der Stadt hier.“
Da schüttelte der alte Herr den Kopf und sagte leise: „Ich habe in dieser Gegend mit der SS öfter zu tun gehabt, Herr Regisseur. Sie haben gut ausgewählt, Herr Regisseur. Es sind fast alle dieselben! Bis auf den König.“
Was? Du glaubst mir die Geschichte nicht? Dann ließ nach, es hat vor mir auch schon ein anderer Kollege beschrieben.
Kultur trotz Corona: „Der falsche Schah“. Romanauszug von Leonhard F. Seidl
Leonhard F. Seidl (* 1976 in München) lebt als freier Schriftsteller, Journalist und Dozent für Kreatives Schreiben in Fürth. Er ist Vorsitzender des Schriftsteller*innen-Verbandes (VS), Mittelfranken und Mitglied im PEN. Mit dem Roman Mutterkorn (Kulturmaschinen, 2011) debütierte er, darauf folgten die Kriminalromane Genagelt (Emons, 2014), Viecher (Emons, 2015) und Fronten (Nautilus, 2017). Leonhard F. Seidl erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, u.a. ein Stipendium der Stiftung Literatur (2019) sowie das Literaturstipendium des Mittelalterlichen Kriminalmuseums Rothenburg o.d.T. und Turmschreiber in Abenberg (2020). Im Dezember 2020 erschien sein Schelmenroman Der falsche Schah (Volk Verlag).
Mit dem folgenden Auszug aus diesem zunächst unveröffentlichten Roman beteiligt sich Leonhard F. Seidl an ![]() „Kultur trotz Corona“, einem Projekt des Literaturportals Bayern zur Unterstützung bayerischer Literaturschaffender. Alle bisherigen Beiträge der Reihe finden Sie HIER.
„Kultur trotz Corona“, einem Projekt des Literaturportals Bayern zur Unterstützung bayerischer Literaturschaffender. Alle bisherigen Beiträge der Reihe finden Sie HIER.
*
Die Nazen sind zurück!
Voraussetzungen, die eine zwingende Schlussfolgerung zulassen, nennt man, wie jeder Mittelschüler in und außer Dienst gerne bestätigen wird, Prämissen. Die folgende wahre Geschichte hat der Prämissen zwei. Erstens: Kunst und Wirklichkeit sind in der Lage, die seltsamsten chemischen Verbindungen einzugehen. Zweitens: Die Rothenburger sind lustig.
An einem grauseligen Sonntag, dem 26. November 1950, ist in Rothenburg wieder was passiert. Und damit meine ich jetzt nicht die bayerischen Landtagswahlen, bei denen die Schwarzen das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte kassiert und die Roten die relative Mehrheit in Bayern eingefahren haben. Der König und die Anna sind gerade vom Wählen aus dem Rathaus gekommen und die Treppen runtergestiegen. In ihrer Mitten die zehnjährige Tochter Aurelia, die Wollmütze auf dem Kopf.
Da hört die Anna ein Dröhnen, das ihr unheimlich bekannt vorkommt, und ihr zieht‘s die Eingeweide zusammen. Ein Kübelwagen biegt aus der Hafengasse auf den Marktplatz. Gefolgt von einem Opel Blitz Mannschaftswagen, vollbesetzt mit finster dreinschauenden Wehrmachtssoldaten mit geschultertem Karabiner. Die Anna stolpert die Stufen herunter, bohrt ihre Fingernägel so fest in dem König seine Hand, dass er am liebsten laut losschreien tät. Tut er aber nicht, sondern funktioniert nur und führt die Anna und seine Tochter so ruhig wie möglich über den Marktplatz und um die Ecke vom Goldenen Lamm. Durchs enge, schattige Lammwirtsgässchen huschen sie auf die andere Seite vom Gasthof, mit dem goldenen Lamm über dem Eingang.
Da poltert auf einmal einer von oben: „Mir misse alli die Fahne naushenge!“
Und wie sie schauen, wo die Stimme herkommt, da sehen sie den roten Schädel vom Jessl, vom Wirt. Es folgt seine Hand mit der Fahne, die einmal „mehr als der Tod“ war. Und die rollt der jetzt vor den Augen vom König, der Anna und der Aurelia zum Fenster naus. Ohne sie vorher abzuklopfen, weshalb die Spinnweben wie wild fliegen, Teufelshaare heißen die Leute sie. Wenn das der Adi gesehen hätt ...
Die Fahne weht also wie ehedem im Wind. In Richtung des fahlbraunen Hauses, Kappelenplatz 3, schräg gegenüber. In der Wand ein eingelassenes Sprücherl in Frakturschrift:
Dieses mein Haus
Und mein Vaterland
Behalts o Gott in
Deiner Hand.
Die drei schleichen vorsichtig über den Kapellenplatz zum Seelenbrunnen, ohne ein Wort zu wechseln, biegen in die schmucklose Stollengasse ein, die erst wieder nach und nach aufgebaut worden ist und darum keinerlei Fachwerk zu vermelden hat. Und auch die Aurelia, die von klein auf ein Gefühl dafür gehabt hat, wann man reden und wann man sich lieber auf die Zunge beißen soll, ist stad. Im Pfeifersgässchen gehen sie an einem Schutthaufen vorbei und an den bleichen Häusern. Recht haben die Amis gehabt!, denkt der König in seiner Wut über die Wiederkehr der Verbrecher.
Am Markusturm vorbei huschen sie über die Rödergasse. Aber so, dass es keinem von den Nazis auffällt. Wobei sie seit dem Jessl oben am Fenster keinen mehr gesehen haben. Aber wer weiß, ob die hinkende Frau mit dem Korb nicht einer ist oder der Jugendliche in seiner Lederhosen? Betont konfidenziell biegen sie in den Alten Stadtgraben ein. Die Anna flüstert: „Wo willst eigentlich hin?“ Aber der König kommt gar nicht dazu zu antworten, sondern reibt sich die Augen, weil er glaubt, er sieht nicht recht. Und die Anna kriegt eine Gänsehaut.
Überall Leut, die wie im Krieg ihr Hab und Gut auf quietschenden Holzkarren schieben. Pappkartons schleppen. Dazwischen Wehrmachtssoldaten mit verbundenen Schädeln und Krücken. Vor einem Waffen-SS-Mann mit Augenklappe zuckt die Anna merklich zusammen.
Irgendwie schaffen sie's bis zum Ende vom alten Stadtgraben. Ohne aufgehalten zu werden. Gehen lieber nicht in die bucklige Goldene Ringgasse, weil‘s zu auffällig wär. Der Anna ihre zitternden Knie haben sich gerade wieder a weng beruhigt. Da schießt der Siebert Ludwig aus der Oberen Schmiedgasse, rum ums Eck. Schmettert lauthals: „Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen!“ Marschiert den Berg runter. Flankiert von Fachwerkhäusern. Mit einem Stock im Arsch.
Sie ignorieren ihn einfach und gehen weiter bergab zum Plönlein. An der Oberen Schmiedgasse 5 muss der König unweigerlich daran denken, wie der Lehrer Götz die Lina Ehrmann gedemütigt und geschlagen hat. Und das soll jetzt alles wieder von vorn anfangen?
Sie schauen, dass sie weiterkommen. Der König denkt ans Exil: Amerika, Südamerika, aber alle drei können s' kein Spanisch. Außerdem kann's passieren, dass sie dort wieder Nazis treffen, grad in Argentinien. Dann geht's am Hotel Goldener Hirsch vorbei, am Sieberstor, natürlich ordentlich auf dem Gehweg daneben, ins Spitalviertel. Sie schnaufen erleichtert aus, weil sie fünf Minuten lang keinen mehr von den Nazen gesehen haben. Der König wär erleichtert gewesen, wenn er mit seiner Anna und der total verstörten Aurelia schon – wie heute – beim Ruckesser den Durchbruch durch die Stadtmauer hätt nehmen oder auf die überdachte Stadtmauer steigen können. Weil, gefühlter Überblick. Aber damals war die ja zerstört vom Krieg und sie mussten noch ein bisserl weitergehn, rechts am Stacheldraht vorbei und dann über eine provisorische Leiter endlich rauf auf die Mauer, wo die Aurelia gestolpert ist, sich einen Spreißel eingezogen und zum Weinen angefangen hat.
Auf der Mauer laufen sie parallel zur Spitalgasse, um aus der Stadt raus und von den Nazen wegzukommen. Wohin, überlegt der König jetzt nicht weiter. Nur einzelne Schutthaufen erzählen noch vom Krieg. Und das soll jetzt wieder alles von vorn anfangen?, denkt der König noch einmal, weil er‘s einfach nicht glauben kann.
Er schaut auf die Fachwerkhäuser, die sich ihre Dächer wie bemooste Mützen über die Ohren ziehen als würden sie wieder einmal nicht hören wollen, was draußen vor sich geht. Er schaut in die Gärten der Rothenburger, in ihre Wohn- und Schlafzimmer, wo vereinzelt Kerzen brennen. Auf den Apfelbaum ohne Laub, die Rosen ohne Blätter. Dahinter spitzt das aufsteigende Taubertal auf, das den König in dem Moment nicht im Geringsten beruhigt.
Wie die Anna den Erich, den späteren Bürgermeister Dr. Lauterbach, in seinem Garten auf dem Rasen knien sieht, bleibt sie dermaßen abrupt stehen, dass der König in sie hineinrennt und sich das Kinn an ihrem harten Hinterkopf anhaut. Der Lauterbach schaufelt mit seinen Pratzen wie ein Maulwurf in der braunen Erde, dass sie nur so durch die Luft fliegt. Die Hose ist ihm runtergerutscht, dass die Anna sieht, was kein Mensch sehen will; weshalb sie der Aurelia die verweinten Augen zuhält. Dem Lauterbach ist das egal, weil er hofft, sein Parteibuch wiederzufinden, dass er vergraben hat, nachdem ihn die Amis unter Hausarrest gestellt haben. Mit einem freudigen „Heil Hitler!“ begrüßt er das Parteibuch dann auch und reckt es dem grauen Himmel mit ausgestrecktem Arm entgegen. Dann erst fällt ihm auf, dass es dem Adi ganz schön ähnlich schaut. Nachdem der verbrutzelt, zehnmal vergraben, wieder ausgegraben worden und zu guter Letzt von der Schweinebrücke als Asche in einen kleinen Nebenfluss der Elbe gekippt worden ist; die armen Fische.
Weil die Anna und der König das Trauerspiel vom Erich nicht mehr sehen wollen und die Aurelia es nicht sehen soll, hasten sie weiter auf der Burgmauer entlang. Aber die Flucht hilft ihnen nur insofern, als dass sie jetzt statt der Falte vom Erich die brutalen Krampfadern von der Margot anschauen müssen. Die hat nämlich, wie sie gehört hat – wobei, gehört hat sie nimmer viel, weil ihre acht Kinder enorm viel geplärrt haben, sondern eigentlich nur noch das, was sie hat hören wollen – also, wie sie gehört hat, dass die Nazen in der Stadt sind, hat sie die Holzleiter aus der Schupfa geholt. Die hat sie an die Eiche gelehnt, die jetzt einfach nur noch ein Baum war, und ist raufgeklettert. Dann hat sie das Vogelhäuserl durchsucht, gefunden, was sie gesucht hat, wenn auch verschissen, verklebt, verkrustet, voller Äste und Gras. Mit Silberpolitur hat sie’s anschließend geschrubbt, obwohl es ein goldenes Mutterkreuz war. Und es sich als „sichtbares Zeichen des Dankes des Deutschen Volkes an kinderreiche Mütter“ wieder stolz an die ausgezuzelte Brust geheftet. Die Aurelia hat‘s tatsächlich gewürgt bei dem Anblick.
Die graue, eckige Spitalkirche mit dem Turm mit Zeltdach sieht der König mit der Anna vor ihm und der Aurelia an der Hand nur zerstückelt zwischen den Schlitzen der Bretter. Dann versperren die Flanken der Dächer die Sicht, kommen immer näher, es wird enger, der König glaubt, hinter sich donnernde Schritte von Stiefeln und Schnaufen von der SS zu hören.
Kurz bevor sie am Ende der Stadtmauer zum Spitaltor kommen, zeigt die Aurelia stumm auf eine Taube, die unten, mausdreckerltot, in einer windschiefen, dunklen Regenrinne klebt. Die anderen Tauben gurren kopfzuckelnd und putzfidel um sie herum. Der König geht voran ins Dunkel, die Holztreppen hinunter. Das Licht zerstückelt von den Gitterstäben vor dem Fenster.
Am nächsten Tag hat sich die Aufregung in der Anna und im König wieder ein bisserl gelegt. Beim Jessl, dem Lauterbach, der Liesl und dem Siebert dagegen nicht. Die haben ganz schön das Arschflattern bekommen.
Trotzdem haben der König und die Anna sich am nächsten Tag gestritten wie noch nie in ihrem Leben. Die Anna hat getobt, weil sie überhaupt nicht eingesehen hat, dass der König unbedingt ein Waffen-SS-Mann werden wollt.
Es ist ihr einfach nicht in ihren gescheiten Kopf gegangen.
„Anna, was meinst, wie die sich ärgern!“, hat der König nach Stunden versöhnlich argumentiert.
„Hmm ...“, hat sie nur gemacht.
„Ich mach's nur, wenn du dabei bist.“
Es hat noch ein bisserl gedauert, aber sie war dann tatsächlich dabei. Und wenn du dir jetzt den Film „Entscheidung vor Morgengrauen“ anschaust, dann siehst du die Anna und den König im Hotel Goldener Hirsch tanzen. Der König in einer frisch gebügelten Waffen-SS-Uniform, in der Wirtsstube des Staudt'schen Hauses. Wie sie eine unbändige Freud haben, während die junge Hildegard Knef dem ebenso jungen Oskar Werner schöne Augen macht.
Was für ein Glück war das für den König: das zweite Mal vor der Kamera! Die quasi festhält, wie sie den Nazen wieder einmal eines auswischen.
Den Film haben sie sich natürlich auch ein Jahr später im Rothenburger Kino angeschaut. Was sie nicht gewusst haben, war, was da am Anfang des Films stehen würd: „Dieser Film wurde von französischen, deutschen und amerikanischen Künstlern ausgeführt, in einem leidenschaftlichen Bemühen um gerechte und unverfälschte Darstellung.“ Was ihnen auch gelungen ist.
Am ersten Drehtag ist nämlich ein alter, kränklicher Herr vor Schreck im Omnibus sitzen geblieben, wie er die Nazen gesehen hat. Er hat vor Schreck nicht aussteigen können. Er stammte aus der Gegend. Er war das gewesen, was man heutzutag einen „Gegner des Dritten Reiches“ nennt. Er hatte das seinerzeit gelegentlich zum Ausdruck gebracht und infolgedessen mit der SS Bekanntschaft machen müssen.
Nun saß er also, bleich wie der Tod, in der Ecke, unfähig, sich zu rühren, stumm, entsetzt, ein Bild des Jammers. Wie ihn dann der Regisseur beruhigen wollt und gesagt hat: „Nehmen Sie's doch nicht so tragisch. Wir drehen einen zeitnahen Film, wissen Sie. Es sind harmlose Leut aus der Stadt hier.“
Da schüttelte der alte Herr den Kopf und sagte leise: „Ich habe in dieser Gegend mit der SS öfter zu tun gehabt, Herr Regisseur. Sie haben gut ausgewählt, Herr Regisseur. Es sind fast alle dieselben! Bis auf den König.“
Was? Du glaubst mir die Geschichte nicht? Dann ließ nach, es hat vor mir auch schon ein anderer Kollege beschrieben.