Über die Poetik des Scheiterns bei Thomas von Steinaecker
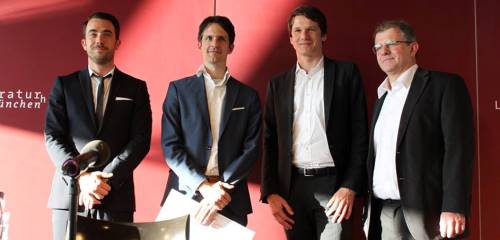
Der Carl-Amery-Preis, der alle zwei Jahre vom Verband deutscher Schriftsteller in Bayern verliehen wird, soll an den Münchner Schriftsteller Carl Amery (1922-2005) und sein Lebenswerk erinnern. 2017 erhält den Preis Thomas von Steinaecker, der mit Romanen wie Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen und Die Verteidigung des Paradieses auf, wie die Jury urteilt, „einzigartige Weise die Beobachtung von gesellschaftlicher Gegenwart und das Möglichkeitsdenken der Literatur verbindet“. Bei der Verleihung im Literaturhaus München hielt Fridolin Schley diese Laudatio.
*
Fallen und Fliegen
Auf ein paar wenigen Seiten einem Preisträger gerecht zu werden, der uns mit gerade einmal vierzig Jahren ein fast unverfroren umfangreiches und vielschichtiges Werk beschert hat, der im vergangenen Jahr seinen bereits fünften Roman veröffentlichte – und wie zumeist nicht gerade ein wortkarges Buch – der, wie mal eben nebenher, bald jährlich Dokumentarfilme dreht, Hörstücke schreibt, zum Wegbereiter des aktuellen Comic- und Graphic Novel-Aufschwungs avancierte, zum Medientheoretiker und promovierten Literaturwissenschaftler sowieso – einen solchen Ausnahmekünstler also angemessen zu ehren, das ist natürlich ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen.
Aber gerade das gilt es nicht etwa zu beklagen, sondern im Gegenteil fest zu umgreifen – und zu verstehen, dass der Position des Vergeblichen auch eine ungeheure Freiheit innewohnt; dass, wer nicht gewinnen kann, auch nicht mehr viel zu verlieren hat; dass daraus plötzlich ein Gefühl von Leichtigkeit erwächst – und dass wir genau hier bereits mitten drin sind in Thomas von Steinaeckers poetischer Conditio Humana: einem Ineinander von vermeintlichem Scheitern-müssen und gleichzeitig daraus keimender Hoffnung.
Um dieses scheinbare Paradox kreist für mich sein Werk, und um es zu verstehen, muss man gar nicht erst bei den Existenzialisten nachlesen, dass der Mensch sich erst im Angesicht des Scheiterns ganz vollendet, sondern man kann einfach die Romane von Thomas von Steinaecker lesen und überlegen, warum sie einen bei allem Intellekt auch derart berühren, einen berühren, obwohl sie doch oft so präzise entworfen sind, so kühn strukturiert, ja kühl im positiven Sinne einer impassibilité, wie Gustave Flaubert sie entwickelt hat, einer leidenschaftsbeherrschten Anschauung der Wirklichkeit, deren Partikel wie durch den Blick eines künstlichen Auges universelle Gültigkeit erhalten.
In der Schwebe
Wenn uns die Bücher Thomas von Steinaeckers dennoch berühren, dann weil sein unbestechlich analytischer Blick zwar die Verirrungen, die Zwänge und Härten unserer Gesellschaft seziert und bloßlegt, niemals aber seine Figuren dabei bloßstellt, die an ihr leiden müssen und oft genug an ihr scheitern, sei es im sozialen oder im moralischen Sinne, meistens in beidem. Der Erzähler unterwirft sie keinen klinischen Laborversuchen, befriedigt sich nicht an ihrem Scheitern, sondern bewahrt diesem, indem er es in eine ästhetische Form gießt, seine menschliche Kategorie, ja die Würde, die ein Mensch noch im freien Fall haben kann – so wie Günter Wallner, der gleich zu Beginn von Thomas' Debütroman Wallner beginnt zu fliegen in einem Unglückszug noch für eine Sekunde schwerelos schwebt, wie endlich erlöst, bevor er in einem schrecklichen Unfall zerschellt.
In jener Sekunde ist plötzlich alles möglich, alles Gesetzte aufgehoben und im Grunde nicht zu unterscheiden, ob Wallner nun fliegt oder fällt, wie bei dem tanzenden Taumeln einer letzten Flocke im Flutlicht, wie Thomas von Steinaecker es einmal in einer ganz frühen Erzählung beschrieben hat, und natürlich schafft das von allen Künsten nur die schreibende, dass sich diese eine Sekunde, dieser winzige Moment zu einem Raum öffnet, der so frei und weit ist, dass fünf Romane hineinpassen – und alle, die noch folgen werden.
Diese Romane berühren uns aber nicht nur, weil ihr Autor über die vielen Diskurse, die er einbindet, die menschlichen Sehnsüchte nicht vergisst, die sie überhaupt erst atmen lassen, ihnen Relevanz verleihen, sondern vor allem auch, weil er sich nicht über ihr Ringen mit dem Scheitern erhebt, weil wir spüren: er ist einer von ihnen, er ist selbst Teil der Versuchsanordnung, auch er ist in Versuchung geführt.
Das merkt man zum Beispiel daran, dass er es sich nie in seinem schon früh gerühmten Stil bequem gemacht hat, sondern sich an immer abenteuerlicheren Formen und Genres neu erprobt – denken Sie an die verspiegelten Zeitebenen von Wallner beginnt zu fliegen, bei dem unsere Gegenwart als zukünftige Vergangenheit erzählt wird, also eine Art Science-Fiction unter falschem Vorzeichen, oder an Schutzgebiet, der wiederum vordergründig ein historischer Roman ist, allerdings modern medialisiert, oder an Die Verteidigung des Paradieses, eine helle Coming-of-Age-Geschichte inmitten einer dunklen Dystopie.
Dass der Autor sich selbst den Risiken des Experiments aussetzt, merkt man aber auch stets am Tonfall seiner Sprache, an jenen unterschwelligen Herzrhythmusgeräuschen, die jeden Text zwischen den Zeilen heimlich beherrschen wie ein Nervensystem. Die Wahrheit eines Textes steckt ja in seinem Ton – und auch die Haltung seines Erzählers zur Welt.
In Thomas von Steinaeckers ersten beiden Romanen war das manchmal ein Ton von so klirrender Klarheit, dass man mitunter meinte, irgendwo in den Sätzen ein leises, hohes Knirschen zu hören, wie von einem zum Bersten angespannten Stück Glas, auf dem sich die ersten Risse ausbreiten, kurz bevor es zerspringt, oder von dem dünnen Eis, auf das er uns längst geführt hat, den Leser, die Figuren und sich selbst.
Während andere Schriftsteller ein ganzes Leben dafür brauchen, ihren Ton zu finden, und es meist doch nicht schaffen, hatte Thomas von Steinaecker von Anfang an die Chuzpe, ihn von Buch zu Buch ganz bewusst zu verändern; und wenn man dabei nun doch eine gewisse Linie ausmachen wollte, könnte man vielleicht sagen, dass er wärmer geworden ist – am deutlichsten sicherlich im jüngsten Roman Die Verteidigung des Paradieses, bei dem der Autor aber im Grunde nur noch einen Schritt weiter geht, das Risiko noch einmal verschärft: indem er nun sogar innerhalb eines Buches den Ton variiert, je nach der Entwicklung des jungen Heinz und seiner Schreibversuche, die inmitten einer untergehenden Welt mal übermütig und ungeschliffen ins Heft notiert werden, mit hohem Brustton oder Jugendjargon oder überschwänglichem Pathos.
Das Schreiben selbst befindet sich also mit ihm auf einer parallel verlaufenden Reise, hin zu einer authentischen Sprache. Hier wird keine Kindheit von außen erzählt, sondern ihr selbst das Wort erteilt – und dafür braucht es Mut: sich als Autor nicht auf die Virtuosität der eigenen Sprachakrobatik zu verlassen, sondern Sprache, Ton und Rhythmus als Teile, als Mitspieler der Fiktion zu begreifen und sie gewissermaßen frei zu lassen, so wie es uns einst die Strukturalisten gelehrt haben, die uneitelsten aller literarischen Denkschüler: das Werk ist alles.
Diese verwegene Selbstauslieferung an den Text birgt jedoch noch eine weitere Gefahr, die der Autor eigens heraufbeschwört, um sich ihr wieder und wieder zu stellen – nämlich die des eigenen Zweifels. Wer bei jedem Buch erneut alles aufs Spiel setzt, kann sich seiner selbst nie ganz gewiss sein – oder, um in unserem Bild zu bleiben: er springt von der Kante, ohne zu wissen, ob die eigenen Sätze ihn noch einmal tragen werden oder er schon im nächsten Moment zerschellt.
Die Folge ist eine tief empfundene, ihn oft quälende Skrupulösität, die ich so von kaum einem anderen derart renommierten Schriftsteller kenne. Das geht so weit, dass Thomas von Steinaecker etwa bei der Entstehung seines letzten Romans, als das Manuskript endlich durchgeschrieben war, plötzlich hunderte von Seiten einfach weggeworfen hat, um sie nochmal neu zu schreiben. Wer macht so etwas denn heute noch, da Bücher in 'Marktsegmente' und 'Zeitfenster' passen müssen – und wenn man ihn dann fragte, wie er nur so unbarmherzig gegenüber den eigenen Mühen, der jahrelangen Arbeit sein könne, hat er nur geantwortet: „Och, es hat dem Roman, der er sein konnte, halt einfach nicht mehr entsprochen."
Von der fiktionalen Ebene seiner Figuren, über die Gesellschaft, die sie gebärt, bis hin zur Fläche seines eigenen Schreibtischs – das Scheitern ist bei Thomas von Steinaecker also immer anwesend, beäugt ihn aus verschiedenen Ecken seines inneren Zimmers, halb bedrohlich, halb zutraulich. Vielleicht können wir es uns als rosa Kaninchen vorstellen oder als meinen Freund Harvey oder als ein kleines Nashorn von Ionesco oder als Affen Schimmi oder als in Mullbinden einbandagiertes Schmürz von Boris Vian – auf jeden Fall aber sollten wir es uns als eine Art Wächter vorstellen, wie Borges ihn beschrieben hat, als Cartaphilus, als Bücherfreund.
Denn der Zweifel ist nicht nur ein penetrantes Nagewesen, sondern auch eine jahrhundertealte, produktive Kraft, die es – anders als die Lüge – in diesen Zeiten leider schwer hat, sich zu behaupten, nicht nur in der Literatur, sondern gerade auch in der Gesellschaft, in der Politik. Wer erlaubt sich heute noch zu zweifeln?
Aber wenn das Scheitern und Zweifeln immer präsente Möglichkeiten sind und sein müssen, dann eben im doppelten Sinne, nicht nur als dräuendes Fehlschlagen, sondern auch als künstlerischer Antrieb, oder eher: als Auftrieb, ähnlich jenem, der Günter Wallner in besagtem Unglücks-ICE für einen kurzen, ewigen Moment anhebt und in der Luft hält, während um ihn herum, in dem Abteil und den vielen beschriebenen Seiten des Romans, die ihn einbetten, schon alles schwerelos zueinander findet, was Thomas von Steinaeckers Werk einmal schweben lassen wird, was sich darin auf oft beunruhigende, aber nur umso faszinierendere Weise verschlingt, gegenseitig verzehrt und im selben Augenblick schon wieder gebärt: das Fallen und das Fliegen, die Vergeblichkeit und die Hoffnung.
Bleibende Literatur kann, so glaube ich fest, nur dort entstehen, wo sich der Schreibende nicht auf der sicheren Seite weiß, sowohl ästhetisch als auch moralisch. Um sich dennoch über solch unsicheren Grund auf den Weg zu machen, benötigt man erneut ziemlich guten Mut, gewissermaßen den Zwillingsbruder des Zweifels, oder am besten gleich eine Portion Übermut, jene Mischung aus berstender Hemmung des Anfangs und einer Prise Größenwahn, wie sie in so tänzelnder Leichtigkeit vielleicht nur die Jugend kennt.
Man kann das an Thomas von Steinaeckers früher Jugendprosa sehr schön ablesen, diese Gier nach Buchstaben und ihrem launischen Verlauf, der den Weltgeist zum Sprachspiel verführt – es geht ja nur ums Leben.
Thomas ist damals 15, 16 Jahre alt, und endlos sind die Fahrradfahrten nach der Schule durch den Hopfenstangen-Dschungel der Hollertau, so hat er es später einmal beschrieben, immer größer die Geschichten, die sich dabei plötzlich in seinem Kopf auftun, ihn forttragen über die Grenzen des Pfaffenhofener Umlands, und seine Vorgabe lautet damals: einen Satz pro Tag schreiben – aber der soll dann auch bleiben dürfen, möglichst für die Ewigkeit, so wie jeder dieser kleinen ersten Texte am liebsten gleich die ganze Weltgeschichte erzählen wollte.
Mit den üblichen Pubertätsergüssen hat er sich da gar nicht erst aufgehalten. Bei ihm verlieben sich nicht etwa Mädchen und Jungen ineinander, sondern buchstäblich gleich ganze Erdplatten, die sich krachend vereinen in der Erzählung Sex oder Der erotische Faktor der Plattentektonik. In einer anderen mit dem ebenso überbordenen Titel Weltuntergangsüberschwemmungs-geschichte beschwört er mal eben die Apokalypse, halb als Oper, halb als Comicblase, nur um in der nächsten sogleich einen neuen Heiland auf die Erde zu schicken und seinerseits an ihr scheitern zu lassen.
Welten gehen unter und auf. Der Mensch erleuchtet kurz und fällt für immer, wie eine letzte Flocke im Flutlicht. Darunter hat es Thomas von Steinacker schon als Jugendlicher nicht gemacht.
Den Anfang seines Schreibens markiert neben dieser wilden inhaltlichen Angriffslust aber auch ein völlig ungewöhnlicher Wille zur Form. Die Sätze vermitteln nicht bloß etwas, sondern bersten selbst regelrecht vor verdichteter Sprachkraft, sie brechen sich Bahn, zischen und knistern, stoßen und drängen nach Rhythmus und Lautmalerei, Laute werden Wörter werden Bilder werden Fetzen werden Sätze werden wieder still.
Eine Selbstgeburt der Sprache bezeugt sich hier, und wir müssen uns dazu vielleicht die dissonanten Klangwelten eines Karl-Heinz Stockhausen vorstellen, das Blubbern und Gluckern und die versteckten Melodien, in denen sich Thomas schon als Teenager verlor, um dazu in der Fantasie ferne Welten zu entwerfen, ebenso wie zu den Büchern Kafkas oder Jules Vernes – und so den einsamen heißen Sommern des Landlebens zu entkommen und seinen wenigen tristen Höhepunkten wie den Gruppenstunden des Kolpingvereins.
Über Stockhausen hat er dann viele Jahre später den ersten seiner Dokumentarfilme gedreht, von denen sich auffallend viele mit Musik beschäftigen – was natürlich kein Zufall ist, aber in der Betrachtung seines literarischen Werkes meiner Meinung nach bisher viel zu kurz kam. Falls also jemand noch ein Thema für eine Dissertation sucht: Musikalische Sprachprinzipien – ich glaube, da würde man in Thomas von Steinaeckers Werk auf viel Interessantes stoßen.
Operationen am offenen Herzen
Als dann etliche Jahre später, übrigens ziemlich genau vor zehn Jahren, sein erster Roman erschien, Wallner beginnt zu fliegen, hatte er sich einerseits doch noch zu einem gewissermaßen normaleren Erzähler entwickelt – das Buch hat ja eine regelrechte Handlung und eine ziemlich ausgefeilte Dramaturgie – aber andererseits doch noch einiges von der experimentellen Waghalsigkeit seiner Anfänge hinübergerettet.
So ist überhaupt nur die ungeheure Wirkung zu erklären, die dieses Buch damals entfaltete. Florian Kessler hat das einmal sehr schön beschrieben: wie man damals, vor allem die Menschen unserer Lese- und Schreibgeneration, das Gefühl hatte, hier tritt jemand für uns ganz neue Wege aus, so als würde nicht nur Günter Wallner zu Beginn des Romans für eine Sekunde aus seinem Sitz gehoben und in der Luft stehen, sondern als würden mit ihm auch die geltenden Regeln des realistischen Erzählens ausgehebelt und die junge Literatur selbst schwebte dort und begänne loszufliegen zu dem, was sie alles sein konnte.
Da waren plötzlich Comic-Strips in den Roman eingeflochten, da bestanden ganze Kapitel manchmal nur aus ein oder zwei Wörtern, da waren Elemente von Collage und Montage – und da war nach Jahren der Popliteratur und der nachwehenden Postmoderne mit einem mal eine kompromisslose Ernsthaftigkeit zu spüren, die trotzdem verspielt sein konnte, ja sogar sein musste, wollte sie ihrem Gegenstand gerecht werden, und der war natürlich mal wieder das große Ganze, das große Spiel namens Gesellschaft, wie Bourdieu es genannt hat.
Dass man die postmodernen Verspiegelungen literarisch nutzen kann, ohne dabei nur originell um eine leere Mitte zu kreisen; dass man mit kühlem Besteck die pulsierenden Wunden unserer durchmedialisierten und -ökonomisierten Gegenwart offenlegen kann, ohne es sich dabei in der Ironie der Ironie der Ironie bequem zu machen oder sich zynisch daran zu ergötzen – und überhaupt: dass aufklärender Realismus und virtuose Künstlichkeit sich eben nicht ausschließen müssen … bei alldem hatte Thomas von Steinaecker damals ein wichtiges Vorbild in David Foster Wallace und einen großen Bruder im Geiste, ohne dessen Roman Infinite Jest, wie Thomas später einmal notierte, heute für ihn wohl nichts so wäre, wie es ist.
Mit Foster Wallace verbindet ihn vor allem aber noch eines: die Bereitschaft, Ambivalenzen auszuhalten, den Leser zu irritieren, eine Literatur der Destabilisierung, nicht aber der Dekonstruktion. Oder, um es einfacher zu sagen: Beide beschreiben das vielschichtige Scheitern unserer Zeit, aber wie in jeder Verlustanzeige ist das Eigentliche dabei das Vermisste, und das ist hier: das Humane, das aller Vergeblichkeit innewohnt. Oder noch einfacher: Thomas von Steinaecker seziert manchmal brutal das kranke Innere der Gesellschaft – aber solange am offenen Herzen operiert wird, schlägt es zumindest noch.
In Wallner beginnt zu fliegen schlägt es leise den Takt für eine verborgene Sehnsucht aller Figuren nach einem anderen, wahrhaftigeren Leben, so endgültig verloren sie auch erscheinen in einer Welt, in der es keine Erfahrung mehr gibt außer der medial vermittelten und damit auch keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern nur noch eine öde Gegenwart aus hohlen Sprechformen und geschichtsblinder Retromanie. Der Vater Stefan Wallner begeht so lange Selbstbetrug am Familiengedächtnis, bis die Privatmythen ins Reich der Paranoia driften, und sein Sohn Costin macht eine Scheinkarriere als Reality-Star, bis er irgendwann ein Gefühl nicht mehr von dessen Inszenierung unterscheiden kann.
Es ist eine Familiensaga der Unaufrichtigkeit, eine Zeitgeschichte über die Konstruktion von Geschichten und die vielen kleinen Lügen, die sie formen. Aber bei diesem eisigen Befund belässt es der Erzähler eben nicht, auch in ihm schlägt, etwas verlegen vielleicht noch, das Herz eines Romantikers, eines Märchenerzählers, und so setzt sich die Enkelin Wendy am Ende hin und beginnt die Geschichte ihrer Familie aufzuschreiben, jenes Buch, das wir in Händen halten. Auch sie wird dabei natürlich scheitern, wird die Wahrheit nicht finden, sondern ihrerseits eher löschen und überschreiben, aber sie hinterlässt dabei doch eine menschliche Spur – und das ist nicht wenig. Es ist die schmale „Leuchtspur durchs dunkle All“, wie es an anderer Stelle bei Thomas von Steinaecker einmal heißt. Nur die Sprache kann noch dem Verstummen, dem Nichts ein Zeichen setzten. „Die Sterne werden die Sterne sein“, lesen wir da, „die Sonne wird die Sonne sein.“ Aber nichts wird nicht sein.
Diese Hoffnungsutopie einer Humanität, die sich noch im freien Fall selbst bewahrt, hat auch Carl Amery ganz ähnlich beschrieben – er zitiert dabei Vergil: „Von den Bergen fallen die Schatten. Sie fallen auf Texte, denen von allen Buchstaben das Licht springt, das sie in die Finsternis zu bringen beauftragt sind.“
So schön dieses vorweggenommene Lichtbild einer buchstabenden Aufklärung auch ist, ein Wirklichkeitsutopist wie Amery kann es bei solchem Pathos natürlich nicht belassen, und so bestimmt er den engagierten Schriftsteller gleich noch etwas sachlicher; er schreibt: „Wenn es ihm um die Änderung der Verhältnisse zu tun ist, dann muss er die Vorurteile, nicht die Überzeugungen zu ändern suchen. Er muss nicht argumentieren, sondern er muss möglichst genau die unbewussten Regionen ausfindig machen, in denen die Vorurteile kauern.“
Mein Eindruck ist allerdings, dass Amery hier vielleicht seinerseits unbewusst und zugleich seiner Zeit mal wieder voraus einen Auftrag definiert, der ihm selbst weit weniger entsprach als, zwanzig Jahre später, zum Beispiel Thomas von Steinaecker. Denn zählte Amery noch zu jener Generation öffentlicher Intellektueller, die ganz selbstverständlich an die verändernde Kraft von Urteil, Argument und Überzeugung glaubte – und das machte ihn ja überhaupt erst zu jenem großen, geradlinigen Moralisten – so hat sich heute der literarische Zugriff auf die Wirklichkeit verändert, verändern müssen, um ihren neuen Verhältnissen noch zu entsprechen und nur so auch widersprechen zu können.
Thomas von Steinaeckers Bücher sind politisch, weil sie die Wirklichkeit eben NICHT abpausen, sondern eine eigene Sprachwelt für sie schaffen; weil sie die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht im herkömmlichen Sinne beschreiben und beurteilen, sondern sie ihrerseits zur Vorstellung bringen und sich ihnen dabei selbst ausliefern, um sie so gewissermaßen auf frischer Tat zu ertappen – und uns Leser mit ihnen. Denn alles wankt. Es gibt in diesen Texten keine vollends gesicherten Positionen mehr, und damit kommen sie der Gegenwart, wie viele von uns sie doch wahrnehmen, viel näher, als jede gestanzte Satzmoral es könnte.
Der Mensch geht unterm Strich nicht auf
Es geht also um Wahrnehmung, um Bewusstsein und seine Vermittlung. Natürlich, etliches von dem, was Amery noch mit unvergleichlichem Furor ausbuchstabierte, schimmert auch durch Thomas von Steinaeckers Zeilen: der marode Untergrund der Wohlstandsrepublik, Geschichts- und Fortschrittsideologien oder ein bis in die einzelnen Körper hineinwirkende Markthörigkeit – aber all das oszilliert hier eher, als dass es mit der Fackel der Aufklärung angesteckt würde, es beschreitet Umwege, wie nur die Literatur es kann, und dringt erst dadurch zu jenen „unbewussten Regionen“ vor, von denen Amery sprach, wo keine selbstgewissen Urteile gefällt werden, sondern die „Vorurteile kauern“, sich also unser Bewusstsein über die Realität überhaupt erst konstituiert.
Insofern würde ich sogar zögern, Thomas von Steinaecker überhaupt als einen realistischen Erzähler zu bezeichnen, gerade WEIL so viel an Realität und ihrer Diskurse in seinen Werken steckt. Aber das Reale erscheint hier eben oft nicht als etwas Wahres, sondern als eine künstliche, flimmernde Welt, die die unheilvollere Wirklichkeit dahinter verhüllt. Und hierbei stehen sich Carl Amery und Thomas von Steinaecker vielleicht am nächsten, im Erkennen einer Art Verrechnungslogik realer Scheinnotwendigkeiten, aus der der Mensch und sein natürlicher Lebensraum am Ende herausgekürzt werden – weil der Mensch unterm Strich nicht aufgeht.
So verliert sich etwa die Haupfigur Jürgen im Roman Geister, indem er in immer neue Rollen und Masken flieht, sich über verschiedene Medien so lange an Möglichkeiten seiner selbst probiert, bis er sich, wie es ja das Paradox unserer Multioptionsgeneration ist, um die Freiheit einer echten Wahl bringt. Um Verlust und Leid nicht wirklich erleben zu müssen, wird Jürgen zu seiner eigenen Fiktion. Auch er ist ein Scheiternder, der, wie viele Figuren bei Thomas von Steinaecker, Wunsch- und Wirklichkeitsbilder nicht mehr in ein identitätsstiftendes Verhältnis setzten kann – samt der narzisstischen Folgen, der Sucht nach ständiger öffentlicher Bestätigung des Privaten – und Menschen, die wie untote Gespenster im fahlen Licht der Bildschirme wandeln.
Wobei es sich der Erzähler hier wiederum nicht mit einem selbstgewissen Befund geschmeidig macht; vielmehr schafft er Phänomene, keine Tatbestände, und er tut dies ganz ohne die übliche kulturkritische Schnappatmung; ja mehr noch, er überträgt das zentrale Phänomen des Gewissheitsverlusts auch auf das eigene Medium, bis am Ende höchstfraglich ist, ob Jürgen je eine eigentliche Identität hatte – und ob so etwas wie authentisches Erzählen überhaupt möglich ist.
Der Kolonialroman Schutzgebiet stellt ebenfalls die Frage nach Erzählbarkeit – diesmal: von Zeitgeschehen. Er gibt gar nicht erst vor, ein epischer Historienroman zu sein, sondern lässt das geschichtlich Verbürgte oft sogar unwirklicher erscheinen als das offen Fiktionale. Denn was wir jeweils als Geschichte begreifen, ist durch Bilder und Vorstellungen immer schon vorgeprägt. Da haben wir sie wieder, die Vorurteile, von denen Amery sprach, den Untergrund unseres Bewusstseins.
Entsprechend purzeln in Schutzgebiet Fakten und Floskeln aufs Schönste durcheinander, Trash und Teutonia, Zitate aus Literatur und Film, Exkurse von Afrika bis New York und zurück in den Bayerischen Wald – alles überblendet sich hier zu einer experimentellen Collage über das Scheitern deutscher Großmannssucht, an deren Klangkomposition nicht nur Stockhausen seine Freude gehabt hätte, sondern an dem federleichten satirischen Kichern, das man beim Lesen immer meint, noch leise hindurchzuhören, auch Carl Amery, der in seinem Roman Die Wallfahrer eine ähnlich kühne historische Untergangsvision als Welttheater entworfen hat.
Dieses kichernde Kippen ins Fantastische, darin liegt auch immer: eine Verteidigung des Unwahrscheinlichen, eine Erprobung von Utopien, bei denen Vergeblichkeit und Hoffnung noch zwei Seiten derselben Medaille sein dürfen.
Wollen wir nur spielen?
Nun wird es langsam Zeit, einen Schlussbogen zu finden – und dabei habe ich über so vieles ja noch gar nicht gesprochen: über den großen Angestelltenroman Das Jahr, in dem ich aufhörte mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, über Thomas' Filme oder seine wissenschaftliche Arbeit zu Sebald, Brinkmann und Alexander Kluge und welche Spuren diese natürlich auch in seinem Werk hinterlassen hat; darüber, dass er im letzten Jahr seinen ersten eigenen Comic veröffentlichte, zusammen mit Barbara Yelin – und dass er öffentlich darüber nachgedacht hat, wie man als Literat Zeitgeschehen begegnen kann, das jeden Verstand an seine Grenzen führt, wie den Dschihad oder dass junge Mädchen aus unserer Gesellschaft über Nacht aufbrechen, um sich ihm anzuschließen.
Daraus ist das Experimentalprojekt Zwei Mädchen im Krieg entstanden, eine Art kollektiver Roman etlicher Autoren – und auch das ist eine nicht zu unterschätzende Eigenschaft von Thomas von Steinaecker: Sein Engagement reißt andere mit, gerade weil der Zweifel dabei noch seinen Platz haben darf; meistens braucht er dafür nicht mehr als ein paar Sätze, zum Beispiel solche: „Warum eigentlich diese Angst vor der gesellschaftspolitischen Macht von Kunst? Weil Aktualität schnell peinlich und anbiedernd wird? Ich halte den Elfenbeinturm der Kunst für unverzichtbar und überlebensnotwendig. Um jeden Preis muss Phantasie verteidigt werden. Aber ich will auf der anderen Seite auch nicht als Schriftsteller vor einer Wirklichkeit kapitulieren, in der wir letztlich alle ein herrlich saturiertes Leben führen und unsere in China unter dubiosen Umständen zusammengeschraubten Smartphones aus den Taschen unserer von unterbezahlten Minderjährigen genähten Hosen ziehen, um uns mit unseren besten Freunden in dem leckeren neuen Café, das ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt liegt von überfüllten Flüchtlingslagern, auf einen Bio-Latte zu verabreden. Da muss mehr gehen. Wir wollen doch nicht nur spielen, oder?"
Vor allem aber muss ich zum Schluss nochmal auf sein jüngstes Buch Die Verteidigung des Paradieses zurückkommen, für mich persönlich sein bisher bester Roman, und auf seinen jungen Helden Heinz, eine Figur, die sehr, sehr lange bleiben wird.
Der Mensch verliert sich. Er fällt aus seinem eigenen gesellschaftlichen Bezugs- und Zeichensystem. Jene Spielart des Scheiterns, die sich durch das ganze Werk von Thomas von Steinaecker zieht, verschärft sich in diesem Roman noch einmal, ruft zu einer Art Endspiel auf, denn plötzlich geht es, so sieht es zumindest lange aus, nicht nur um Einzelne, sondern um die ganze Menschheit – um die „Gattungsfrage“, wie Amery es nannte, und um die Frage, die er einmal gestellt hat und die er Thomas von Steinaecker beim Schreiben des Romans irgendwie eingeflüstert zu haben scheint: „Müssen wir Unmenschen werden, um die Menschheit zu retten?“
Vergeblichkeit und Hoffnung
Diese Frage erhält mit Heinz eine wundersam wörtliche Dimension – denn Heinz, der auf seiner Reise durch eine verwüstete Zukunftswelt sein junges Herz mit aller Kraft daran hängt, das Menschliche zu ergründen und zu bewahren, ist selbst ein Unmensch, buchstäblich, ist eine Art künstliches Wesen – und dennoch das menschlichste von allen, die noch übrig sind. Das ist natürlich kein Widerspruch, sondern das sogenannte Steinaeckerssche Paradoxon aus Vergeblichkeit und Hoffnung, das wir nun schon in einigen Varianten kennengelernt haben.
Und in dem er Carl Amery nahe ist, mit diesem Roman vielleicht näher denn je. Kein Zufall, dass auch Amery bayerische Science-Fiction-Romane geschrieben hat, Endzeit-Szenarien voller Schrecksignale unserer Gegenwart und Vergangenheit, und dass sich etliche verblüffende Verbindungslinien ziehen ließen – etwa von der Pilgerreise von Amerys Wallfahrern zu jener von Heinz und seinen Gefährten durch ein verseuchtes Deutschland und eine Jugend ohne Gott. Oder von Thomas von Steinaeckers beschriebener Poetik des Scheiterns zu Amerys Figur Dr. Irlböck, der in dem Zukunftsroman Das Geheimnis der Krypta gleich eine ganze Wissenschaft daraus macht, die Sphagistik gründet, eine Wissenschaft der Niederlagen, des Scheiterns und seiner verdrängten Möglichkeiten; eine Humanwissenschaft also im ursprünglichsten Sinne.
Vor allem aber wissen beide, dass sich im Genre der Dystopie „existenzielle Fragen mit einer größeren Dringlichkeit stellen lassen“ als in anderen; so hat es Thomas von Steinaecker einmal beschrieben: die lähmende Saturiertheit der westlichen Gesellschaften etwa bei gleichzeitiger Orientierungslosigkeit und aggressiver Verlustangst. Ganz abgesehen davon, dass apokalyptische Verheerungen genau in diesem Moment in anderen Ländern wie Syrien tägliche Realität sind.
Es ist also nicht wenig, was Heinz auf seinen schmalen Kinderschultern durch diesen Roman und durch die Zukunft Europas trägt und zu erhalten versucht: Mit ein paar Schicksalsgenossen hat er sich auf eine Berchtesgadener Alm retten können wie auf eine Arche, während die Zivilisation, so scheint es, untergegangen ist, dem zum Opfer gefallen ist, was Carl Amery das Endziel des Planet-Managements genannt hat. Eines Tages brechen sie auf, denn sie haben gehört, dass weiter im Westen angeblich ein Flüchtlingslager mit anderen Überlebenden existiert, und der junge Heinz notiert auf diesem abenteuerlichen Irrweg ins Paradies alles in seine kostbaren Schreibhefte, die er mitschleppt, um ihre Geschichte festzuhalten, die Geschichte der letzten Menschen.
Die Kultur als Erinnerungsort, das Gemachte als das eigentlich Humane – diese Allegorie könnte so leicht triefen, aber sie tut es nicht, weil sie hier nicht kitschig raunt, sondern inmitten der Düsternis spielerisch tänzelt, jongliert mit Fantasmen, mit Montagen von Cyberpunk bis Zombiestreifen und einer ihrerseits mutierenden Sprache, in die mal von links Adalbert Stifter hineinredet, mal von rechts Thomas Bernhard. Das Buch ist ein Klon, so wie Heinz ein Klon ist.
Und natürlich scheitert auch er. Für all jene, die den Roman noch lesen werden, möchte ich nicht zu viel verraten – nur, dass Heinz auf eine so seltsam schöne, schockierende und bewegende Weise scheitert, dass es einem auf den letzten Seiten des Buches das Herz umdreht; aber das ist ja nicht das Schlechteste. Man spürt dann endlich mal wieder, dass es noch schlägt.
Märchenhafte letzte Fragen
Auf mancherlei Weise ist Thomas von Steinaecker mit Heinz und seinem Märchen wieder zum Anfang seines Schreibens zurückgekehrt, zu der kaum zu bändigenden Buchstabengier der frühen Texte, der verzagten Euphorie des Tons, der rhythmischen, herzhüpfenden Formsprache und natürlich der Idee, bei der Gelegenheit doch am besten gleich mal eine ganze Menschheitsgeschichte zu erzählen, und alles andere eh.
Auch die Fragen, die Heinz bewegen, kehren zurück, zu den ersten und letzten Fragen – nach dem Schöpfer, nach einem Sinn, nach Würde, Trost und wer wir eigentlich sind. Und man kann gar nicht anders, als dabei wieder an den jungen Thomas zu denken, den die gleichen Fragen antreiben, während er nach der Schule durch die Hopfenstangen der Hollertau nach Hause radelt, Geschichten im Kopf, ein wahrer Satz pro Tag.
Wenn das aber so ist, dass sich mit diesem Buch ein Kreis geschlossen hat und nun ein neuer beginnen kann, dann soll Heinz auch das Schlusswort gebühren, zugleich der letzte Satz des Romans, der einmal, da halte ich jede Wette, eingehen wird in die Geschichte der besten Schlusssätze – und vor allem beschreibt dieser Satz viel treffender, als ich es jetzt könnte, das pochende Herz der Literatur Thomas von Steinaeckers, das Verschlungensein von Scheitern und Schaffen, Fallen und Fliegen, Vergeblichkeit und Hoffnung. Er lautet: „Es war einmal ein Mensch."
Über die Poetik des Scheiterns bei Thomas von Steinaecker
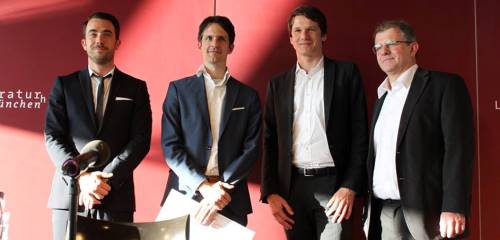
Der Carl-Amery-Preis, der alle zwei Jahre vom Verband deutscher Schriftsteller in Bayern verliehen wird, soll an den Münchner Schriftsteller Carl Amery (1922-2005) und sein Lebenswerk erinnern. 2017 erhält den Preis Thomas von Steinaecker, der mit Romanen wie Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen und Die Verteidigung des Paradieses auf, wie die Jury urteilt, „einzigartige Weise die Beobachtung von gesellschaftlicher Gegenwart und das Möglichkeitsdenken der Literatur verbindet“. Bei der Verleihung im Literaturhaus München hielt Fridolin Schley diese Laudatio.
*
Fallen und Fliegen
Auf ein paar wenigen Seiten einem Preisträger gerecht zu werden, der uns mit gerade einmal vierzig Jahren ein fast unverfroren umfangreiches und vielschichtiges Werk beschert hat, der im vergangenen Jahr seinen bereits fünften Roman veröffentlichte – und wie zumeist nicht gerade ein wortkarges Buch – der, wie mal eben nebenher, bald jährlich Dokumentarfilme dreht, Hörstücke schreibt, zum Wegbereiter des aktuellen Comic- und Graphic Novel-Aufschwungs avancierte, zum Medientheoretiker und promovierten Literaturwissenschaftler sowieso – einen solchen Ausnahmekünstler also angemessen zu ehren, das ist natürlich ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen.
Aber gerade das gilt es nicht etwa zu beklagen, sondern im Gegenteil fest zu umgreifen – und zu verstehen, dass der Position des Vergeblichen auch eine ungeheure Freiheit innewohnt; dass, wer nicht gewinnen kann, auch nicht mehr viel zu verlieren hat; dass daraus plötzlich ein Gefühl von Leichtigkeit erwächst – und dass wir genau hier bereits mitten drin sind in Thomas von Steinaeckers poetischer Conditio Humana: einem Ineinander von vermeintlichem Scheitern-müssen und gleichzeitig daraus keimender Hoffnung.
Um dieses scheinbare Paradox kreist für mich sein Werk, und um es zu verstehen, muss man gar nicht erst bei den Existenzialisten nachlesen, dass der Mensch sich erst im Angesicht des Scheiterns ganz vollendet, sondern man kann einfach die Romane von Thomas von Steinaecker lesen und überlegen, warum sie einen bei allem Intellekt auch derart berühren, einen berühren, obwohl sie doch oft so präzise entworfen sind, so kühn strukturiert, ja kühl im positiven Sinne einer impassibilité, wie Gustave Flaubert sie entwickelt hat, einer leidenschaftsbeherrschten Anschauung der Wirklichkeit, deren Partikel wie durch den Blick eines künstlichen Auges universelle Gültigkeit erhalten.
In der Schwebe
Wenn uns die Bücher Thomas von Steinaeckers dennoch berühren, dann weil sein unbestechlich analytischer Blick zwar die Verirrungen, die Zwänge und Härten unserer Gesellschaft seziert und bloßlegt, niemals aber seine Figuren dabei bloßstellt, die an ihr leiden müssen und oft genug an ihr scheitern, sei es im sozialen oder im moralischen Sinne, meistens in beidem. Der Erzähler unterwirft sie keinen klinischen Laborversuchen, befriedigt sich nicht an ihrem Scheitern, sondern bewahrt diesem, indem er es in eine ästhetische Form gießt, seine menschliche Kategorie, ja die Würde, die ein Mensch noch im freien Fall haben kann – so wie Günter Wallner, der gleich zu Beginn von Thomas' Debütroman Wallner beginnt zu fliegen in einem Unglückszug noch für eine Sekunde schwerelos schwebt, wie endlich erlöst, bevor er in einem schrecklichen Unfall zerschellt.
In jener Sekunde ist plötzlich alles möglich, alles Gesetzte aufgehoben und im Grunde nicht zu unterscheiden, ob Wallner nun fliegt oder fällt, wie bei dem tanzenden Taumeln einer letzten Flocke im Flutlicht, wie Thomas von Steinaecker es einmal in einer ganz frühen Erzählung beschrieben hat, und natürlich schafft das von allen Künsten nur die schreibende, dass sich diese eine Sekunde, dieser winzige Moment zu einem Raum öffnet, der so frei und weit ist, dass fünf Romane hineinpassen – und alle, die noch folgen werden.
Diese Romane berühren uns aber nicht nur, weil ihr Autor über die vielen Diskurse, die er einbindet, die menschlichen Sehnsüchte nicht vergisst, die sie überhaupt erst atmen lassen, ihnen Relevanz verleihen, sondern vor allem auch, weil er sich nicht über ihr Ringen mit dem Scheitern erhebt, weil wir spüren: er ist einer von ihnen, er ist selbst Teil der Versuchsanordnung, auch er ist in Versuchung geführt.
Das merkt man zum Beispiel daran, dass er es sich nie in seinem schon früh gerühmten Stil bequem gemacht hat, sondern sich an immer abenteuerlicheren Formen und Genres neu erprobt – denken Sie an die verspiegelten Zeitebenen von Wallner beginnt zu fliegen, bei dem unsere Gegenwart als zukünftige Vergangenheit erzählt wird, also eine Art Science-Fiction unter falschem Vorzeichen, oder an Schutzgebiet, der wiederum vordergründig ein historischer Roman ist, allerdings modern medialisiert, oder an Die Verteidigung des Paradieses, eine helle Coming-of-Age-Geschichte inmitten einer dunklen Dystopie.
Dass der Autor sich selbst den Risiken des Experiments aussetzt, merkt man aber auch stets am Tonfall seiner Sprache, an jenen unterschwelligen Herzrhythmusgeräuschen, die jeden Text zwischen den Zeilen heimlich beherrschen wie ein Nervensystem. Die Wahrheit eines Textes steckt ja in seinem Ton – und auch die Haltung seines Erzählers zur Welt.
In Thomas von Steinaeckers ersten beiden Romanen war das manchmal ein Ton von so klirrender Klarheit, dass man mitunter meinte, irgendwo in den Sätzen ein leises, hohes Knirschen zu hören, wie von einem zum Bersten angespannten Stück Glas, auf dem sich die ersten Risse ausbreiten, kurz bevor es zerspringt, oder von dem dünnen Eis, auf das er uns längst geführt hat, den Leser, die Figuren und sich selbst.
Während andere Schriftsteller ein ganzes Leben dafür brauchen, ihren Ton zu finden, und es meist doch nicht schaffen, hatte Thomas von Steinaecker von Anfang an die Chuzpe, ihn von Buch zu Buch ganz bewusst zu verändern; und wenn man dabei nun doch eine gewisse Linie ausmachen wollte, könnte man vielleicht sagen, dass er wärmer geworden ist – am deutlichsten sicherlich im jüngsten Roman Die Verteidigung des Paradieses, bei dem der Autor aber im Grunde nur noch einen Schritt weiter geht, das Risiko noch einmal verschärft: indem er nun sogar innerhalb eines Buches den Ton variiert, je nach der Entwicklung des jungen Heinz und seiner Schreibversuche, die inmitten einer untergehenden Welt mal übermütig und ungeschliffen ins Heft notiert werden, mit hohem Brustton oder Jugendjargon oder überschwänglichem Pathos.
Das Schreiben selbst befindet sich also mit ihm auf einer parallel verlaufenden Reise, hin zu einer authentischen Sprache. Hier wird keine Kindheit von außen erzählt, sondern ihr selbst das Wort erteilt – und dafür braucht es Mut: sich als Autor nicht auf die Virtuosität der eigenen Sprachakrobatik zu verlassen, sondern Sprache, Ton und Rhythmus als Teile, als Mitspieler der Fiktion zu begreifen und sie gewissermaßen frei zu lassen, so wie es uns einst die Strukturalisten gelehrt haben, die uneitelsten aller literarischen Denkschüler: das Werk ist alles.
Diese verwegene Selbstauslieferung an den Text birgt jedoch noch eine weitere Gefahr, die der Autor eigens heraufbeschwört, um sich ihr wieder und wieder zu stellen – nämlich die des eigenen Zweifels. Wer bei jedem Buch erneut alles aufs Spiel setzt, kann sich seiner selbst nie ganz gewiss sein – oder, um in unserem Bild zu bleiben: er springt von der Kante, ohne zu wissen, ob die eigenen Sätze ihn noch einmal tragen werden oder er schon im nächsten Moment zerschellt.
Die Folge ist eine tief empfundene, ihn oft quälende Skrupulösität, die ich so von kaum einem anderen derart renommierten Schriftsteller kenne. Das geht so weit, dass Thomas von Steinaecker etwa bei der Entstehung seines letzten Romans, als das Manuskript endlich durchgeschrieben war, plötzlich hunderte von Seiten einfach weggeworfen hat, um sie nochmal neu zu schreiben. Wer macht so etwas denn heute noch, da Bücher in 'Marktsegmente' und 'Zeitfenster' passen müssen – und wenn man ihn dann fragte, wie er nur so unbarmherzig gegenüber den eigenen Mühen, der jahrelangen Arbeit sein könne, hat er nur geantwortet: „Och, es hat dem Roman, der er sein konnte, halt einfach nicht mehr entsprochen."
Von der fiktionalen Ebene seiner Figuren, über die Gesellschaft, die sie gebärt, bis hin zur Fläche seines eigenen Schreibtischs – das Scheitern ist bei Thomas von Steinaecker also immer anwesend, beäugt ihn aus verschiedenen Ecken seines inneren Zimmers, halb bedrohlich, halb zutraulich. Vielleicht können wir es uns als rosa Kaninchen vorstellen oder als meinen Freund Harvey oder als ein kleines Nashorn von Ionesco oder als Affen Schimmi oder als in Mullbinden einbandagiertes Schmürz von Boris Vian – auf jeden Fall aber sollten wir es uns als eine Art Wächter vorstellen, wie Borges ihn beschrieben hat, als Cartaphilus, als Bücherfreund.
Denn der Zweifel ist nicht nur ein penetrantes Nagewesen, sondern auch eine jahrhundertealte, produktive Kraft, die es – anders als die Lüge – in diesen Zeiten leider schwer hat, sich zu behaupten, nicht nur in der Literatur, sondern gerade auch in der Gesellschaft, in der Politik. Wer erlaubt sich heute noch zu zweifeln?
Aber wenn das Scheitern und Zweifeln immer präsente Möglichkeiten sind und sein müssen, dann eben im doppelten Sinne, nicht nur als dräuendes Fehlschlagen, sondern auch als künstlerischer Antrieb, oder eher: als Auftrieb, ähnlich jenem, der Günter Wallner in besagtem Unglücks-ICE für einen kurzen, ewigen Moment anhebt und in der Luft hält, während um ihn herum, in dem Abteil und den vielen beschriebenen Seiten des Romans, die ihn einbetten, schon alles schwerelos zueinander findet, was Thomas von Steinaeckers Werk einmal schweben lassen wird, was sich darin auf oft beunruhigende, aber nur umso faszinierendere Weise verschlingt, gegenseitig verzehrt und im selben Augenblick schon wieder gebärt: das Fallen und das Fliegen, die Vergeblichkeit und die Hoffnung.
Bleibende Literatur kann, so glaube ich fest, nur dort entstehen, wo sich der Schreibende nicht auf der sicheren Seite weiß, sowohl ästhetisch als auch moralisch. Um sich dennoch über solch unsicheren Grund auf den Weg zu machen, benötigt man erneut ziemlich guten Mut, gewissermaßen den Zwillingsbruder des Zweifels, oder am besten gleich eine Portion Übermut, jene Mischung aus berstender Hemmung des Anfangs und einer Prise Größenwahn, wie sie in so tänzelnder Leichtigkeit vielleicht nur die Jugend kennt.
Man kann das an Thomas von Steinaeckers früher Jugendprosa sehr schön ablesen, diese Gier nach Buchstaben und ihrem launischen Verlauf, der den Weltgeist zum Sprachspiel verführt – es geht ja nur ums Leben.
Thomas ist damals 15, 16 Jahre alt, und endlos sind die Fahrradfahrten nach der Schule durch den Hopfenstangen-Dschungel der Hollertau, so hat er es später einmal beschrieben, immer größer die Geschichten, die sich dabei plötzlich in seinem Kopf auftun, ihn forttragen über die Grenzen des Pfaffenhofener Umlands, und seine Vorgabe lautet damals: einen Satz pro Tag schreiben – aber der soll dann auch bleiben dürfen, möglichst für die Ewigkeit, so wie jeder dieser kleinen ersten Texte am liebsten gleich die ganze Weltgeschichte erzählen wollte.
Mit den üblichen Pubertätsergüssen hat er sich da gar nicht erst aufgehalten. Bei ihm verlieben sich nicht etwa Mädchen und Jungen ineinander, sondern buchstäblich gleich ganze Erdplatten, die sich krachend vereinen in der Erzählung Sex oder Der erotische Faktor der Plattentektonik. In einer anderen mit dem ebenso überbordenen Titel Weltuntergangsüberschwemmungs-geschichte beschwört er mal eben die Apokalypse, halb als Oper, halb als Comicblase, nur um in der nächsten sogleich einen neuen Heiland auf die Erde zu schicken und seinerseits an ihr scheitern zu lassen.
Welten gehen unter und auf. Der Mensch erleuchtet kurz und fällt für immer, wie eine letzte Flocke im Flutlicht. Darunter hat es Thomas von Steinacker schon als Jugendlicher nicht gemacht.
Den Anfang seines Schreibens markiert neben dieser wilden inhaltlichen Angriffslust aber auch ein völlig ungewöhnlicher Wille zur Form. Die Sätze vermitteln nicht bloß etwas, sondern bersten selbst regelrecht vor verdichteter Sprachkraft, sie brechen sich Bahn, zischen und knistern, stoßen und drängen nach Rhythmus und Lautmalerei, Laute werden Wörter werden Bilder werden Fetzen werden Sätze werden wieder still.
Eine Selbstgeburt der Sprache bezeugt sich hier, und wir müssen uns dazu vielleicht die dissonanten Klangwelten eines Karl-Heinz Stockhausen vorstellen, das Blubbern und Gluckern und die versteckten Melodien, in denen sich Thomas schon als Teenager verlor, um dazu in der Fantasie ferne Welten zu entwerfen, ebenso wie zu den Büchern Kafkas oder Jules Vernes – und so den einsamen heißen Sommern des Landlebens zu entkommen und seinen wenigen tristen Höhepunkten wie den Gruppenstunden des Kolpingvereins.
Über Stockhausen hat er dann viele Jahre später den ersten seiner Dokumentarfilme gedreht, von denen sich auffallend viele mit Musik beschäftigen – was natürlich kein Zufall ist, aber in der Betrachtung seines literarischen Werkes meiner Meinung nach bisher viel zu kurz kam. Falls also jemand noch ein Thema für eine Dissertation sucht: Musikalische Sprachprinzipien – ich glaube, da würde man in Thomas von Steinaeckers Werk auf viel Interessantes stoßen.
Operationen am offenen Herzen
Als dann etliche Jahre später, übrigens ziemlich genau vor zehn Jahren, sein erster Roman erschien, Wallner beginnt zu fliegen, hatte er sich einerseits doch noch zu einem gewissermaßen normaleren Erzähler entwickelt – das Buch hat ja eine regelrechte Handlung und eine ziemlich ausgefeilte Dramaturgie – aber andererseits doch noch einiges von der experimentellen Waghalsigkeit seiner Anfänge hinübergerettet.
So ist überhaupt nur die ungeheure Wirkung zu erklären, die dieses Buch damals entfaltete. Florian Kessler hat das einmal sehr schön beschrieben: wie man damals, vor allem die Menschen unserer Lese- und Schreibgeneration, das Gefühl hatte, hier tritt jemand für uns ganz neue Wege aus, so als würde nicht nur Günter Wallner zu Beginn des Romans für eine Sekunde aus seinem Sitz gehoben und in der Luft stehen, sondern als würden mit ihm auch die geltenden Regeln des realistischen Erzählens ausgehebelt und die junge Literatur selbst schwebte dort und begänne loszufliegen zu dem, was sie alles sein konnte.
Da waren plötzlich Comic-Strips in den Roman eingeflochten, da bestanden ganze Kapitel manchmal nur aus ein oder zwei Wörtern, da waren Elemente von Collage und Montage – und da war nach Jahren der Popliteratur und der nachwehenden Postmoderne mit einem mal eine kompromisslose Ernsthaftigkeit zu spüren, die trotzdem verspielt sein konnte, ja sogar sein musste, wollte sie ihrem Gegenstand gerecht werden, und der war natürlich mal wieder das große Ganze, das große Spiel namens Gesellschaft, wie Bourdieu es genannt hat.
Dass man die postmodernen Verspiegelungen literarisch nutzen kann, ohne dabei nur originell um eine leere Mitte zu kreisen; dass man mit kühlem Besteck die pulsierenden Wunden unserer durchmedialisierten und -ökonomisierten Gegenwart offenlegen kann, ohne es sich dabei in der Ironie der Ironie der Ironie bequem zu machen oder sich zynisch daran zu ergötzen – und überhaupt: dass aufklärender Realismus und virtuose Künstlichkeit sich eben nicht ausschließen müssen … bei alldem hatte Thomas von Steinaecker damals ein wichtiges Vorbild in David Foster Wallace und einen großen Bruder im Geiste, ohne dessen Roman Infinite Jest, wie Thomas später einmal notierte, heute für ihn wohl nichts so wäre, wie es ist.
Mit Foster Wallace verbindet ihn vor allem aber noch eines: die Bereitschaft, Ambivalenzen auszuhalten, den Leser zu irritieren, eine Literatur der Destabilisierung, nicht aber der Dekonstruktion. Oder, um es einfacher zu sagen: Beide beschreiben das vielschichtige Scheitern unserer Zeit, aber wie in jeder Verlustanzeige ist das Eigentliche dabei das Vermisste, und das ist hier: das Humane, das aller Vergeblichkeit innewohnt. Oder noch einfacher: Thomas von Steinaecker seziert manchmal brutal das kranke Innere der Gesellschaft – aber solange am offenen Herzen operiert wird, schlägt es zumindest noch.
In Wallner beginnt zu fliegen schlägt es leise den Takt für eine verborgene Sehnsucht aller Figuren nach einem anderen, wahrhaftigeren Leben, so endgültig verloren sie auch erscheinen in einer Welt, in der es keine Erfahrung mehr gibt außer der medial vermittelten und damit auch keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern nur noch eine öde Gegenwart aus hohlen Sprechformen und geschichtsblinder Retromanie. Der Vater Stefan Wallner begeht so lange Selbstbetrug am Familiengedächtnis, bis die Privatmythen ins Reich der Paranoia driften, und sein Sohn Costin macht eine Scheinkarriere als Reality-Star, bis er irgendwann ein Gefühl nicht mehr von dessen Inszenierung unterscheiden kann.
Es ist eine Familiensaga der Unaufrichtigkeit, eine Zeitgeschichte über die Konstruktion von Geschichten und die vielen kleinen Lügen, die sie formen. Aber bei diesem eisigen Befund belässt es der Erzähler eben nicht, auch in ihm schlägt, etwas verlegen vielleicht noch, das Herz eines Romantikers, eines Märchenerzählers, und so setzt sich die Enkelin Wendy am Ende hin und beginnt die Geschichte ihrer Familie aufzuschreiben, jenes Buch, das wir in Händen halten. Auch sie wird dabei natürlich scheitern, wird die Wahrheit nicht finden, sondern ihrerseits eher löschen und überschreiben, aber sie hinterlässt dabei doch eine menschliche Spur – und das ist nicht wenig. Es ist die schmale „Leuchtspur durchs dunkle All“, wie es an anderer Stelle bei Thomas von Steinaecker einmal heißt. Nur die Sprache kann noch dem Verstummen, dem Nichts ein Zeichen setzten. „Die Sterne werden die Sterne sein“, lesen wir da, „die Sonne wird die Sonne sein.“ Aber nichts wird nicht sein.
Diese Hoffnungsutopie einer Humanität, die sich noch im freien Fall selbst bewahrt, hat auch Carl Amery ganz ähnlich beschrieben – er zitiert dabei Vergil: „Von den Bergen fallen die Schatten. Sie fallen auf Texte, denen von allen Buchstaben das Licht springt, das sie in die Finsternis zu bringen beauftragt sind.“
So schön dieses vorweggenommene Lichtbild einer buchstabenden Aufklärung auch ist, ein Wirklichkeitsutopist wie Amery kann es bei solchem Pathos natürlich nicht belassen, und so bestimmt er den engagierten Schriftsteller gleich noch etwas sachlicher; er schreibt: „Wenn es ihm um die Änderung der Verhältnisse zu tun ist, dann muss er die Vorurteile, nicht die Überzeugungen zu ändern suchen. Er muss nicht argumentieren, sondern er muss möglichst genau die unbewussten Regionen ausfindig machen, in denen die Vorurteile kauern.“
Mein Eindruck ist allerdings, dass Amery hier vielleicht seinerseits unbewusst und zugleich seiner Zeit mal wieder voraus einen Auftrag definiert, der ihm selbst weit weniger entsprach als, zwanzig Jahre später, zum Beispiel Thomas von Steinaecker. Denn zählte Amery noch zu jener Generation öffentlicher Intellektueller, die ganz selbstverständlich an die verändernde Kraft von Urteil, Argument und Überzeugung glaubte – und das machte ihn ja überhaupt erst zu jenem großen, geradlinigen Moralisten – so hat sich heute der literarische Zugriff auf die Wirklichkeit verändert, verändern müssen, um ihren neuen Verhältnissen noch zu entsprechen und nur so auch widersprechen zu können.
Thomas von Steinaeckers Bücher sind politisch, weil sie die Wirklichkeit eben NICHT abpausen, sondern eine eigene Sprachwelt für sie schaffen; weil sie die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht im herkömmlichen Sinne beschreiben und beurteilen, sondern sie ihrerseits zur Vorstellung bringen und sich ihnen dabei selbst ausliefern, um sie so gewissermaßen auf frischer Tat zu ertappen – und uns Leser mit ihnen. Denn alles wankt. Es gibt in diesen Texten keine vollends gesicherten Positionen mehr, und damit kommen sie der Gegenwart, wie viele von uns sie doch wahrnehmen, viel näher, als jede gestanzte Satzmoral es könnte.
Der Mensch geht unterm Strich nicht auf
Es geht also um Wahrnehmung, um Bewusstsein und seine Vermittlung. Natürlich, etliches von dem, was Amery noch mit unvergleichlichem Furor ausbuchstabierte, schimmert auch durch Thomas von Steinaeckers Zeilen: der marode Untergrund der Wohlstandsrepublik, Geschichts- und Fortschrittsideologien oder ein bis in die einzelnen Körper hineinwirkende Markthörigkeit – aber all das oszilliert hier eher, als dass es mit der Fackel der Aufklärung angesteckt würde, es beschreitet Umwege, wie nur die Literatur es kann, und dringt erst dadurch zu jenen „unbewussten Regionen“ vor, von denen Amery sprach, wo keine selbstgewissen Urteile gefällt werden, sondern die „Vorurteile kauern“, sich also unser Bewusstsein über die Realität überhaupt erst konstituiert.
Insofern würde ich sogar zögern, Thomas von Steinaecker überhaupt als einen realistischen Erzähler zu bezeichnen, gerade WEIL so viel an Realität und ihrer Diskurse in seinen Werken steckt. Aber das Reale erscheint hier eben oft nicht als etwas Wahres, sondern als eine künstliche, flimmernde Welt, die die unheilvollere Wirklichkeit dahinter verhüllt. Und hierbei stehen sich Carl Amery und Thomas von Steinaecker vielleicht am nächsten, im Erkennen einer Art Verrechnungslogik realer Scheinnotwendigkeiten, aus der der Mensch und sein natürlicher Lebensraum am Ende herausgekürzt werden – weil der Mensch unterm Strich nicht aufgeht.
So verliert sich etwa die Haupfigur Jürgen im Roman Geister, indem er in immer neue Rollen und Masken flieht, sich über verschiedene Medien so lange an Möglichkeiten seiner selbst probiert, bis er sich, wie es ja das Paradox unserer Multioptionsgeneration ist, um die Freiheit einer echten Wahl bringt. Um Verlust und Leid nicht wirklich erleben zu müssen, wird Jürgen zu seiner eigenen Fiktion. Auch er ist ein Scheiternder, der, wie viele Figuren bei Thomas von Steinaecker, Wunsch- und Wirklichkeitsbilder nicht mehr in ein identitätsstiftendes Verhältnis setzten kann – samt der narzisstischen Folgen, der Sucht nach ständiger öffentlicher Bestätigung des Privaten – und Menschen, die wie untote Gespenster im fahlen Licht der Bildschirme wandeln.
Wobei es sich der Erzähler hier wiederum nicht mit einem selbstgewissen Befund geschmeidig macht; vielmehr schafft er Phänomene, keine Tatbestände, und er tut dies ganz ohne die übliche kulturkritische Schnappatmung; ja mehr noch, er überträgt das zentrale Phänomen des Gewissheitsverlusts auch auf das eigene Medium, bis am Ende höchstfraglich ist, ob Jürgen je eine eigentliche Identität hatte – und ob so etwas wie authentisches Erzählen überhaupt möglich ist.
Der Kolonialroman Schutzgebiet stellt ebenfalls die Frage nach Erzählbarkeit – diesmal: von Zeitgeschehen. Er gibt gar nicht erst vor, ein epischer Historienroman zu sein, sondern lässt das geschichtlich Verbürgte oft sogar unwirklicher erscheinen als das offen Fiktionale. Denn was wir jeweils als Geschichte begreifen, ist durch Bilder und Vorstellungen immer schon vorgeprägt. Da haben wir sie wieder, die Vorurteile, von denen Amery sprach, den Untergrund unseres Bewusstseins.
Entsprechend purzeln in Schutzgebiet Fakten und Floskeln aufs Schönste durcheinander, Trash und Teutonia, Zitate aus Literatur und Film, Exkurse von Afrika bis New York und zurück in den Bayerischen Wald – alles überblendet sich hier zu einer experimentellen Collage über das Scheitern deutscher Großmannssucht, an deren Klangkomposition nicht nur Stockhausen seine Freude gehabt hätte, sondern an dem federleichten satirischen Kichern, das man beim Lesen immer meint, noch leise hindurchzuhören, auch Carl Amery, der in seinem Roman Die Wallfahrer eine ähnlich kühne historische Untergangsvision als Welttheater entworfen hat.
Dieses kichernde Kippen ins Fantastische, darin liegt auch immer: eine Verteidigung des Unwahrscheinlichen, eine Erprobung von Utopien, bei denen Vergeblichkeit und Hoffnung noch zwei Seiten derselben Medaille sein dürfen.
Wollen wir nur spielen?
Nun wird es langsam Zeit, einen Schlussbogen zu finden – und dabei habe ich über so vieles ja noch gar nicht gesprochen: über den großen Angestelltenroman Das Jahr, in dem ich aufhörte mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, über Thomas' Filme oder seine wissenschaftliche Arbeit zu Sebald, Brinkmann und Alexander Kluge und welche Spuren diese natürlich auch in seinem Werk hinterlassen hat; darüber, dass er im letzten Jahr seinen ersten eigenen Comic veröffentlichte, zusammen mit Barbara Yelin – und dass er öffentlich darüber nachgedacht hat, wie man als Literat Zeitgeschehen begegnen kann, das jeden Verstand an seine Grenzen führt, wie den Dschihad oder dass junge Mädchen aus unserer Gesellschaft über Nacht aufbrechen, um sich ihm anzuschließen.
Daraus ist das Experimentalprojekt Zwei Mädchen im Krieg entstanden, eine Art kollektiver Roman etlicher Autoren – und auch das ist eine nicht zu unterschätzende Eigenschaft von Thomas von Steinaecker: Sein Engagement reißt andere mit, gerade weil der Zweifel dabei noch seinen Platz haben darf; meistens braucht er dafür nicht mehr als ein paar Sätze, zum Beispiel solche: „Warum eigentlich diese Angst vor der gesellschaftspolitischen Macht von Kunst? Weil Aktualität schnell peinlich und anbiedernd wird? Ich halte den Elfenbeinturm der Kunst für unverzichtbar und überlebensnotwendig. Um jeden Preis muss Phantasie verteidigt werden. Aber ich will auf der anderen Seite auch nicht als Schriftsteller vor einer Wirklichkeit kapitulieren, in der wir letztlich alle ein herrlich saturiertes Leben führen und unsere in China unter dubiosen Umständen zusammengeschraubten Smartphones aus den Taschen unserer von unterbezahlten Minderjährigen genähten Hosen ziehen, um uns mit unseren besten Freunden in dem leckeren neuen Café, das ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt liegt von überfüllten Flüchtlingslagern, auf einen Bio-Latte zu verabreden. Da muss mehr gehen. Wir wollen doch nicht nur spielen, oder?"
Vor allem aber muss ich zum Schluss nochmal auf sein jüngstes Buch Die Verteidigung des Paradieses zurückkommen, für mich persönlich sein bisher bester Roman, und auf seinen jungen Helden Heinz, eine Figur, die sehr, sehr lange bleiben wird.
Der Mensch verliert sich. Er fällt aus seinem eigenen gesellschaftlichen Bezugs- und Zeichensystem. Jene Spielart des Scheiterns, die sich durch das ganze Werk von Thomas von Steinaecker zieht, verschärft sich in diesem Roman noch einmal, ruft zu einer Art Endspiel auf, denn plötzlich geht es, so sieht es zumindest lange aus, nicht nur um Einzelne, sondern um die ganze Menschheit – um die „Gattungsfrage“, wie Amery es nannte, und um die Frage, die er einmal gestellt hat und die er Thomas von Steinaecker beim Schreiben des Romans irgendwie eingeflüstert zu haben scheint: „Müssen wir Unmenschen werden, um die Menschheit zu retten?“
Vergeblichkeit und Hoffnung
Diese Frage erhält mit Heinz eine wundersam wörtliche Dimension – denn Heinz, der auf seiner Reise durch eine verwüstete Zukunftswelt sein junges Herz mit aller Kraft daran hängt, das Menschliche zu ergründen und zu bewahren, ist selbst ein Unmensch, buchstäblich, ist eine Art künstliches Wesen – und dennoch das menschlichste von allen, die noch übrig sind. Das ist natürlich kein Widerspruch, sondern das sogenannte Steinaeckerssche Paradoxon aus Vergeblichkeit und Hoffnung, das wir nun schon in einigen Varianten kennengelernt haben.
Und in dem er Carl Amery nahe ist, mit diesem Roman vielleicht näher denn je. Kein Zufall, dass auch Amery bayerische Science-Fiction-Romane geschrieben hat, Endzeit-Szenarien voller Schrecksignale unserer Gegenwart und Vergangenheit, und dass sich etliche verblüffende Verbindungslinien ziehen ließen – etwa von der Pilgerreise von Amerys Wallfahrern zu jener von Heinz und seinen Gefährten durch ein verseuchtes Deutschland und eine Jugend ohne Gott. Oder von Thomas von Steinaeckers beschriebener Poetik des Scheiterns zu Amerys Figur Dr. Irlböck, der in dem Zukunftsroman Das Geheimnis der Krypta gleich eine ganze Wissenschaft daraus macht, die Sphagistik gründet, eine Wissenschaft der Niederlagen, des Scheiterns und seiner verdrängten Möglichkeiten; eine Humanwissenschaft also im ursprünglichsten Sinne.
Vor allem aber wissen beide, dass sich im Genre der Dystopie „existenzielle Fragen mit einer größeren Dringlichkeit stellen lassen“ als in anderen; so hat es Thomas von Steinaecker einmal beschrieben: die lähmende Saturiertheit der westlichen Gesellschaften etwa bei gleichzeitiger Orientierungslosigkeit und aggressiver Verlustangst. Ganz abgesehen davon, dass apokalyptische Verheerungen genau in diesem Moment in anderen Ländern wie Syrien tägliche Realität sind.
Es ist also nicht wenig, was Heinz auf seinen schmalen Kinderschultern durch diesen Roman und durch die Zukunft Europas trägt und zu erhalten versucht: Mit ein paar Schicksalsgenossen hat er sich auf eine Berchtesgadener Alm retten können wie auf eine Arche, während die Zivilisation, so scheint es, untergegangen ist, dem zum Opfer gefallen ist, was Carl Amery das Endziel des Planet-Managements genannt hat. Eines Tages brechen sie auf, denn sie haben gehört, dass weiter im Westen angeblich ein Flüchtlingslager mit anderen Überlebenden existiert, und der junge Heinz notiert auf diesem abenteuerlichen Irrweg ins Paradies alles in seine kostbaren Schreibhefte, die er mitschleppt, um ihre Geschichte festzuhalten, die Geschichte der letzten Menschen.
Die Kultur als Erinnerungsort, das Gemachte als das eigentlich Humane – diese Allegorie könnte so leicht triefen, aber sie tut es nicht, weil sie hier nicht kitschig raunt, sondern inmitten der Düsternis spielerisch tänzelt, jongliert mit Fantasmen, mit Montagen von Cyberpunk bis Zombiestreifen und einer ihrerseits mutierenden Sprache, in die mal von links Adalbert Stifter hineinredet, mal von rechts Thomas Bernhard. Das Buch ist ein Klon, so wie Heinz ein Klon ist.
Und natürlich scheitert auch er. Für all jene, die den Roman noch lesen werden, möchte ich nicht zu viel verraten – nur, dass Heinz auf eine so seltsam schöne, schockierende und bewegende Weise scheitert, dass es einem auf den letzten Seiten des Buches das Herz umdreht; aber das ist ja nicht das Schlechteste. Man spürt dann endlich mal wieder, dass es noch schlägt.
Märchenhafte letzte Fragen
Auf mancherlei Weise ist Thomas von Steinaecker mit Heinz und seinem Märchen wieder zum Anfang seines Schreibens zurückgekehrt, zu der kaum zu bändigenden Buchstabengier der frühen Texte, der verzagten Euphorie des Tons, der rhythmischen, herzhüpfenden Formsprache und natürlich der Idee, bei der Gelegenheit doch am besten gleich mal eine ganze Menschheitsgeschichte zu erzählen, und alles andere eh.
Auch die Fragen, die Heinz bewegen, kehren zurück, zu den ersten und letzten Fragen – nach dem Schöpfer, nach einem Sinn, nach Würde, Trost und wer wir eigentlich sind. Und man kann gar nicht anders, als dabei wieder an den jungen Thomas zu denken, den die gleichen Fragen antreiben, während er nach der Schule durch die Hopfenstangen der Hollertau nach Hause radelt, Geschichten im Kopf, ein wahrer Satz pro Tag.
Wenn das aber so ist, dass sich mit diesem Buch ein Kreis geschlossen hat und nun ein neuer beginnen kann, dann soll Heinz auch das Schlusswort gebühren, zugleich der letzte Satz des Romans, der einmal, da halte ich jede Wette, eingehen wird in die Geschichte der besten Schlusssätze – und vor allem beschreibt dieser Satz viel treffender, als ich es jetzt könnte, das pochende Herz der Literatur Thomas von Steinaeckers, das Verschlungensein von Scheitern und Schaffen, Fallen und Fliegen, Vergeblichkeit und Hoffnung. Er lautet: „Es war einmal ein Mensch."
