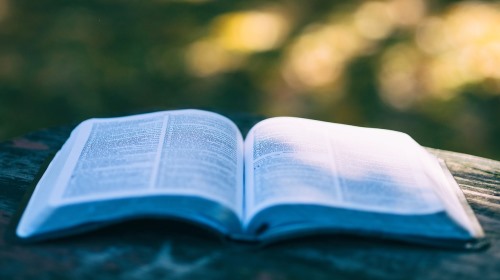Ein Gespräch mit dem Chamisso-Preisträger Akos Doma, Teil I
Wann haben Sie Ungarn verlassen und vor allem warum?
AKOS DOMA: Ich wurde sozusagen mitgeschleift. Das war 1971, ich war acht Jahre alt. Meine Eltern waren keine Kommunisten und hatten es deshalb schwerer als andere, wobei ich das nicht an die große Glocke hängen möchte. Wir waren keine politischen Flüchtlinge, sondern hatten ein dutzend Gründe. Das Leben war einfach nicht mehr auszuhalten in Ungarn, wir lebten jahrelang zu viert auf ein paar Quadratmetern. Viele gingen, weil sie dachten, sie würden reich im Westen. Das war bei uns nicht der Fall, es war einfach blanke Notwendigkeit. Wir sind sehr schweren Herzens gegangen.
Geflohen sind wir über Jugoslawien, denn dorthin konnte man noch legal, in den „Bruderstaat“, und dann sind wir illegal über die Grenze nach Italien. Das erste Durchgangslager in Triest war erträglich, da waren wir einen Monat. Danach kamen wir nach Capua, bei Neapel, dort herrschten katastrophale Zustände. Manche Leute haben dort ihr ganzes Leben verbracht, weil kein Land sie aufgenommen hat.
Wie erlebt man diese katastrophalen Zustände als Achtjähriger?
AD: Das Komische ist: Wir Kinder haben es als Abenteuer begriffen. Ich kann mich nur an zwei, drei negative Momente während der ganzen Flucht erinnern. Für meine Eltern war es ein Alptraum, mein Vater hat danach nie wieder einen Fuß auf italienischen Boden gesetzt. Aber für uns Kinder war es spannend: ein halbes Jahr Ferien, es war warm, ich erinnere mich an Orangenhaine. Das ist eben die Kinderperspektive. Wahrscheinlich wurden wir einfach gut abgeschirmt, vielleicht habe ich es auch verdrängt, aber ich kann mich wirklich an nichts Schlimmes erinnern.
Und dann ging es nach England?
AD: Ja, dort lebten wir sechs Jahre. Mein Vater war schon vorher einmal mit einem Stipendium in England gewesen, und hat dann dort eine Arbeit gefunden. Mein Vater ist Biologe, in meiner Familie sind alle Biologen, ich bin sehr weit vom Stamm gefallen. Allerdings haben sich meine Eltern in England nicht wirklich zuhause gefühlt. Die ungarische und die englische Mentalität sind einander wirklich diametral entgegen gesetzt. Die karge englische Zurückhaltung: Das widerspricht dem Ungarischen.
Und dann Deutschland?
AD: Nach Amberg, weil meine Mutter eine Stelle als Lehrerin bekam, da es in der Nähe ein ungarisches Gymnasium gibt. Aber auch an diesen Umzug habe ich keine negativen Erinnerungen. Ich konnte zwar kaum Deutsch, wie ich England kaum Englisch konnte, aber das ging schnell. Man wird ins Wasser geschmissen, und dann schwimmt man eben, da gibt es nichts zu überlegen.
Wie ist man Ihnen auf der Schule begegnet?
AD: Ich war ein Freak. Das war Oberpfalz! Ich war Halb-Ungar, Halb-Engländer. Heute ist jede Schule multikulturell, aber damals, Mitte der 1970er Jahre, war ich schon als Engländer merkwürdig, und dann noch englischer Ungar! In der ganzen Klasse waren nur Bayern, ich glaube, an der ganzen Schule waren nur Bayern. Es war sehr bayerisch, ich musste das Deutsche also über das Bairische lernen, das war nicht so einfach.
Was war in dieser Zeit mir Ihrer Verbindung zu Ungarn? Gab es eine Sehnsucht nach einer Heimat, fehlt einem da etwas?
AD: Eine Weile durften wir ja nicht nach Ungarn, weil wir – wie sagt man? – „Republikflüchtlinge“ waren, und das erste Mal – 1979, meine ich – war spannend, weil wir nicht wussten, ob das klappt oder ob wir womöglich einbehalten werden. Wir waren ja noch ungarische Staatsbürger! Es gab aber keine Probleme. Und dann waren wir jedes Jahr in Ungarn auf Besuch, das ist ganz klar Heimat.
Als Schriftsteller sehe ich mich allerdings als Deutscher. Für einen Autor ist entscheidend, in welcher Sprache er schreibt. Als Schriftsteller bin ich Deutscher, als Mensch bin ich Ungar, da kann ich auch gar nichts daran ändern. Meine Eltern sind Ungarn, ich bin dort geboren, wir haben ein Leben lang Ungarisch zuhause gesprochen, da ist man beheimatet.
Hatte der Mauerfall dann eine besondere Bedeutung für Sie?
AD: Für mich persönlich hatte das keinerlei Auswirkungen, aber historisch war das großartig. Das war eine kurze Zeit, in der sich eine einzigartige Entspannung breit machte. Ich war in Prag zu der Zeit, und das war – als die Sowjetunion verschwunden war und die USA noch nicht Einzug gehalten hatte – ein kurzer Moment der Anarchie, der Machtfreiheit, nicht im Negativen. Endlich war der Überbau weg, dieser Zwang, sich irgendwie benehmen zu müssen. Allerdings war diese kurze Phase, nach der sich die Menschen gesehnt hatten, schnell vorbei mit dem NATO-Beitritt und ähnlichem. Das Ende des kalten Kriegs hat sich leider noch nicht in allen Köpfen und Medien durchgesetzt, noch heute hält man fest an Ressentiments, das finde ich schade. Die Aufteilung in Demokratie hier, Diktatur dort ist zu simpel. Auch jede Demokratie hat ihren doppelten Boden.
Dann muss Ihnen die aktuelle Kritik an Ungarn ja sauer aufstoßen.
AD: Ich lese keine Zeitungen, habe keinen Fernseher und verfolge die Diskussion deshalb nicht sehr aufmerksam. Ich brauche meine Zeit zum Schreiben, denn ich bin ein sehr langsamer Schreiber. Ich weiß nicht, wie Martin Walser das macht: jedes Jahr einen Roman vorzulegen, das ist beeindruckend! Das würde ich gerne an mir ändern: dieses langsame und zähe Schreiben.
Information über den Autor
Akos Doma wurde 1963 in Budapest geboren, er wuchs in Ungarn, Italien und England auf und kam mit 14 Jahren nach Deutschland. Er promovierte über Knut Hamsun und D.H. Lawrence. 2001 erschien sein Debütroman „Der Müßiggänger“, 2010 folgte „Die allgemeine Tauglichkeit“. Akos Doma ist Schriftsteller und vielfach ausgezeichneter Übersetzer, u.a. von László Földényi, Péter Nádas und Sándor Márai. Akos Doma lebt mit seiner Familie in Eichstätt.
Sein bei Rotbuch erschienener Roman „Die allgemeine Tauglichkeit“ handelt von Igor, Amir, Ferdinand und Ludovik, vier gestrandeten Lebenskünstlern, die arbeitslos in einer Bruchbude am Stadtrand hausen. Sie schlagen sich mit Diebstählen und Einbrüchen durch und treiben mit ihren Mitmenschen ihr Spiel. Wenn der Winter durch die Ritzen ihres Hauses zieht, rücken sie enger zusammen und träumen von der schönen Sibylle und dem „wahren“ Leben. Eines Tages steht es vor der Tür – in Gestalt des charismatischen Erfolgstypen Albert. Er will aus den vier Totalverweigerern „ordentliche Leute“ machen, sie zurück in die Mitte der Gesellschaft holen. Den Plan dazu hat er auch: Aus dem Haus am Bahndamm soll eine Pension werden. Nach einem rauschhaft durchgearbeiteten Sommer scheint sich für Ferdinand und seine Freunde tatsächlich die Tür in ein anderes Leben zu öffnen. Doch ein letzter Ausreißversuch der vier endet verhängnisvoll.
Ein Gespräch mit dem Chamisso-Preisträger Akos Doma, Teil I
Wann haben Sie Ungarn verlassen und vor allem warum?
AKOS DOMA: Ich wurde sozusagen mitgeschleift. Das war 1971, ich war acht Jahre alt. Meine Eltern waren keine Kommunisten und hatten es deshalb schwerer als andere, wobei ich das nicht an die große Glocke hängen möchte. Wir waren keine politischen Flüchtlinge, sondern hatten ein dutzend Gründe. Das Leben war einfach nicht mehr auszuhalten in Ungarn, wir lebten jahrelang zu viert auf ein paar Quadratmetern. Viele gingen, weil sie dachten, sie würden reich im Westen. Das war bei uns nicht der Fall, es war einfach blanke Notwendigkeit. Wir sind sehr schweren Herzens gegangen.
Geflohen sind wir über Jugoslawien, denn dorthin konnte man noch legal, in den „Bruderstaat“, und dann sind wir illegal über die Grenze nach Italien. Das erste Durchgangslager in Triest war erträglich, da waren wir einen Monat. Danach kamen wir nach Capua, bei Neapel, dort herrschten katastrophale Zustände. Manche Leute haben dort ihr ganzes Leben verbracht, weil kein Land sie aufgenommen hat.
Wie erlebt man diese katastrophalen Zustände als Achtjähriger?
AD: Das Komische ist: Wir Kinder haben es als Abenteuer begriffen. Ich kann mich nur an zwei, drei negative Momente während der ganzen Flucht erinnern. Für meine Eltern war es ein Alptraum, mein Vater hat danach nie wieder einen Fuß auf italienischen Boden gesetzt. Aber für uns Kinder war es spannend: ein halbes Jahr Ferien, es war warm, ich erinnere mich an Orangenhaine. Das ist eben die Kinderperspektive. Wahrscheinlich wurden wir einfach gut abgeschirmt, vielleicht habe ich es auch verdrängt, aber ich kann mich wirklich an nichts Schlimmes erinnern.
Und dann ging es nach England?
AD: Ja, dort lebten wir sechs Jahre. Mein Vater war schon vorher einmal mit einem Stipendium in England gewesen, und hat dann dort eine Arbeit gefunden. Mein Vater ist Biologe, in meiner Familie sind alle Biologen, ich bin sehr weit vom Stamm gefallen. Allerdings haben sich meine Eltern in England nicht wirklich zuhause gefühlt. Die ungarische und die englische Mentalität sind einander wirklich diametral entgegen gesetzt. Die karge englische Zurückhaltung: Das widerspricht dem Ungarischen.
Und dann Deutschland?
AD: Nach Amberg, weil meine Mutter eine Stelle als Lehrerin bekam, da es in der Nähe ein ungarisches Gymnasium gibt. Aber auch an diesen Umzug habe ich keine negativen Erinnerungen. Ich konnte zwar kaum Deutsch, wie ich England kaum Englisch konnte, aber das ging schnell. Man wird ins Wasser geschmissen, und dann schwimmt man eben, da gibt es nichts zu überlegen.
Wie ist man Ihnen auf der Schule begegnet?
AD: Ich war ein Freak. Das war Oberpfalz! Ich war Halb-Ungar, Halb-Engländer. Heute ist jede Schule multikulturell, aber damals, Mitte der 1970er Jahre, war ich schon als Engländer merkwürdig, und dann noch englischer Ungar! In der ganzen Klasse waren nur Bayern, ich glaube, an der ganzen Schule waren nur Bayern. Es war sehr bayerisch, ich musste das Deutsche also über das Bairische lernen, das war nicht so einfach.
Was war in dieser Zeit mir Ihrer Verbindung zu Ungarn? Gab es eine Sehnsucht nach einer Heimat, fehlt einem da etwas?
AD: Eine Weile durften wir ja nicht nach Ungarn, weil wir – wie sagt man? – „Republikflüchtlinge“ waren, und das erste Mal – 1979, meine ich – war spannend, weil wir nicht wussten, ob das klappt oder ob wir womöglich einbehalten werden. Wir waren ja noch ungarische Staatsbürger! Es gab aber keine Probleme. Und dann waren wir jedes Jahr in Ungarn auf Besuch, das ist ganz klar Heimat.
Als Schriftsteller sehe ich mich allerdings als Deutscher. Für einen Autor ist entscheidend, in welcher Sprache er schreibt. Als Schriftsteller bin ich Deutscher, als Mensch bin ich Ungar, da kann ich auch gar nichts daran ändern. Meine Eltern sind Ungarn, ich bin dort geboren, wir haben ein Leben lang Ungarisch zuhause gesprochen, da ist man beheimatet.
Hatte der Mauerfall dann eine besondere Bedeutung für Sie?
AD: Für mich persönlich hatte das keinerlei Auswirkungen, aber historisch war das großartig. Das war eine kurze Zeit, in der sich eine einzigartige Entspannung breit machte. Ich war in Prag zu der Zeit, und das war – als die Sowjetunion verschwunden war und die USA noch nicht Einzug gehalten hatte – ein kurzer Moment der Anarchie, der Machtfreiheit, nicht im Negativen. Endlich war der Überbau weg, dieser Zwang, sich irgendwie benehmen zu müssen. Allerdings war diese kurze Phase, nach der sich die Menschen gesehnt hatten, schnell vorbei mit dem NATO-Beitritt und ähnlichem. Das Ende des kalten Kriegs hat sich leider noch nicht in allen Köpfen und Medien durchgesetzt, noch heute hält man fest an Ressentiments, das finde ich schade. Die Aufteilung in Demokratie hier, Diktatur dort ist zu simpel. Auch jede Demokratie hat ihren doppelten Boden.
Dann muss Ihnen die aktuelle Kritik an Ungarn ja sauer aufstoßen.
AD: Ich lese keine Zeitungen, habe keinen Fernseher und verfolge die Diskussion deshalb nicht sehr aufmerksam. Ich brauche meine Zeit zum Schreiben, denn ich bin ein sehr langsamer Schreiber. Ich weiß nicht, wie Martin Walser das macht: jedes Jahr einen Roman vorzulegen, das ist beeindruckend! Das würde ich gerne an mir ändern: dieses langsame und zähe Schreiben.
Information über den Autor
Akos Doma wurde 1963 in Budapest geboren, er wuchs in Ungarn, Italien und England auf und kam mit 14 Jahren nach Deutschland. Er promovierte über Knut Hamsun und D.H. Lawrence. 2001 erschien sein Debütroman „Der Müßiggänger“, 2010 folgte „Die allgemeine Tauglichkeit“. Akos Doma ist Schriftsteller und vielfach ausgezeichneter Übersetzer, u.a. von László Földényi, Péter Nádas und Sándor Márai. Akos Doma lebt mit seiner Familie in Eichstätt.
Sein bei Rotbuch erschienener Roman „Die allgemeine Tauglichkeit“ handelt von Igor, Amir, Ferdinand und Ludovik, vier gestrandeten Lebenskünstlern, die arbeitslos in einer Bruchbude am Stadtrand hausen. Sie schlagen sich mit Diebstählen und Einbrüchen durch und treiben mit ihren Mitmenschen ihr Spiel. Wenn der Winter durch die Ritzen ihres Hauses zieht, rücken sie enger zusammen und träumen von der schönen Sibylle und dem „wahren“ Leben. Eines Tages steht es vor der Tür – in Gestalt des charismatischen Erfolgstypen Albert. Er will aus den vier Totalverweigerern „ordentliche Leute“ machen, sie zurück in die Mitte der Gesellschaft holen. Den Plan dazu hat er auch: Aus dem Haus am Bahndamm soll eine Pension werden. Nach einem rauschhaft durchgearbeiteten Sommer scheint sich für Ferdinand und seine Freunde tatsächlich die Tür in ein anderes Leben zu öffnen. Doch ein letzter Ausreißversuch der vier endet verhängnisvoll.