Logen-Blog [469]: Vom Herzpolypen und von gewissenlosen Stoßvögeln
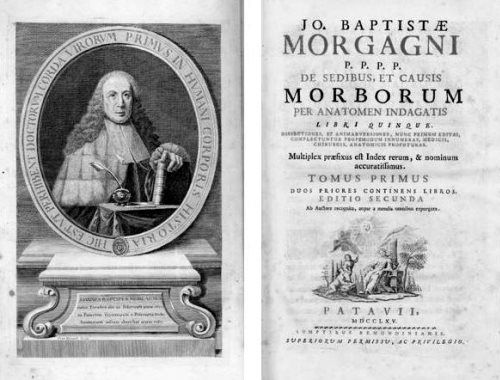
Jean Paul erweist sich, wieder einmal, als Psychosomatiker avant la lettre. Das Weinen Gustavs – ja, nun weint er ausdrücklich, nachdem er seinen Schicksals- und Abschiedsbrief versiegelt hat – provoziert ihn, den Erzähler, zu einem Sermon über den innigen Zusammenhang von biographischem und autobiographischem Leid: im Schreiben über das Unglück enthüllt sich dem empfindsamen Skribenten die Unmöglichkeit, gesund zu bleiben. Der Passus ist durchaus interessant, weil er – obwohl hier literarische Vorbilder (Sterne) mitspuken mögen – wieder auf das broken-heart-Syndrom verweist, dem nicht allein Gustav, auch sein Autor (der in doppeltem Sinne sein Erfinder ist: als Biograph und als Dichter) ausgesetzt sein könnte. Dies alles wird unter dem äußerst anschaulichen Sternzeichen eines Herzpolypen verhandelt:
Ich bin nun überzeugt, dass ich nicht am Schlage (wie ich mir neulich unter meinem gefrornen Kopfzeug einbildete) noch an der Lungensucht (welches eine wahre Grille war) sterben kann; aber bürgt mir dieses dafür, dass ich nicht an einem Herzpolypen scheitern werde, wofür alle menschliche Wahrscheinlichkeit ist? – Zum Glück bin ich nicht so hartnäckig wie Musäus in Weimar, der das Dasein des seinigen, den er so gut wie ich den meinigen mit kaltem Kaffee groß geätzet, nicht eher glaubte, als bis der Polype sein schönes Herz verstopft und ihm alle Wiegenfeste und alle Wünsche für die seiner Gattin genommen hatte. Ich sage, ich merke besser auf Vorboten von Herzpolypen: ich verberge mir es nicht, was hinter dem aussetzenden Pulse steckt, nämlich eben ein wirklicher Herzpolype, der Zündpfropf des Todes.
Nun geht die Kritik am seelisch bedingten Polypen aber nicht allein nach innen, auch nach außen: zu den Vertretern einer ebenso mörderischen Literaturkritik, die fatale literarische Feme, dem Rezensenten-Bund, die mit Stricken um uns gutwillige Narren herumschleicht. Gut: es ist kein Problem für den Dichter, gleich Schmetterlingen an der Umarmung der Musen zu sterben – aber für gewissenlose Stoßvögel auch nur eine Zeile zu schreiben: dieser Tod sei sinnlos.
Zum Dritten verbindet Jean Paul seine Literaturkritiker-Kritik mit einem Bild, das wiederum Bilder in die Mitte nimmt: denn der Dichter muss nun in seiner Biographie Szenen aufstellen, die den Prospektmaler beinahe umbringen, weil die Biographie „scho arg“ ist, wie der Franke sagen würde. Gewählter ausgedrückt: weil sie auf ihn genauso so wirkt wie vergiftete Briefe. Nur sind es nun die eigenen Briefe, die er zu schreiben hat, und die er, wie das berühmte Manuskript in Umberto Ecos Il nome della rosa, selbst mit dem tödlichen Stoff versehen muss. Umblättern tötet, auch Schreiben tötet in diesem Fall, der den Herzpolypen auslöst. Nicht nur Heines Lieder sind vergiftet[1] – auch die literarischen Malereien des Erzählers, aus dessen biographischem Lustschloss sein Mausoleum werden wird, in dem er oft Zimmer und Wände übermalt, die mir Puls und Atem dergestalt benehmen, dass man mich einmal tot neben meiner Malerei liegen finden muss?
Und wer ist an diesem schrecklichen Zustand schuld? Nicht er, nicht der biographische Gegenstand – sondern die verdammten Kunstrichter. Nein, logisch ist das nicht, die Übertragung der negativen Affekte auf die Literaturkritiker – die Literaturkritiker im Allgemeinen – mutet wild an, der Sprung von der fremden Qual auf die eigene, die wiederum den Stoß auf die Stoßvögel auslöst, ist nicht wirklich erklärbar.
Es sei denn, man wüsste, dass Autor und Erzähler von einem ungeheuren Subjektivismus bewegt werden, der Sprünge dieser Art geradezu provoziert.
[1] Vergiftet sind meine Lieder; –
Wie könnte es anders sein?
Du hast mir ja Gift gegossen
Ins blühende Leben hinein.
Vergiftet sind meine Lieder; –
Wie könnte es anders sein?
Ich trage im Herzen viel Schlangen,
Und dich, Geliebte mein.
Logen-Blog [469]: Vom Herzpolypen und von gewissenlosen Stoßvögeln
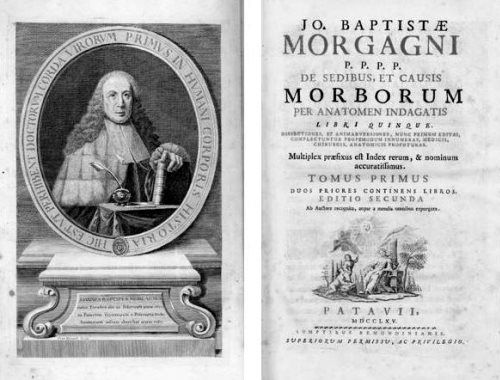
Jean Paul erweist sich, wieder einmal, als Psychosomatiker avant la lettre. Das Weinen Gustavs – ja, nun weint er ausdrücklich, nachdem er seinen Schicksals- und Abschiedsbrief versiegelt hat – provoziert ihn, den Erzähler, zu einem Sermon über den innigen Zusammenhang von biographischem und autobiographischem Leid: im Schreiben über das Unglück enthüllt sich dem empfindsamen Skribenten die Unmöglichkeit, gesund zu bleiben. Der Passus ist durchaus interessant, weil er – obwohl hier literarische Vorbilder (Sterne) mitspuken mögen – wieder auf das broken-heart-Syndrom verweist, dem nicht allein Gustav, auch sein Autor (der in doppeltem Sinne sein Erfinder ist: als Biograph und als Dichter) ausgesetzt sein könnte. Dies alles wird unter dem äußerst anschaulichen Sternzeichen eines Herzpolypen verhandelt:
Ich bin nun überzeugt, dass ich nicht am Schlage (wie ich mir neulich unter meinem gefrornen Kopfzeug einbildete) noch an der Lungensucht (welches eine wahre Grille war) sterben kann; aber bürgt mir dieses dafür, dass ich nicht an einem Herzpolypen scheitern werde, wofür alle menschliche Wahrscheinlichkeit ist? – Zum Glück bin ich nicht so hartnäckig wie Musäus in Weimar, der das Dasein des seinigen, den er so gut wie ich den meinigen mit kaltem Kaffee groß geätzet, nicht eher glaubte, als bis der Polype sein schönes Herz verstopft und ihm alle Wiegenfeste und alle Wünsche für die seiner Gattin genommen hatte. Ich sage, ich merke besser auf Vorboten von Herzpolypen: ich verberge mir es nicht, was hinter dem aussetzenden Pulse steckt, nämlich eben ein wirklicher Herzpolype, der Zündpfropf des Todes.
Nun geht die Kritik am seelisch bedingten Polypen aber nicht allein nach innen, auch nach außen: zu den Vertretern einer ebenso mörderischen Literaturkritik, die fatale literarische Feme, dem Rezensenten-Bund, die mit Stricken um uns gutwillige Narren herumschleicht. Gut: es ist kein Problem für den Dichter, gleich Schmetterlingen an der Umarmung der Musen zu sterben – aber für gewissenlose Stoßvögel auch nur eine Zeile zu schreiben: dieser Tod sei sinnlos.
Zum Dritten verbindet Jean Paul seine Literaturkritiker-Kritik mit einem Bild, das wiederum Bilder in die Mitte nimmt: denn der Dichter muss nun in seiner Biographie Szenen aufstellen, die den Prospektmaler beinahe umbringen, weil die Biographie „scho arg“ ist, wie der Franke sagen würde. Gewählter ausgedrückt: weil sie auf ihn genauso so wirkt wie vergiftete Briefe. Nur sind es nun die eigenen Briefe, die er zu schreiben hat, und die er, wie das berühmte Manuskript in Umberto Ecos Il nome della rosa, selbst mit dem tödlichen Stoff versehen muss. Umblättern tötet, auch Schreiben tötet in diesem Fall, der den Herzpolypen auslöst. Nicht nur Heines Lieder sind vergiftet[1] – auch die literarischen Malereien des Erzählers, aus dessen biographischem Lustschloss sein Mausoleum werden wird, in dem er oft Zimmer und Wände übermalt, die mir Puls und Atem dergestalt benehmen, dass man mich einmal tot neben meiner Malerei liegen finden muss?
Und wer ist an diesem schrecklichen Zustand schuld? Nicht er, nicht der biographische Gegenstand – sondern die verdammten Kunstrichter. Nein, logisch ist das nicht, die Übertragung der negativen Affekte auf die Literaturkritiker – die Literaturkritiker im Allgemeinen – mutet wild an, der Sprung von der fremden Qual auf die eigene, die wiederum den Stoß auf die Stoßvögel auslöst, ist nicht wirklich erklärbar.
Es sei denn, man wüsste, dass Autor und Erzähler von einem ungeheuren Subjektivismus bewegt werden, der Sprünge dieser Art geradezu provoziert.
[1] Vergiftet sind meine Lieder; –
Wie könnte es anders sein?
Du hast mir ja Gift gegossen
Ins blühende Leben hinein.
Vergiftet sind meine Lieder; –
Wie könnte es anders sein?
Ich trage im Herzen viel Schlangen,
Und dich, Geliebte mein.

