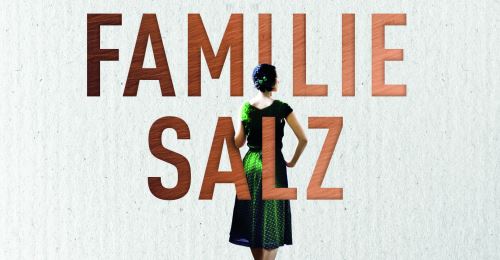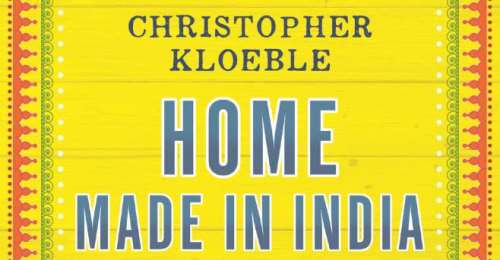Von Generation zu Generation. Ein Interview mit dem Münchner Autor Christopher Kloeble
Der gebürtige Münchner Christopher Kloeble veröffentlichte 2008 seinen ersten Roman Unter Einzelgängern, 2012 folgte Meistens alles sehr schnell, 2016 Die Unsterbliche Familie Salz. Für August 2017 steht die Veröffentlichung seines ersten Sachbuchs Home Made In India an, in dem Kloeble, der abwechselnd in Berlin und Neu Delhi lebt, kulturelle Unterschiede beschreibt. Kloeble erhielt 2007 das Stipendium des Bayerischen Rundfunks, 2008 den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung und 2011 das Stipendium des Deutschen Literaturfonds e.V.
Im Rahmen einer Lesung im Atelier Caveau stellte er ![]() Die Unsterbliche Familie Salz (dtv, 2016) vor. Wie auch in seinen früheren Werken steht hier eine verwobene, komplizierte Familiengeschichte im Zentrum des Romans, der in München und Leipzig spielt. Im Laufe des Romans kommen mehrere Generationen der Familie zu Wort, die auf verschiedenste Weise durch die vorhergehenden Generationen und die deutsche Geschichte ab 1914 geprägt worden sind. Das Leipziger Hotel Fürstenhof, das zum schicksalhaften Ort der Familie Salz wird, befand sich zeitweise tatsächlich im Besitz der Familie Kloeble.
Die Unsterbliche Familie Salz (dtv, 2016) vor. Wie auch in seinen früheren Werken steht hier eine verwobene, komplizierte Familiengeschichte im Zentrum des Romans, der in München und Leipzig spielt. Im Laufe des Romans kommen mehrere Generationen der Familie zu Wort, die auf verschiedenste Weise durch die vorhergehenden Generationen und die deutsche Geschichte ab 1914 geprägt worden sind. Das Leipziger Hotel Fürstenhof, das zum schicksalhaften Ort der Familie Salz wird, befand sich zeitweise tatsächlich im Besitz der Familie Kloeble.
Das Literaturportal Bayern hat mit Christopher Kloeble über Die Unsterbliche Familie Salz, seine eigene Familiengeschichte und sein Leben zwischen Neu Delhi und Berlin gesprochen.
LITERATURPORTAL BAYERN: Das Genre des „Generationenromans“ erfreut sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Worin sehen Sie die Gründe für diese Faszination und Begeisterung?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Was ich persönlich reizvoll finde an dem Konzept ist, dass man versucht einen Kontext zu bilden, um zu schauen, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind. Wenn man ein paar Generationen zurückgeht, wie ich es auch in meinem Buch tue, dann sieht man, dass eine Sache, die 1914 passiert ist, auch über 100 Jahre danach noch Konsequenzen hat, selbst wenn die Leute 100 Jahre später vielleicht gar nicht mehr wissen, warum das eigentlich so ist oder woher das kommt. Sie werden auf alle Fälle noch durch diese Ereignisse beeinflusst. Und ich denke, das ist an Generationenromanen sehr schön, dass man sieht, dass sich die Vergangenheit Welle um Welle in die Zukunft fortsetzt. Aber das funktioniert fast so ein bisschen wie bei der Flüsterpost. Die Botschaft wird zwar immer weitergegeben, aber sie wird immer mehr verfremdet und umgestaltet, und am Schluss kommt etwas ganz anderes dabei heraus und man weiß gar nicht mehr, was es einmal war. Man versucht einfach zu verstehen, wo man im ganzen Kontext der neueren Geschichte ist. Das finde ich sehr reizvoll.
LITERATURPORTAL BAYERN: Elemente des Romans weisen Parallelen zu Ihrer eigenen Familiengeschichte auf. Welche Folgen hatte diese Entscheidung für die Entstehung des Romans?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Das war tatsächlich eine besondere Herausforderung, denn die Gefahr ist groß, dass man sich selbstverliebt mit eigenen Sachen beschäftigt. Deswegen ist es gerade bei so einer Geschichte immer wieder wichtig, dass man versucht die Distanz zurückzugewinnen und zu sehen, was ist eine erzählenswerte Geschichte und was ist nur für mich persönlich interessant, aber nicht relevant für eine Leserschaft. Insofern gilt dann immer das Abwägen und Distanzsuchen.
LITERATURPORTAL BAYERN: In Ihrem Roman stellen Sie das Schicksal der Familie Salz vor. Als Erzählerstimmen wählen Sie die Frauen der Familie aus. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen, und welche Auswirkung hat diese Entscheidung für den Roman?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Es war nicht von Anfang an so, dass ich mir gedacht habe, dass ich das garantiert so machen werde. Aber beim Schreiben fiel mir dann auf, dass es mich mehr interessiert hat, was die Frauen der Geschichte zu sagen hatten. Die Männer sind auch alle nicht so dominant in dieser Familie. Die Frauen haben viel mehr das Sagen. Es geht auch gar nicht darum, dass die Frauen immer die Opfer wären. Sie werden zum Teil zwar zu Opfern, aber sie sind genauso auch selbst Täter. Ich fand es sehr reizvoll, die Frauen in all ihren Facetten zu zeigen. Und gerade wenn man ein Kapitel über den Zweiten Weltkrieg schreibt, haben wir doch schon genug gelesen über Soldaten und so weiter. Ich wollte daher mehr die Frauenperspektive einnehmen, um eine andere Sichtweise zu zeigen.
LITERATURPORTAL BAYERN: Welche Rolle spielen die Schauplätze für den Roman? Inwiefern hat auch Ihre persönliche Geschichte die Wahl der Schauplätze beeinflusst?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Die Schauplätze haben zum Teil einen großen Einfluss auf die Geschichte. Gerade Leipzig steht im Zentrum der Handlung. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich Leipzig wahnsinnig gut anbietet, wenn man etwas aus der deutschen Geschichte erzählen möchte. Im deutschen Kontext ist Leipzig sehr interessant, da hier sehr viele Veränderungen stattfinden – noch mehr als in anderen Teilen Deutschlands. Man hat auch das ganze DDR-Kapitel, das mit hineinfällt. Und natürlich weiß ich auch relativ viel über den Fürstenhof, kenne seine Geschichte und habe zu ihm eine direkte Verbindung. Leipzig war gezwungenermaßen dazu bestimmt, der Schauplatz der Geschichte zu sein, denn ich habe auch in Leipzig studiert. Es gab also immer wieder Verknüpfungen. Ich wusste, dass sich Leipzig anbieten würde, denn warum sollte ich über einen Ort schreiben, den ich nicht gut kenne?
LITERATURPORTAL BAYERN: Ihr Roman deckt einen Zeitraum von über 100 Jahren ab. Was war hierbei die größte Herausforderung?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, desto schwieriger wird es, interessante Informationen zu finden. Gerade wenn man sich in historische Gefilde begibt, ist die Gefahr groß, dass man sich denkt, „das google ich jetzt mal schnell“. Aber alles Wissen, das man googeln kann, ist gar nicht das interessante Wissen, das später ein Buch spannend macht, denn das kann ja jeder einfach nachschlagen. Deswegen sind es gerade die Informationen, die man nicht googeln kann, die ein Buch lesenswert machen, finde ich. Und dabei habe ich dann gemerkt, dass es schwieriger wird, je weiter man in die Vergangenheit geht. Nehmen wir einmal 1914. Da kann man nicht einfach sich mit Leuten unterhalten und sagen, „erzähl‘ mir mal ein bisschen was“. Je weiter man sich dann der Gegenwart angenähert hat, desto einfacher ist es in der Hinsicht geworden, weil ich zum Teil selber mehr wusste oder auch mehr Personen kannte, die dazu mehr Bezug hatten. Andererseits wächst natürlich die Gefahr, dass man Dinge erzählt, die sowieso schon alle kennen. Insofern hatte beides so seine Tücken.
(c) dtv Verlag
LITERATURPORTAL BAYERN: Wie hat sich die Art und Weise, Gefühle zu artikulieren oder zu verarbeiten, Ihrer Meinung nach verändert?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Alle äußern natürlich ihre Gefühle auf ihre eigene Art, weil fast alle Teile des Romans in verschieden Stimmen verfasst sind. Und diese Stimmen erzählen schon fast in einer Beichtform, im Sinne von „ich erzähle jetzt mal wie es wirklich war“ oder „ich möchte, dass dieses wichtige Wissen weitergegeben wird“. Das ist natürlich unterschiedlich aufgeladen und gerade die in der Vergangenheit liegende Teile waren in der Hinsicht etwas schwieriger, weil ich merkte, dass ich mich als Autor mehr damit auseinandersetzen musste, wie jemand in einer bestimmten Zeit gesprochen, wie offen jemand vor hundert Jahren bestimmte Dinge angesprochen hätte. Zum Teil beginnt man da schon zu zweifeln, wie die konkrete Wortwahl wäre. Aber es gibt sicherlich die Tendenz dazu, dass man heutzutage Sachen wesentlich offener und direkter ansprechen kann. Wichtiger ist es dann, den einzelnen Personen verschiedene Stimmen zu geben und diese auch zu kontrastieren, damit man als Leser nicht das Gefühl hat, dass die Geschichte, die 1914 spielt, genauso klingt wie diejenige, die 2015 spielt.
LITERATURPORTAL BAYERN: Das Leitmotiv der Schatten spielt eine zentrale Rolle. Worin besteht deren Faszination? Inwiefern spielt die Dichotomie Schatten-Licht in der Familiengeschichte eine Rolle?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Ja, das wüsste ich auch gerne [lächelt]. Es gibt ganz klar eine besondere Faszination. Mich sprechen immer wieder Leute an, nachdem sie das Buch gelesen haben und meinen: „Der Schatten steht ja für ...“. Ich sage dann immer, dass das stimmt, aber vielleicht nicht nur dafür. Der Schatten hat im Buch ja ganz verschiedene Ausprägungen. Im Anfangskapitel geht es erst einmal nur um Schattenrisse. Später gibt es aber auch eine Person, die sehr viel Angst hat vor Männern, die keinen Schatten haben, weil sie Angst hat, dass ein wesentlicher Teil ihrer Seele fehlt. In einem späteren Kapitel gibt es jemanden, der seinen eigenen Schatten nicht sehen und sich das nicht erklären kann. So gibt es im Laufe des Romans immer wieder verschiedene Ausprägungen. Ich fand es dann sehr reizvoll, den Schatten in verschiedenen Facetten zu zeigen. Natürlich steht der Schatten für etwas, aber ich überlasse es dem Leser herauszufinden, was er selber in dem Schatten sieht, weil es verschiedene Arten gibt, den Schatten zu deuten.
LITERATURPORTAL BAYERN: Sie leben abwechselnd in Berlin und Neu-Delhi. Was fasziniert Sie so an Indien, und wie kommen Sie mit der unterschiedlichen Kultur in einem anderen Land zurecht?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Es gibt natürlich Unterschiede, und das ist sicher auch manchmal eine Herausforderung. Es ist aber nicht so, dass es bloß schwieriger wäre, in Indien zu leben. Es fällt mir immer wieder auf, dass per se die Umstellung immer etwas schwierig ist. Das Leben in Indien bietet genauso viele Vorteile wie Nachteile, die ein bisschen anders gelagert sind als hier. Aber es geht mir wahnsinnig oft so, dass ich zurück nach Berlin komme und merke, dass wir immer denken, dass bei uns alles „normal“, aber im Rest der Welt dafür alles komisch, schwierig und exotisch ist. Aber wir sind auch ziemlich komisch, schwierig und exotisch. Das unterschätzen wir vermutlich ein bisschen oder nehmen das gar nicht so wahr, weil wir es nicht anders kennen. Ich könnte stundenlang über die Unterschiede zwischen Indien und Deutschland sprechen. Deswegen habe ich ja auch ein Buch darüber geschrieben, dass im Laufe des Jahres erscheinen wird. Es ist überraschenderweise so, dass ich gemerkt habe, dass Deutschland viel exotischer ist, als man das gemeinhin annehmen würde.
Verfasserin/Interview: Judith Bauer
Von Generation zu Generation. Ein Interview mit dem Münchner Autor Christopher Kloeble
Der gebürtige Münchner Christopher Kloeble veröffentlichte 2008 seinen ersten Roman Unter Einzelgängern, 2012 folgte Meistens alles sehr schnell, 2016 Die Unsterbliche Familie Salz. Für August 2017 steht die Veröffentlichung seines ersten Sachbuchs Home Made In India an, in dem Kloeble, der abwechselnd in Berlin und Neu Delhi lebt, kulturelle Unterschiede beschreibt. Kloeble erhielt 2007 das Stipendium des Bayerischen Rundfunks, 2008 den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung und 2011 das Stipendium des Deutschen Literaturfonds e.V.
Im Rahmen einer Lesung im Atelier Caveau stellte er ![]() Die Unsterbliche Familie Salz (dtv, 2016) vor. Wie auch in seinen früheren Werken steht hier eine verwobene, komplizierte Familiengeschichte im Zentrum des Romans, der in München und Leipzig spielt. Im Laufe des Romans kommen mehrere Generationen der Familie zu Wort, die auf verschiedenste Weise durch die vorhergehenden Generationen und die deutsche Geschichte ab 1914 geprägt worden sind. Das Leipziger Hotel Fürstenhof, das zum schicksalhaften Ort der Familie Salz wird, befand sich zeitweise tatsächlich im Besitz der Familie Kloeble.
Die Unsterbliche Familie Salz (dtv, 2016) vor. Wie auch in seinen früheren Werken steht hier eine verwobene, komplizierte Familiengeschichte im Zentrum des Romans, der in München und Leipzig spielt. Im Laufe des Romans kommen mehrere Generationen der Familie zu Wort, die auf verschiedenste Weise durch die vorhergehenden Generationen und die deutsche Geschichte ab 1914 geprägt worden sind. Das Leipziger Hotel Fürstenhof, das zum schicksalhaften Ort der Familie Salz wird, befand sich zeitweise tatsächlich im Besitz der Familie Kloeble.
Das Literaturportal Bayern hat mit Christopher Kloeble über Die Unsterbliche Familie Salz, seine eigene Familiengeschichte und sein Leben zwischen Neu Delhi und Berlin gesprochen.
LITERATURPORTAL BAYERN: Das Genre des „Generationenromans“ erfreut sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Worin sehen Sie die Gründe für diese Faszination und Begeisterung?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Was ich persönlich reizvoll finde an dem Konzept ist, dass man versucht einen Kontext zu bilden, um zu schauen, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind. Wenn man ein paar Generationen zurückgeht, wie ich es auch in meinem Buch tue, dann sieht man, dass eine Sache, die 1914 passiert ist, auch über 100 Jahre danach noch Konsequenzen hat, selbst wenn die Leute 100 Jahre später vielleicht gar nicht mehr wissen, warum das eigentlich so ist oder woher das kommt. Sie werden auf alle Fälle noch durch diese Ereignisse beeinflusst. Und ich denke, das ist an Generationenromanen sehr schön, dass man sieht, dass sich die Vergangenheit Welle um Welle in die Zukunft fortsetzt. Aber das funktioniert fast so ein bisschen wie bei der Flüsterpost. Die Botschaft wird zwar immer weitergegeben, aber sie wird immer mehr verfremdet und umgestaltet, und am Schluss kommt etwas ganz anderes dabei heraus und man weiß gar nicht mehr, was es einmal war. Man versucht einfach zu verstehen, wo man im ganzen Kontext der neueren Geschichte ist. Das finde ich sehr reizvoll.
LITERATURPORTAL BAYERN: Elemente des Romans weisen Parallelen zu Ihrer eigenen Familiengeschichte auf. Welche Folgen hatte diese Entscheidung für die Entstehung des Romans?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Das war tatsächlich eine besondere Herausforderung, denn die Gefahr ist groß, dass man sich selbstverliebt mit eigenen Sachen beschäftigt. Deswegen ist es gerade bei so einer Geschichte immer wieder wichtig, dass man versucht die Distanz zurückzugewinnen und zu sehen, was ist eine erzählenswerte Geschichte und was ist nur für mich persönlich interessant, aber nicht relevant für eine Leserschaft. Insofern gilt dann immer das Abwägen und Distanzsuchen.
LITERATURPORTAL BAYERN: In Ihrem Roman stellen Sie das Schicksal der Familie Salz vor. Als Erzählerstimmen wählen Sie die Frauen der Familie aus. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen, und welche Auswirkung hat diese Entscheidung für den Roman?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Es war nicht von Anfang an so, dass ich mir gedacht habe, dass ich das garantiert so machen werde. Aber beim Schreiben fiel mir dann auf, dass es mich mehr interessiert hat, was die Frauen der Geschichte zu sagen hatten. Die Männer sind auch alle nicht so dominant in dieser Familie. Die Frauen haben viel mehr das Sagen. Es geht auch gar nicht darum, dass die Frauen immer die Opfer wären. Sie werden zum Teil zwar zu Opfern, aber sie sind genauso auch selbst Täter. Ich fand es sehr reizvoll, die Frauen in all ihren Facetten zu zeigen. Und gerade wenn man ein Kapitel über den Zweiten Weltkrieg schreibt, haben wir doch schon genug gelesen über Soldaten und so weiter. Ich wollte daher mehr die Frauenperspektive einnehmen, um eine andere Sichtweise zu zeigen.
LITERATURPORTAL BAYERN: Welche Rolle spielen die Schauplätze für den Roman? Inwiefern hat auch Ihre persönliche Geschichte die Wahl der Schauplätze beeinflusst?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Die Schauplätze haben zum Teil einen großen Einfluss auf die Geschichte. Gerade Leipzig steht im Zentrum der Handlung. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich Leipzig wahnsinnig gut anbietet, wenn man etwas aus der deutschen Geschichte erzählen möchte. Im deutschen Kontext ist Leipzig sehr interessant, da hier sehr viele Veränderungen stattfinden – noch mehr als in anderen Teilen Deutschlands. Man hat auch das ganze DDR-Kapitel, das mit hineinfällt. Und natürlich weiß ich auch relativ viel über den Fürstenhof, kenne seine Geschichte und habe zu ihm eine direkte Verbindung. Leipzig war gezwungenermaßen dazu bestimmt, der Schauplatz der Geschichte zu sein, denn ich habe auch in Leipzig studiert. Es gab also immer wieder Verknüpfungen. Ich wusste, dass sich Leipzig anbieten würde, denn warum sollte ich über einen Ort schreiben, den ich nicht gut kenne?
LITERATURPORTAL BAYERN: Ihr Roman deckt einen Zeitraum von über 100 Jahren ab. Was war hierbei die größte Herausforderung?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, desto schwieriger wird es, interessante Informationen zu finden. Gerade wenn man sich in historische Gefilde begibt, ist die Gefahr groß, dass man sich denkt, „das google ich jetzt mal schnell“. Aber alles Wissen, das man googeln kann, ist gar nicht das interessante Wissen, das später ein Buch spannend macht, denn das kann ja jeder einfach nachschlagen. Deswegen sind es gerade die Informationen, die man nicht googeln kann, die ein Buch lesenswert machen, finde ich. Und dabei habe ich dann gemerkt, dass es schwieriger wird, je weiter man in die Vergangenheit geht. Nehmen wir einmal 1914. Da kann man nicht einfach sich mit Leuten unterhalten und sagen, „erzähl‘ mir mal ein bisschen was“. Je weiter man sich dann der Gegenwart angenähert hat, desto einfacher ist es in der Hinsicht geworden, weil ich zum Teil selber mehr wusste oder auch mehr Personen kannte, die dazu mehr Bezug hatten. Andererseits wächst natürlich die Gefahr, dass man Dinge erzählt, die sowieso schon alle kennen. Insofern hatte beides so seine Tücken.
(c) dtv Verlag
LITERATURPORTAL BAYERN: Wie hat sich die Art und Weise, Gefühle zu artikulieren oder zu verarbeiten, Ihrer Meinung nach verändert?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Alle äußern natürlich ihre Gefühle auf ihre eigene Art, weil fast alle Teile des Romans in verschieden Stimmen verfasst sind. Und diese Stimmen erzählen schon fast in einer Beichtform, im Sinne von „ich erzähle jetzt mal wie es wirklich war“ oder „ich möchte, dass dieses wichtige Wissen weitergegeben wird“. Das ist natürlich unterschiedlich aufgeladen und gerade die in der Vergangenheit liegende Teile waren in der Hinsicht etwas schwieriger, weil ich merkte, dass ich mich als Autor mehr damit auseinandersetzen musste, wie jemand in einer bestimmten Zeit gesprochen, wie offen jemand vor hundert Jahren bestimmte Dinge angesprochen hätte. Zum Teil beginnt man da schon zu zweifeln, wie die konkrete Wortwahl wäre. Aber es gibt sicherlich die Tendenz dazu, dass man heutzutage Sachen wesentlich offener und direkter ansprechen kann. Wichtiger ist es dann, den einzelnen Personen verschiedene Stimmen zu geben und diese auch zu kontrastieren, damit man als Leser nicht das Gefühl hat, dass die Geschichte, die 1914 spielt, genauso klingt wie diejenige, die 2015 spielt.
LITERATURPORTAL BAYERN: Das Leitmotiv der Schatten spielt eine zentrale Rolle. Worin besteht deren Faszination? Inwiefern spielt die Dichotomie Schatten-Licht in der Familiengeschichte eine Rolle?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Ja, das wüsste ich auch gerne [lächelt]. Es gibt ganz klar eine besondere Faszination. Mich sprechen immer wieder Leute an, nachdem sie das Buch gelesen haben und meinen: „Der Schatten steht ja für ...“. Ich sage dann immer, dass das stimmt, aber vielleicht nicht nur dafür. Der Schatten hat im Buch ja ganz verschiedene Ausprägungen. Im Anfangskapitel geht es erst einmal nur um Schattenrisse. Später gibt es aber auch eine Person, die sehr viel Angst hat vor Männern, die keinen Schatten haben, weil sie Angst hat, dass ein wesentlicher Teil ihrer Seele fehlt. In einem späteren Kapitel gibt es jemanden, der seinen eigenen Schatten nicht sehen und sich das nicht erklären kann. So gibt es im Laufe des Romans immer wieder verschiedene Ausprägungen. Ich fand es dann sehr reizvoll, den Schatten in verschiedenen Facetten zu zeigen. Natürlich steht der Schatten für etwas, aber ich überlasse es dem Leser herauszufinden, was er selber in dem Schatten sieht, weil es verschiedene Arten gibt, den Schatten zu deuten.
LITERATURPORTAL BAYERN: Sie leben abwechselnd in Berlin und Neu-Delhi. Was fasziniert Sie so an Indien, und wie kommen Sie mit der unterschiedlichen Kultur in einem anderen Land zurecht?
CHRISTOPHER KLOEBLE: Es gibt natürlich Unterschiede, und das ist sicher auch manchmal eine Herausforderung. Es ist aber nicht so, dass es bloß schwieriger wäre, in Indien zu leben. Es fällt mir immer wieder auf, dass per se die Umstellung immer etwas schwierig ist. Das Leben in Indien bietet genauso viele Vorteile wie Nachteile, die ein bisschen anders gelagert sind als hier. Aber es geht mir wahnsinnig oft so, dass ich zurück nach Berlin komme und merke, dass wir immer denken, dass bei uns alles „normal“, aber im Rest der Welt dafür alles komisch, schwierig und exotisch ist. Aber wir sind auch ziemlich komisch, schwierig und exotisch. Das unterschätzen wir vermutlich ein bisschen oder nehmen das gar nicht so wahr, weil wir es nicht anders kennen. Ich könnte stundenlang über die Unterschiede zwischen Indien und Deutschland sprechen. Deswegen habe ich ja auch ein Buch darüber geschrieben, dass im Laufe des Jahres erscheinen wird. Es ist überraschenderweise so, dass ich gemerkt habe, dass Deutschland viel exotischer ist, als man das gemeinhin annehmen würde.
Verfasserin/Interview: Judith Bauer