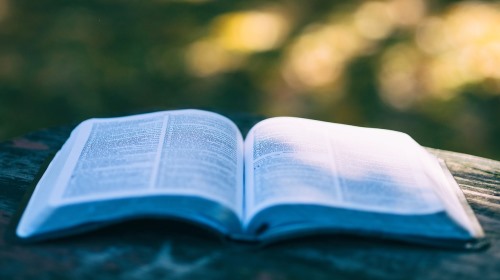Interview mit Benedict Wells über seinen neuen Roman „Vom Ende der Einsamkeit“
Benedict Wells gelang das, wovon viele junge Schriftsteller träumen: 2008 erschien der Roman Becks letzter Sommer des damals 23-Jährigen im Diogenes Verlag und wurde als das „interessanteste Debüt des Jahres“ gefeiert. Es folgten 2009 die Auszeichnung mit dem Bayerischen Kunstförderpreis und 2015 die Verfilmung fürs Kino. Im März 2016 ist sein neues Buch erschienen: Vom Ende der Einsamkeit. Der vierte Roman von Benedict Wells erzählt eine große Liebesgeschichte, von der Überwindung von Verlust und Einsamkeit und von der Frage, was in einem Menschen unveränderlich ist. Am 8. März wird der Autor im Literaturhaus in München daraus lesen. Marina Babl durfte ihm schon vorab einige Fragen stellen.
*
Vom Ende der Einsamkeit
Jules und seine Geschwister Marty und Liz sind grundverschieden, doch sie alle haben als Kinder ihre Eltern durch einen Unfall verloren – eine tragische Gemeinsamkeit. Obwohl sie auf dasselbe Internat kommen, geht jeder seinen eigenen Weg, sie werden sich fremd und verlieren einander aus den Augen. Vor allem der einst so selbstbewusste Jules zieht sich immer mehr in seine Traumwelten zurück. Nur mit der geheimnisvollen Alva schließt er Freundschaft, doch erst Jahre später wird er begreifen, was sie ihm bedeutet – und was sie ihm immer verschwiegen hat. Als Erwachsener begegnet er Alva wieder. Es sieht so aus, als könnten sie die verlorene Zeit zurückgewinnen, doch dann holt sie die Vergangenheit wieder ein.
Literaturportal Bayern: 2011 ist Ihr dritter Roman Fast genial veröffentlicht worden. Seitdem haben Ihre Leser sehnsüchtig auf das Erscheinen des nächsten Romans gewartet. Inzwischen ist es endlich soweit und Vom Ende der Einsamkeit ist im Buchhandel erhältlich. Was hat sich innerhalb dieser fünf Jahre getan und hatten Sie neben diesem Roman noch andere Projekte, denen Sie nachgegangen sind?
Benedict Wells: Mehr als die Hälfte dieser fünf Jahre habe ich in einer WG in Barcelona verbracht, das neben Bayern so etwas wie meine zweite Heimat wurde. Eine tolle Zeit, an die ich immer wieder denke. Und neben dem Roman habe ich noch am Drehbuch zu Fast genial gearbeitet, inzwischen sind wir fast fertig damit. Es wäre natürlich ein Traum, wenn dieser Stoff wirklich in Amerika mit englischsprachigen Schauspielern verfilmt würde.
LPB: In Ihrem Roman darf der Leser über mehrere Jahrzehnte hinweg das Leben von Jules Moreau und seinen Geschwistern Liz und Marty begleiten und kann dabei beobachten, wie sie sich immer wieder aufs Neue voneinander entfernen und wieder zueinander finden. Was ist für Sie das Spannende an Geschwisterbeziehungen?
BW: Zunächst mal kennen sich Geschwister ja ein Leben lang, als Kinder, als Jugendliche, als Erwachsene, es gibt offene Rechnungen und Wunden, aber auch viel Nähe und eine instinktive Liebe. Doch anders als bei Freundschaften hat man sich nun mal nicht ausgesucht. Mir gefällt deshalb die Idee, dass man sich als Erwachsener oft noch einmal neu und diesmal bewusst für dieses Verhältnis entscheiden kann. Auch die drei Geschwister im Buch müssen ja Jahrzehnte später noch mal die Wahl treffen: Wollen sie ein enges Verhältnis haben, und falls ja: nur weil sie verwandt sind, oder weil sie einander wirklich mögen und brauchen?
LPB: In Ihrem Roman tauchen viele faszinierende Figuren auf, die der Leser alle sehr lieb gewinnt und nach Beendigung der Lektüre nur schwer wieder loslassen kann. Haben Sie eine Lieblingsfigur in diesem Buch? Wie würden Sie generell die Beziehung zu Ihren Figuren beschreiben?
BW: Vielen Dank. Für mich sind Charaktere der Schlüssel zu einer Geschichte und oft das Wichtigste beim Schreiben. Ich habe die drei Geschwister und Alva insgesamt sieben Jahre mit mir herumgetragen, die vier waren in jener Zeit wie Familienmitglieder für mich. Auch wenn ich manchen von ihnen erst nach und nach auf die Schliche gekommen bin, denn am Anfang wusste ich längst nicht alles. Eine Lieblingsfigur habe ich aber nicht, das fände ich den anderen gegenüber auch unfair.
LPB: Eine große Frage, die Ihr Roman aufwirft, ist die, wie sehr sich das Leben eines Menschen durch erfahrenes Leid verändern kann und ob es in jedem Menschen einen unveränderlichen Teil gibt, der die Persönlichkeit ausmacht, egal welche Überraschungen das Leben für einen bereithält. Konnten Sie im Laufe Ihres Schreibprozesses für sich eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage finden?
BW: Schwierig, denn ich glaube, dass die Frage selbst fast interessanter ist und keine einzelne, allgemeingültige Antwort zulässt. Ich habe jedenfalls versucht, anhand der vier unterschiedlichen Hauptfiguren vier verschiedene Ansätze zu geben. Sowohl die drei Geschwister wie auch Alva gehen ja völlig anders mit dieser Frage um, und ich glaube, so könnte es wiederum auch bei jedem Leser sein.
LPB: Ganz beiläufig erwähnen Sie in einem Satz ihres Buches, dass Alva für ihre Doktorarbeit jeden Tag in die Bayerische Staatsbibliothek geht. Da wir vom Literaturportal Bayern aufs Engste mit der Staatsbibliothek in Verbindung stehen, sind wir bei diesem Satz natürlich sofort hellhörig geworden. Gibt es einen besonderen Grund, dass Sie hier die Staatsbibliothek anführen und waren Sie selbst schon einmal dort?
BW: Ja, ich war schon öfter da und viele Freunde von mir haben dort für ihr Studium gelernt. Da lag es natürlich nahe, dass auch Alva ab und zu dort vorbeischaut. Ich versuche immer wieder Orte in Büchern unterzubringen, an denen ich selbst oft bin. Etwa meine geliebte Buchhandlung Lehmkuhl, in der Robert Beck aus Becks letzter Sommer seine Romane kauft, oder das inzwischen leider geschlossene Atomic Café.
LPB: Manche Gegebenheiten bleiben auch noch ungeklärt, nachdem der Leser das Buch zu Ende gelesen hat. So erfährt man kaum etwas über die Vergangenheit von Jules Eltern oder Alvas Zeit in Russland. Wissen Sie hier mehr als Sie dem Leser verraten wollen oder bleiben auch in Ihrem Autorenwissen Lücken in den Lebensläufen mancher Figuren?
BW: Ersteres, es war jedoch eine bewusste Entscheidung, diese Lücken zu lassen. Der Roman hatte ursprünglich achthundert Seiten, ich wollte jedoch, dass die Geschichte möglichst spannend und dicht erzählt ist. Deshalb kürzte ich sie im Laufe der Jahre auf gut dreihundertfünfzig Seiten. Und heraus fielen eben auch Stellen über die Vergangenheit von Jules Vater. Es gibt im Buch zwei Momente, wo man das vielleicht spürt. An dem Baum mit dem abgehackten Ast und als Jules einen Brief findet, dessen Herkunft er sich nicht erklären kann. Ich fand es jedoch gut, manche Lücken bewusst zu lassen, quasi ein unsichtbares Buch außerhalb des Buchs zu haben. So kann jeder Leser sich selbst Gedanken machen und einige haben auch schon erraten, was damals passiert ist. Es gibt im Roman ja auch die Stelle, als Jules über seinen Vater, den Fotografen, sagt: „Er hatte seine Vergangenheit bewusst in den Hintergrund gerückt, und es gelang mir nicht mehr, sie scharfzustellen.“ So ähnlich habe ich es mit der Geschichte versucht. Ich wollte Dinge, die mir wichtig waren, in den Vordergrund rücken und das andere unscharf lassen und nicht alles auserzählen.
LPB: In Ihrem ersten Roman Becks letzter Sommer erhält die Hauptfigur Robert Beck an einer der entscheidenden Stellen des Buches von einem Fremden folgenden Rat: „Also denken Sie immer daran: Es geht nur um Erinnerungen.“ Auch in Vom Ende der Einsamkeit besteht fast die gesamte Geschichte aus Erinnerungen des 42-jährigen Jules an sein vergangenes Leben. Was macht Erinnerungen so wertvoll und wieso greifen Sie sie gerne als Motiv in Ihren Romanen auf?
BW: Viele Menschen betrachten ihr Leben als Geschichte, und Erinnerungen sind oft alles, was bleibt. Sie sind die Bilder, mit denen man sich selbst diese Geschichte erzählt. Im Roman gehen Jules und seine Schwester Liz allerdings sehr unterschiedlich mit dieser Frage um. Während er Dinge, die er erlebt hat, oft noch im Nachhinein betrachtet und auf ihren Wert hin auslotet, vergisst seine Schwester vieles Erlebte wieder, um offen für Neues zu sein. Er ist also ein Bewahrer und hängt eher der Vergangenheit nach, sie dagegen ist einfach nur. Je älter ich werde, desto mehr bewundere ich diese Art zu leben.
Interview: Marina Babl
Interview mit Benedict Wells über seinen neuen Roman „Vom Ende der Einsamkeit“
Benedict Wells gelang das, wovon viele junge Schriftsteller träumen: 2008 erschien der Roman Becks letzter Sommer des damals 23-Jährigen im Diogenes Verlag und wurde als das „interessanteste Debüt des Jahres“ gefeiert. Es folgten 2009 die Auszeichnung mit dem Bayerischen Kunstförderpreis und 2015 die Verfilmung fürs Kino. Im März 2016 ist sein neues Buch erschienen: Vom Ende der Einsamkeit. Der vierte Roman von Benedict Wells erzählt eine große Liebesgeschichte, von der Überwindung von Verlust und Einsamkeit und von der Frage, was in einem Menschen unveränderlich ist. Am 8. März wird der Autor im Literaturhaus in München daraus lesen. Marina Babl durfte ihm schon vorab einige Fragen stellen.
*
Vom Ende der Einsamkeit
Jules und seine Geschwister Marty und Liz sind grundverschieden, doch sie alle haben als Kinder ihre Eltern durch einen Unfall verloren – eine tragische Gemeinsamkeit. Obwohl sie auf dasselbe Internat kommen, geht jeder seinen eigenen Weg, sie werden sich fremd und verlieren einander aus den Augen. Vor allem der einst so selbstbewusste Jules zieht sich immer mehr in seine Traumwelten zurück. Nur mit der geheimnisvollen Alva schließt er Freundschaft, doch erst Jahre später wird er begreifen, was sie ihm bedeutet – und was sie ihm immer verschwiegen hat. Als Erwachsener begegnet er Alva wieder. Es sieht so aus, als könnten sie die verlorene Zeit zurückgewinnen, doch dann holt sie die Vergangenheit wieder ein.
Literaturportal Bayern: 2011 ist Ihr dritter Roman Fast genial veröffentlicht worden. Seitdem haben Ihre Leser sehnsüchtig auf das Erscheinen des nächsten Romans gewartet. Inzwischen ist es endlich soweit und Vom Ende der Einsamkeit ist im Buchhandel erhältlich. Was hat sich innerhalb dieser fünf Jahre getan und hatten Sie neben diesem Roman noch andere Projekte, denen Sie nachgegangen sind?
Benedict Wells: Mehr als die Hälfte dieser fünf Jahre habe ich in einer WG in Barcelona verbracht, das neben Bayern so etwas wie meine zweite Heimat wurde. Eine tolle Zeit, an die ich immer wieder denke. Und neben dem Roman habe ich noch am Drehbuch zu Fast genial gearbeitet, inzwischen sind wir fast fertig damit. Es wäre natürlich ein Traum, wenn dieser Stoff wirklich in Amerika mit englischsprachigen Schauspielern verfilmt würde.
LPB: In Ihrem Roman darf der Leser über mehrere Jahrzehnte hinweg das Leben von Jules Moreau und seinen Geschwistern Liz und Marty begleiten und kann dabei beobachten, wie sie sich immer wieder aufs Neue voneinander entfernen und wieder zueinander finden. Was ist für Sie das Spannende an Geschwisterbeziehungen?
BW: Zunächst mal kennen sich Geschwister ja ein Leben lang, als Kinder, als Jugendliche, als Erwachsene, es gibt offene Rechnungen und Wunden, aber auch viel Nähe und eine instinktive Liebe. Doch anders als bei Freundschaften hat man sich nun mal nicht ausgesucht. Mir gefällt deshalb die Idee, dass man sich als Erwachsener oft noch einmal neu und diesmal bewusst für dieses Verhältnis entscheiden kann. Auch die drei Geschwister im Buch müssen ja Jahrzehnte später noch mal die Wahl treffen: Wollen sie ein enges Verhältnis haben, und falls ja: nur weil sie verwandt sind, oder weil sie einander wirklich mögen und brauchen?
LPB: In Ihrem Roman tauchen viele faszinierende Figuren auf, die der Leser alle sehr lieb gewinnt und nach Beendigung der Lektüre nur schwer wieder loslassen kann. Haben Sie eine Lieblingsfigur in diesem Buch? Wie würden Sie generell die Beziehung zu Ihren Figuren beschreiben?
BW: Vielen Dank. Für mich sind Charaktere der Schlüssel zu einer Geschichte und oft das Wichtigste beim Schreiben. Ich habe die drei Geschwister und Alva insgesamt sieben Jahre mit mir herumgetragen, die vier waren in jener Zeit wie Familienmitglieder für mich. Auch wenn ich manchen von ihnen erst nach und nach auf die Schliche gekommen bin, denn am Anfang wusste ich längst nicht alles. Eine Lieblingsfigur habe ich aber nicht, das fände ich den anderen gegenüber auch unfair.
LPB: Eine große Frage, die Ihr Roman aufwirft, ist die, wie sehr sich das Leben eines Menschen durch erfahrenes Leid verändern kann und ob es in jedem Menschen einen unveränderlichen Teil gibt, der die Persönlichkeit ausmacht, egal welche Überraschungen das Leben für einen bereithält. Konnten Sie im Laufe Ihres Schreibprozesses für sich eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage finden?
BW: Schwierig, denn ich glaube, dass die Frage selbst fast interessanter ist und keine einzelne, allgemeingültige Antwort zulässt. Ich habe jedenfalls versucht, anhand der vier unterschiedlichen Hauptfiguren vier verschiedene Ansätze zu geben. Sowohl die drei Geschwister wie auch Alva gehen ja völlig anders mit dieser Frage um, und ich glaube, so könnte es wiederum auch bei jedem Leser sein.
LPB: Ganz beiläufig erwähnen Sie in einem Satz ihres Buches, dass Alva für ihre Doktorarbeit jeden Tag in die Bayerische Staatsbibliothek geht. Da wir vom Literaturportal Bayern aufs Engste mit der Staatsbibliothek in Verbindung stehen, sind wir bei diesem Satz natürlich sofort hellhörig geworden. Gibt es einen besonderen Grund, dass Sie hier die Staatsbibliothek anführen und waren Sie selbst schon einmal dort?
BW: Ja, ich war schon öfter da und viele Freunde von mir haben dort für ihr Studium gelernt. Da lag es natürlich nahe, dass auch Alva ab und zu dort vorbeischaut. Ich versuche immer wieder Orte in Büchern unterzubringen, an denen ich selbst oft bin. Etwa meine geliebte Buchhandlung Lehmkuhl, in der Robert Beck aus Becks letzter Sommer seine Romane kauft, oder das inzwischen leider geschlossene Atomic Café.
LPB: Manche Gegebenheiten bleiben auch noch ungeklärt, nachdem der Leser das Buch zu Ende gelesen hat. So erfährt man kaum etwas über die Vergangenheit von Jules Eltern oder Alvas Zeit in Russland. Wissen Sie hier mehr als Sie dem Leser verraten wollen oder bleiben auch in Ihrem Autorenwissen Lücken in den Lebensläufen mancher Figuren?
BW: Ersteres, es war jedoch eine bewusste Entscheidung, diese Lücken zu lassen. Der Roman hatte ursprünglich achthundert Seiten, ich wollte jedoch, dass die Geschichte möglichst spannend und dicht erzählt ist. Deshalb kürzte ich sie im Laufe der Jahre auf gut dreihundertfünfzig Seiten. Und heraus fielen eben auch Stellen über die Vergangenheit von Jules Vater. Es gibt im Buch zwei Momente, wo man das vielleicht spürt. An dem Baum mit dem abgehackten Ast und als Jules einen Brief findet, dessen Herkunft er sich nicht erklären kann. Ich fand es jedoch gut, manche Lücken bewusst zu lassen, quasi ein unsichtbares Buch außerhalb des Buchs zu haben. So kann jeder Leser sich selbst Gedanken machen und einige haben auch schon erraten, was damals passiert ist. Es gibt im Roman ja auch die Stelle, als Jules über seinen Vater, den Fotografen, sagt: „Er hatte seine Vergangenheit bewusst in den Hintergrund gerückt, und es gelang mir nicht mehr, sie scharfzustellen.“ So ähnlich habe ich es mit der Geschichte versucht. Ich wollte Dinge, die mir wichtig waren, in den Vordergrund rücken und das andere unscharf lassen und nicht alles auserzählen.
LPB: In Ihrem ersten Roman Becks letzter Sommer erhält die Hauptfigur Robert Beck an einer der entscheidenden Stellen des Buches von einem Fremden folgenden Rat: „Also denken Sie immer daran: Es geht nur um Erinnerungen.“ Auch in Vom Ende der Einsamkeit besteht fast die gesamte Geschichte aus Erinnerungen des 42-jährigen Jules an sein vergangenes Leben. Was macht Erinnerungen so wertvoll und wieso greifen Sie sie gerne als Motiv in Ihren Romanen auf?
BW: Viele Menschen betrachten ihr Leben als Geschichte, und Erinnerungen sind oft alles, was bleibt. Sie sind die Bilder, mit denen man sich selbst diese Geschichte erzählt. Im Roman gehen Jules und seine Schwester Liz allerdings sehr unterschiedlich mit dieser Frage um. Während er Dinge, die er erlebt hat, oft noch im Nachhinein betrachtet und auf ihren Wert hin auslotet, vergisst seine Schwester vieles Erlebte wieder, um offen für Neues zu sein. Er ist also ein Bewahrer und hängt eher der Vergangenheit nach, sie dagegen ist einfach nur. Je älter ich werde, desto mehr bewundere ich diese Art zu leben.
Interview: Marina Babl