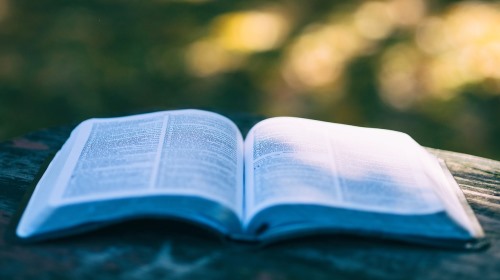Ein Gespräch mit dem Chamisso-Preisträger Akos Doma, Teil II
Wann haben Sie angefangen zu übersetzen? Kam das Schreiben zuerst oder das Übersetzen?
AD: Geschrieben habe ich immer schon. Und zum Übersetzen kam ich wie die Jungfrau zum Kind: Ich bin mit meinen Manuskripten zu Verlagen, und statt mein Manuskript loszuwerden, bekam ich ein zweites dazu. Ich bin da hineingeschlittert. Beide Tätigkeiten ergänzen sich allerdings gut: Man sucht in beiden Fällen nach dem richtigen Ausdruck. Als Autor hat man natürlich mehr Freiheiten, während man als Übersetzer dem Text zu hundert Prozent verpflichtet ist. Aber im Grund sind das Schreiben und das Übersetzen einander sehr nahe: Beides ist Arbeit an der Sprache.
Und wann hat ein Verlag dann Ihr Manuskript angenommen?
AD: Mein erster Roman „Der Müßiggänger“ ist 2001 erschienen, aber daran gearbeitet habe ich fünf, sechs Jahre. Die meisten der Texte, die ich davor geschrieben habe, sind Jugendsünden, die haben einfach nicht die Reife, sind adoleszent und viel zu romantisch. Meine Sprache habe ich mir erst im Lauf des „Müßiggängers“ erarbeitet. Nach der ersten Niederschrift, als ich am Ende ankam und wieder am Anfang las, war ich schockiert, wie schlecht der Anfang war – weil ich mich während des Schreibens weiterentwickelt hatte. Und das wiederholte sich fünf Mal, dass ich am Ende zurückgeblättert habe und es schlecht fand, und dann ging´s wieder los. Ich habe mir die deutsche Sprache in diesem Roman erarbeitet oder sie wenigstens perfektioniert.
Zugleich hat der ziellos durchs Leben treibende Ich-Erzähler gerade an der Sprache große Zweifel: Mal erscheint sie ihm hohl, dann wieder zu bedeutend, um noch damit zurecht zu kommen. Auch trägt er keinen Namen.
AD: Ja, er hat an allem Zweifel, er ist wie gelähmt. Was ihn mit den Figuren in meinem zweiten Roman „Die allgemeine Tauglichkeit“ verbindet, ist, dass sie alle auf der Flucht sind und mit der Gesellschaft nichts am Hut haben wollen. Das Unbehagen an dieser Gesellschaft ist der Grundtenor. Das Unbehagen an dem, was die Gesellschaft aus dem an sich wunderbaren Geschenk des Lebens macht, das ist der Ausgangspunkt. Deswegen halten sie sich abseits, das ist so eine Art innere Emigration. Mir gefällt dieser Ausdruck, so kann man sich auch heute zurückziehen.
Ich würde statt Unbehagen eher „Unbehaustheit“ sagen, denn ihre Figuren eint außerdem die Tatsache, dass sie in wahren Bruchbuden hausen.
AD: Das ist etwas Romantisches. In der Romantik hat man sogar Ruinen neu gebaut, so etwas Absurdes. Ich mag einfach alles, was Patina hat, was atmet, was Atmosphäre hat. Nicht die hübschen, abgeschleckten Häuser, sondern das Wilde, mitten in der Natur.
Aber in „Die allgemeine Tauglichkeit“ findet gerade die entgegengesetzte Entwicklung statt: Eine Truppe aus vier Arbeitslosen packt plötzlich an, um ihre Bruchbude zur Landpension aufzuhübschen.
AD: Ja, das ist Albert geschuldet. Das ist die Gegenfigur, die zu den Vieren stößt und sie anleiten möchte, dass sie endlich etwas aus ihrem Leben machen, tüchtig werden. Viele Leser sind begeistert von diesem Albert, aber für mich ist er eine zwielichtige Figur: Man erfährt nie, warum er das alles tut. Wobei ich nicht in die Guten und die Bösen aufteilen will. Es geht um zwei verschiedene Arten zu leben: Was gewinnt man und was verliert man bei der jeweiligen Lebensweise? Die Vier verfügen ja über wertvolle Dinge: Sie haben Freiheit, Freundschaft, Unabhängigkeit, Gemeinschaft. Aber als Albert dazustößt, merken sie, was sie alles entbehren: dass man auch bessere Sachen essen kann, dass man normaler leben kann, dass man durch Arbeit die Wertschätzung der Gesellschaft gewinnen kann. Aber vielleicht geht auch etwas anderes dadurch verloren. Ich lote diese zwei Möglichkeiten aus.
Betrachtet man allein das Figurenpersonal, die vier Arbeitslosen, könnte man „Die allgemeine Tauglichkeit“ fast für ein sozialkritisches Buch halten.
AD: Nein, das ist keine Sozialstudie über Obdachlose, es ist in dem Sinne nicht realistisch. Mir geht es um innere Befindlichkeiten, und so gesehen glaube ich, diese Leute zu verstehen. Es geht immer um das Innen und das Außen: Diese Figuren entbehren äußerlich sehr viel, sind aber innerlich reich an Freundschaft, an Gefühlen, an Freiheit, an Liebe. Das ist ein Gegenentwurf, denn das kommt heute furchtbar kurz: All die Dinge, die uns am Leben erhalten – Freundschaft, Liebe, Gemeinschaft – wo gibt es die noch in Zeiten, da die Arbeit, all die Zwänge, der ganze Konsumismus alles dominiert? Diese Figuren leben das Innerliche, deshalb sind sie für mich die Helden des Romans.
Sie scheinen ohnehin weniger am Einzelnen, sondern vor allem an Konstellationen interessiert zu sein.
AD: Ja, darum schreibe ich! Die zwischenmenschlichen Beziehungen, damit spiele ich, das fasziniert und inspiriert mich. Ich könnte unmöglich einen Roman über einen Manager schreiben. Nicht nur, weil ich mich damit nicht auskenne oder nicht weiß, wie diese Leute ticken, sondern weil es mich unendlich langweilen würde. Ich tauche gerne tief in die Figuren ein, ich lote Beziehungen aus. Die gesellschaftliche Ebene, die Arbeitsebene finde ich nicht besonders spannend.
Sie meiden Arbeitende ja sogar sehr ausdrücklich, in beiden Romanen geht es um Menschen ohne Arbeit
AD: Es interessiert mich einfach nicht. Der Schreibakt ist schwierig, ich muss ja jahrelang mit meinen Figuren leben, und ich möchte nicht zwei Jahre mit einem Manager verbringen. Deswegen suche ich nach Menschen, die innerlich unabhängiger sind.
Man ist sehr geneigt, die Unbehaustheit ihrer Figuren auf Ihren Migrationshintergrund zurückzulesen. Mögen Sie das oder ist das unangenehm?
AD: Das hat aus meiner Sicht überhaupt nichts damit zu tun. Das ist kulturell, gesellschaftlich, geschichtlich. Unsere Zeit ist meiner Meinung nach eine Zeit beispielloser Rohheit, diese Scheinheiligkeit heutzutage, diese Diskrepanz zwischen den Werten, die wir hochhalten, und der Wirklichkeit, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir mit der „Dritten Welt“ umgehen, das ist unglaublich, das ist himmelschreiend. Und das versuche ich irgendwie – abzuarbeiten. Man muss ja darin leben, man wird auch schuldig, weil man Teil dieser Gesellschaft ist, ich lebe schließlich nicht auf dem Mond.
Kann man denn überhaupt davor fliehen wie der Müßiggänger?
AD: Er tut es ja! Es gibt die Vorstellung von Literatur als Erlösung, das gefällt mir. Indem ich es niederschreibe, und wenn es mir gelingt, es authentisch niederzuschreiben, dann wird es ein Stück Wirklichkeit. Auch wenn es märchenhaft oder nicht wahrscheinlich ist, völlig egal, ob das geht oder nicht: Es steht da und ist damit wirklich, und für den Leser, der das liest, wird es auch ein Stück Wirklichkeit. Auf diese Weise kann ich vielleicht ein bisschen in eine positive Richtung wirken. Nicht auf einer platten Ebene, indem ich eine Botschaft loswerde. Das Leben lässt sich schließlich nicht auf Slogans reduzieren.
Information über den Autor
Akos Doma wurde 1963 in Budapest geboren, er wuchs in Ungarn, Italien und England auf und kam mit 14 Jahren nach Deutschland. Er promovierte über Knut Hamsun und D.H. Lawrence. 2001 erschien sein Debütroman „Der Müßiggänger“, 2010 folgte „Die allgemeine Tauglichkeit“. Akos Doma ist Schriftsteller und vielfach ausgezeichneter Übersetzer, u.a. von László Földényi, Péter Nádas und Sándor Márai. Akos Doma lebt mit seiner Familie in Eichstätt.
Sein bei Rotbuch erschienener Roman „Die allgemeine Tauglichkeit“ handelt von Igor, Amir, Ferdinand und Ludovik, vier gestrandeten Lebenskünstlern, die arbeitslos in einer Bruchbude am Stadtrand hausen. Sie schlagen sich mit Diebstählen und Einbrüchen durch und treiben mit ihren Mitmenschen ihr Spiel. Wenn der Winter durch die Ritzen ihres Hauses zieht, rücken sie enger zusammen und träumen von der schönen Sibylle und dem „wahren“ Leben. Eines Tages steht es vor der Tür – in Gestalt des charismatischen Erfolgstypen Albert. Er will aus den vier Totalverweigerern „ordentliche Leute“ machen, sie zurück in die Mitte der Gesellschaft holen. Den Plan dazu hat er auch: Aus dem Haus am Bahndamm soll eine Pension werden. Nach einem rauschhaft durchgearbeiteten Sommer scheint sich für Ferdinand und seine Freunde tatsächlich die Tür in ein anderes Leben zu öffnen. Doch ein letzter Ausreißversuch der vier endet verhängnisvoll.
Ein Gespräch mit dem Chamisso-Preisträger Akos Doma, Teil II
Wann haben Sie angefangen zu übersetzen? Kam das Schreiben zuerst oder das Übersetzen?
AD: Geschrieben habe ich immer schon. Und zum Übersetzen kam ich wie die Jungfrau zum Kind: Ich bin mit meinen Manuskripten zu Verlagen, und statt mein Manuskript loszuwerden, bekam ich ein zweites dazu. Ich bin da hineingeschlittert. Beide Tätigkeiten ergänzen sich allerdings gut: Man sucht in beiden Fällen nach dem richtigen Ausdruck. Als Autor hat man natürlich mehr Freiheiten, während man als Übersetzer dem Text zu hundert Prozent verpflichtet ist. Aber im Grund sind das Schreiben und das Übersetzen einander sehr nahe: Beides ist Arbeit an der Sprache.
Und wann hat ein Verlag dann Ihr Manuskript angenommen?
AD: Mein erster Roman „Der Müßiggänger“ ist 2001 erschienen, aber daran gearbeitet habe ich fünf, sechs Jahre. Die meisten der Texte, die ich davor geschrieben habe, sind Jugendsünden, die haben einfach nicht die Reife, sind adoleszent und viel zu romantisch. Meine Sprache habe ich mir erst im Lauf des „Müßiggängers“ erarbeitet. Nach der ersten Niederschrift, als ich am Ende ankam und wieder am Anfang las, war ich schockiert, wie schlecht der Anfang war – weil ich mich während des Schreibens weiterentwickelt hatte. Und das wiederholte sich fünf Mal, dass ich am Ende zurückgeblättert habe und es schlecht fand, und dann ging´s wieder los. Ich habe mir die deutsche Sprache in diesem Roman erarbeitet oder sie wenigstens perfektioniert.
Zugleich hat der ziellos durchs Leben treibende Ich-Erzähler gerade an der Sprache große Zweifel: Mal erscheint sie ihm hohl, dann wieder zu bedeutend, um noch damit zurecht zu kommen. Auch trägt er keinen Namen.
AD: Ja, er hat an allem Zweifel, er ist wie gelähmt. Was ihn mit den Figuren in meinem zweiten Roman „Die allgemeine Tauglichkeit“ verbindet, ist, dass sie alle auf der Flucht sind und mit der Gesellschaft nichts am Hut haben wollen. Das Unbehagen an dieser Gesellschaft ist der Grundtenor. Das Unbehagen an dem, was die Gesellschaft aus dem an sich wunderbaren Geschenk des Lebens macht, das ist der Ausgangspunkt. Deswegen halten sie sich abseits, das ist so eine Art innere Emigration. Mir gefällt dieser Ausdruck, so kann man sich auch heute zurückziehen.
Ich würde statt Unbehagen eher „Unbehaustheit“ sagen, denn ihre Figuren eint außerdem die Tatsache, dass sie in wahren Bruchbuden hausen.
AD: Das ist etwas Romantisches. In der Romantik hat man sogar Ruinen neu gebaut, so etwas Absurdes. Ich mag einfach alles, was Patina hat, was atmet, was Atmosphäre hat. Nicht die hübschen, abgeschleckten Häuser, sondern das Wilde, mitten in der Natur.
Aber in „Die allgemeine Tauglichkeit“ findet gerade die entgegengesetzte Entwicklung statt: Eine Truppe aus vier Arbeitslosen packt plötzlich an, um ihre Bruchbude zur Landpension aufzuhübschen.
AD: Ja, das ist Albert geschuldet. Das ist die Gegenfigur, die zu den Vieren stößt und sie anleiten möchte, dass sie endlich etwas aus ihrem Leben machen, tüchtig werden. Viele Leser sind begeistert von diesem Albert, aber für mich ist er eine zwielichtige Figur: Man erfährt nie, warum er das alles tut. Wobei ich nicht in die Guten und die Bösen aufteilen will. Es geht um zwei verschiedene Arten zu leben: Was gewinnt man und was verliert man bei der jeweiligen Lebensweise? Die Vier verfügen ja über wertvolle Dinge: Sie haben Freiheit, Freundschaft, Unabhängigkeit, Gemeinschaft. Aber als Albert dazustößt, merken sie, was sie alles entbehren: dass man auch bessere Sachen essen kann, dass man normaler leben kann, dass man durch Arbeit die Wertschätzung der Gesellschaft gewinnen kann. Aber vielleicht geht auch etwas anderes dadurch verloren. Ich lote diese zwei Möglichkeiten aus.
Betrachtet man allein das Figurenpersonal, die vier Arbeitslosen, könnte man „Die allgemeine Tauglichkeit“ fast für ein sozialkritisches Buch halten.
AD: Nein, das ist keine Sozialstudie über Obdachlose, es ist in dem Sinne nicht realistisch. Mir geht es um innere Befindlichkeiten, und so gesehen glaube ich, diese Leute zu verstehen. Es geht immer um das Innen und das Außen: Diese Figuren entbehren äußerlich sehr viel, sind aber innerlich reich an Freundschaft, an Gefühlen, an Freiheit, an Liebe. Das ist ein Gegenentwurf, denn das kommt heute furchtbar kurz: All die Dinge, die uns am Leben erhalten – Freundschaft, Liebe, Gemeinschaft – wo gibt es die noch in Zeiten, da die Arbeit, all die Zwänge, der ganze Konsumismus alles dominiert? Diese Figuren leben das Innerliche, deshalb sind sie für mich die Helden des Romans.
Sie scheinen ohnehin weniger am Einzelnen, sondern vor allem an Konstellationen interessiert zu sein.
AD: Ja, darum schreibe ich! Die zwischenmenschlichen Beziehungen, damit spiele ich, das fasziniert und inspiriert mich. Ich könnte unmöglich einen Roman über einen Manager schreiben. Nicht nur, weil ich mich damit nicht auskenne oder nicht weiß, wie diese Leute ticken, sondern weil es mich unendlich langweilen würde. Ich tauche gerne tief in die Figuren ein, ich lote Beziehungen aus. Die gesellschaftliche Ebene, die Arbeitsebene finde ich nicht besonders spannend.
Sie meiden Arbeitende ja sogar sehr ausdrücklich, in beiden Romanen geht es um Menschen ohne Arbeit
AD: Es interessiert mich einfach nicht. Der Schreibakt ist schwierig, ich muss ja jahrelang mit meinen Figuren leben, und ich möchte nicht zwei Jahre mit einem Manager verbringen. Deswegen suche ich nach Menschen, die innerlich unabhängiger sind.
Man ist sehr geneigt, die Unbehaustheit ihrer Figuren auf Ihren Migrationshintergrund zurückzulesen. Mögen Sie das oder ist das unangenehm?
AD: Das hat aus meiner Sicht überhaupt nichts damit zu tun. Das ist kulturell, gesellschaftlich, geschichtlich. Unsere Zeit ist meiner Meinung nach eine Zeit beispielloser Rohheit, diese Scheinheiligkeit heutzutage, diese Diskrepanz zwischen den Werten, die wir hochhalten, und der Wirklichkeit, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir mit der „Dritten Welt“ umgehen, das ist unglaublich, das ist himmelschreiend. Und das versuche ich irgendwie – abzuarbeiten. Man muss ja darin leben, man wird auch schuldig, weil man Teil dieser Gesellschaft ist, ich lebe schließlich nicht auf dem Mond.
Kann man denn überhaupt davor fliehen wie der Müßiggänger?
AD: Er tut es ja! Es gibt die Vorstellung von Literatur als Erlösung, das gefällt mir. Indem ich es niederschreibe, und wenn es mir gelingt, es authentisch niederzuschreiben, dann wird es ein Stück Wirklichkeit. Auch wenn es märchenhaft oder nicht wahrscheinlich ist, völlig egal, ob das geht oder nicht: Es steht da und ist damit wirklich, und für den Leser, der das liest, wird es auch ein Stück Wirklichkeit. Auf diese Weise kann ich vielleicht ein bisschen in eine positive Richtung wirken. Nicht auf einer platten Ebene, indem ich eine Botschaft loswerde. Das Leben lässt sich schließlich nicht auf Slogans reduzieren.
Information über den Autor
Akos Doma wurde 1963 in Budapest geboren, er wuchs in Ungarn, Italien und England auf und kam mit 14 Jahren nach Deutschland. Er promovierte über Knut Hamsun und D.H. Lawrence. 2001 erschien sein Debütroman „Der Müßiggänger“, 2010 folgte „Die allgemeine Tauglichkeit“. Akos Doma ist Schriftsteller und vielfach ausgezeichneter Übersetzer, u.a. von László Földényi, Péter Nádas und Sándor Márai. Akos Doma lebt mit seiner Familie in Eichstätt.
Sein bei Rotbuch erschienener Roman „Die allgemeine Tauglichkeit“ handelt von Igor, Amir, Ferdinand und Ludovik, vier gestrandeten Lebenskünstlern, die arbeitslos in einer Bruchbude am Stadtrand hausen. Sie schlagen sich mit Diebstählen und Einbrüchen durch und treiben mit ihren Mitmenschen ihr Spiel. Wenn der Winter durch die Ritzen ihres Hauses zieht, rücken sie enger zusammen und träumen von der schönen Sibylle und dem „wahren“ Leben. Eines Tages steht es vor der Tür – in Gestalt des charismatischen Erfolgstypen Albert. Er will aus den vier Totalverweigerern „ordentliche Leute“ machen, sie zurück in die Mitte der Gesellschaft holen. Den Plan dazu hat er auch: Aus dem Haus am Bahndamm soll eine Pension werden. Nach einem rauschhaft durchgearbeiteten Sommer scheint sich für Ferdinand und seine Freunde tatsächlich die Tür in ein anderes Leben zu öffnen. Doch ein letzter Ausreißversuch der vier endet verhängnisvoll.